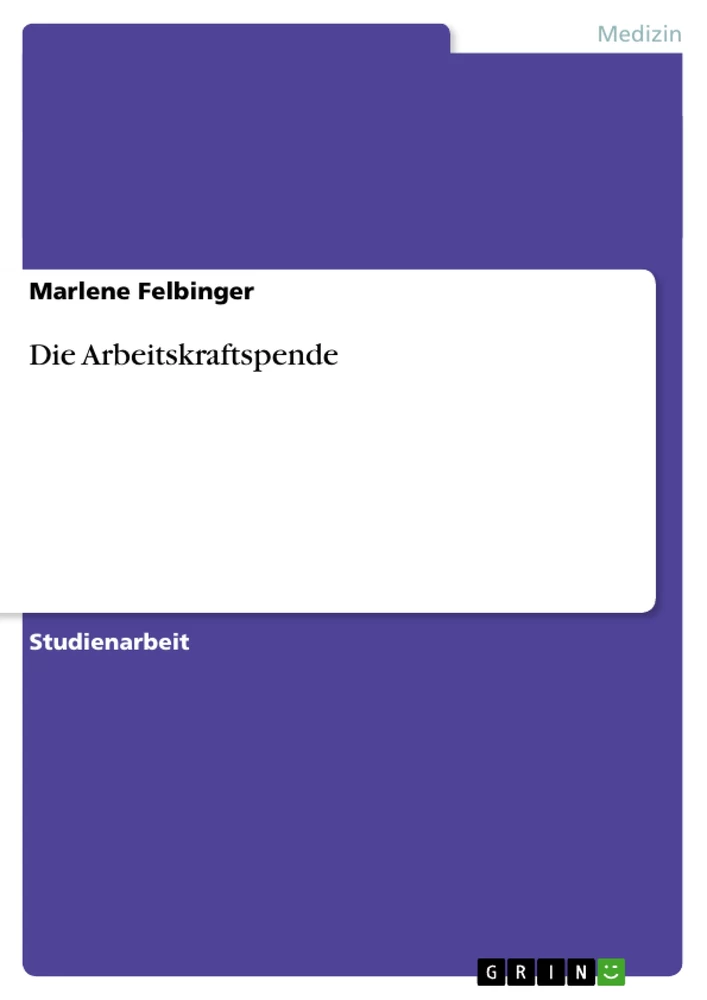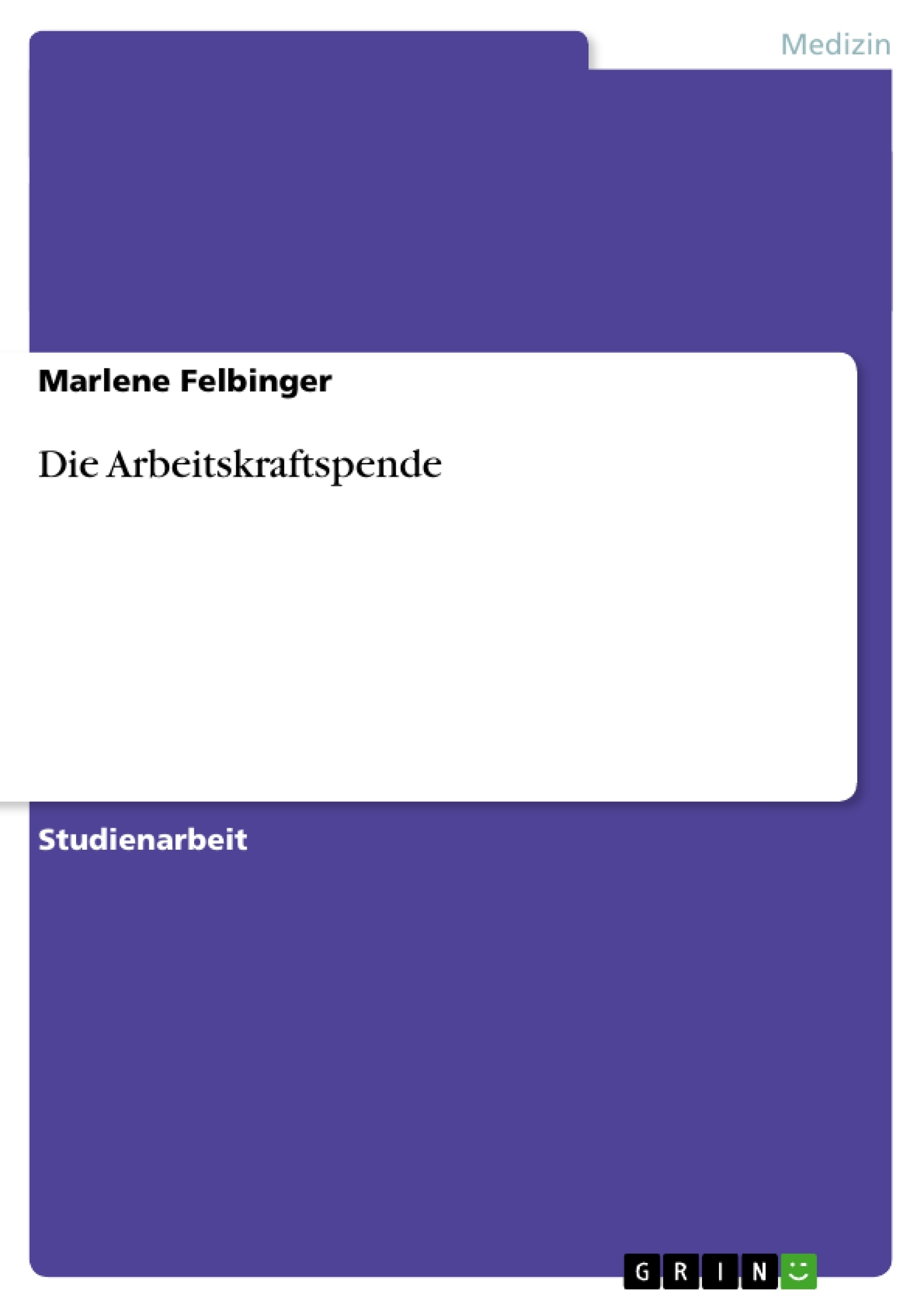Inhalt:
1 Was ist ehrenamtliche Arbeit?
1.1 Gesetzliche Begriffsumschreibung
2 Motive für ehrenamtliche Arbeit
2.1 Die altruistische Komponente
2.2 Die Eigenwertkomponente
2.3 Die Tauschkomponente
3 Formen der ehrenamtlichen Arbeit
3.1 Laienarbeit und professionelle Arbeit
3.2 Eigen- oder Fremdbedarf
3.3 Leitende oder ausführende Tätigkeit
3.4 Hauptberufliche oder nebenberufliche ehrenamtliche Tätigkeit
3.5 „Alte“ und „neue“ Ehrenamtliche
3.6 Ehrenamtliche Arbeit innerhalb und außerhalb von NPOs
4 Freiwilliges Engagement als Ressource
5 Die Akquisition von Ehrenamtlichen
5.1 Entwicklungsstand in den Niederlanden
5.2 Entwicklungsstand in der Bundesrepublik Deutschland
5.3 Rahmenbedingungen der Politik
5.4 Alternative Unterstützungsmöglichkeiten
5.5 Ausblick
6 Ehrenamt als Managementaufgabe
6.1 Zusammenhang zwischen Ehrenamtlichkeit und Leistungsqualität
6.1.1 Verfügbarkeit des ehrenamtlichen Personals
6.1.2 Verlässlichkeit des Ehrenamtlichen
6.1.3 Selbstausbeutung
6.1.4 Juristische Probleme
6.2 Abstimmungsprobleme zwischen ehrenamtlicher und bezahlter Arbeit
7 Werte der ehrenamtlichen Arbeit
7.1 Produktionswert der ehrenamtlichen Arbeit
7.2 Einsparungen durch ehrenamtliche Arbeit
7.3 Gesellschaftspolitische Grundwerte
Anhang
Einige statistische Daten über die ehrenamtliche Arbeit
Literaturverzeichnis
Die Arbeitskraftspende
Was ist ehrenamtliche Arbeit?
Ehrenamtliche Arbeit ist eine Arbeitsleistung, der kein monetärer Gegenfluß gegenüber steht. Ehrenamtliche Arbeit wird in der Alltagssprache (vor allem in der Schweiz) und auch in der Fachwelt bisweilen mit dem Ausdruck „Freiwilligenarbeit“ bezeichnet. Dies entspricht der wörtlichen Übersetzung des englischen Ausdrucks „voluntary work“ oder „volunteer labor“. Der weit verbreitete Terminus „ Freiwilligenarbeit“ muss kritisch betrachtet werden, weil er missverständlich ist: Auch bezahlte Arbeit ist in der Regel keine „Zwangsarbeit“ und müsste daher im Hinblick auf den Begriffsinhalt eigentlich als Freiwilligenarbeit bezeichnet werden.
Gesetzliche Begriffsumschreibung
Die Bezeichnung „Ehrenamt“ bzw. „ehrenamtlich“ tritt vereinzelt in Gesetzen auf. So sprechen etwa § 37 BetrVG und § 46 BPersVG davon, dass die Mitglieder des Betriebs- und Personalrats ihre Ämter unentgeltlich als „Ehrenämter“ führen. § 1 DRiG bestimmt, dass die rechtsprechende Gewalt durch BerufsrichterInnen und ehrenamtliche RichterInnen ausgeübt wird. Auch Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane der Sozialversicherungsträger sowie die entsprechenden Versichertenältesten und Vertrauensleute nehmen ihre Aufgaben gemäß § 40 SGB IV ehrenamtlich wahr. Schließlich begründet Art.121 BV eine Pflicht zur Übernahme von Ehrenämtern, die auf kommunaler Ebene durch Art. 19 BayGO konkretisiert wird.
Alle genannten Vorschriften beschränken sich jedoch darauf, einzelne Funktionen oder Tätigkeiten als Ehrenämter zu bezeichnen, ohne diesen Begriff zu bestimmen.
Es können sehr verschiedenartige Beweggründe sein, die Menschen dazu veranlassen, ehrenamtliche Arbeit zu leisten.
Motive für ehrenamtliche Arbeit
Ehrenamtliche Arbeit tritt in verschiedenen Formen auf und es gibt viele Komponenten und ein breites Bündel von individuellen Motiven, für ehrenamtliche Arbeitsleistungen. Es kann den Ehrenamtlichen um den Nutzen oder um die Lebenssituation des Leistungsempfängers gehen. Ein solches Verhalten wird als altruistisch bezeichnet. Es kann aber auch sein, dass der eigene Nutzen der/des Ehrenamtlichen im Vordergrund steht. Dieser Nutzen kann sowohl aus dem Prozess, als auch aus dem Ergebnis der ehrenamtlichen Tätigkeit erhofft werden.
Die soziologische und psychologische Forschung hat eine Vielzahl von Motiven formuliert, die einer ehrenamtlichen Tätigkeit zugrunde liegen können. Diese sollen nun im Einzelnen dargestellt werden, auch wenn es in der Realität oft zur Vermischung von mehreren Komponenten kommt.
Die altruistische Komponente
Ehrenamtliche engagieren sich oft, weil es ihnen um die „gute Sache“ geht. Sie möchten eine bestimmte Einrichtung unterstützen, einer Idee, die der Gemeinschaft dient, zum Durchbruch verhelfen oder einfach helfen, indem sie ihre Kraft einer Person oder einer Institution zur Verfügung stellen, die diese Hilfe braucht. Nach soziologischer Sichtweise beziehen sich diese Motive auf die Hilfesuchenden oder die Hilfeleistung selbst.
Aus ökonomischer Sicht geht es bei diesen Motiven darum, den Nutzen einer anderen Person oder auch der Allgemeinheit zu erhöhen.
Ehrenamtliche Tätigkeiten aus diesem Motiv bergen die Gefahr, dass die Vorstellungen des /der Ehrenamtlichen und die Wunschvorstellungen der LeistungsempfängerInnen auseinanderklaffen. Ein Problem, dessen Brisanz vor allem in der sozialen Arbeit gut bekannt ist.
Es sind offenkundig ethische, religiöse, politische oder ähnliche Gründe die einem altruistischem Motiv zugrunde liegen. Das altruistische Motiv ist oft mit einem bestimmten Biographieverlauf konsistent. Manche Menschen betreiben ein Leben lang Ehrenamtlichkeit als Dienst und Pflichterfüllung.
Die Eigenwertkomponente
Ehrenamtliche Arbeit kann in unterschiedlicher Weise Nutzen für die Ehrenamtlichen bringen. Dieser Nutzen leitet sich mehr aus dem Prozess der Arbeit und weniger aus dem Arbeitsergebnis ab, in dem die Ehrenamtlichen aus ihrer Arbeit etwas erhalten, was sie nicht vom Leistungsempfänger selbst im Sinne einer ausdrücklichen Gegenleistung bekommen. Hinter dem Eigenwert der Arbeit stehen meist Motive wie soziale Integration, persönliche Zufriedenheit, Erwerb von sozialem Status, sinnvolle Freizeitgestaltung etc.
Die Arbeitsbedingungen heben sich oft positiv von jenen im Erwerbsleben ab, wie z.B. durch eine weitgehende Zeitautonomie. Es entsteht eine „Helferrückwirkung“, d.h. der Die ehrenamtliche HelferIn gewinnt durch seine /ihre Arbeit Zufriedenheit, Kompetenzerweiterung, Persönlichkeitsentwicklung etc. Es wird sogar empirisch belegt, dass unentgeltliche Arbeit sich positiv auf die Gesundheit der Ehrenamtlichen auswirkt. (z.B. die Stress-Puffer-Effekt Studie v. Meyer, Budowoski, 1993).
Ehrenamtliche Arbeit kann, in Lebensphasen die von Unsicherheit oder Krisen geprägt sind, auch als Instrument auf der Suche nach einer biographischen Orientierung dienen.
Die Tauschkomponente
Die ehrenamtliche Arbeit wurde als Arbeitsleistung ohne unmittelbares monetäres Entgelt definiert. Dennoch können Ehrenamtliche für ihre Arbeit eine Art Gegenleistung erhalten, so dass in die ehrenamtliche Arbeit ein Tauschverhalten hinein interpretiert werden kann. Tausch liegt dann vor, wenn die Gegenleistung unmittelbar vom Leistungsempfänger ausgeht.
Beispiele für Gegenleistungen können sein: Information und Einfluss, Mitwirkungs- und Mitentscheidungsmöglichkeiten (Mitarbeit in einem Elternverein der Schule der eigenen Kinder).
Der Erwerb beruflicher Qualifikationen stellt eine besondere Form der Gegenleistung dar, die meist nicht vom Leistungsempfänger, sondern vom Dienstgeber der Ehrenamtlichen oder der Organisation ausgeht. Ehrenamtliche Arbeit kann dann auch Investitionscharakter haben.
In bestimmten Biographiemustern findet sich eine besondere Mischung von Tausch- und Eigenwertkomponente. So gibt es regelrechte Karrieren von Ehrenamtlichen in politischen Parteien oder Kirchen, die hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Betreffenden den traditionellen Karrieren im Erwerbsleben nicht nachstehen.
Formen der ehrenamtlichen Arbeit
Laienarbeit und professionelle Arbeit
Es ist die Qualität des Arbeitsinhaltes, die eine Arbeitsleistung in professionell oder laienhaft unterscheidet. Um eine professionelle Arbeitsleistung zu erbringen ist in der Regel eine bestimmte Ausbildung nötig. Viele ehrenamtliche Tätigkeiten können jedoch auch von Laien erbracht werden, die für diese Tätigkeit keinerlei spezifische Vorkenntnisse besitzen.
Es ist falsch, Ehrenamt mit Laienarbeit und professionelle Arbeit mit bezahlter Arbeit gleichzusetzen, weil in manchen Fällen ehrenamtliche Arbeit von Professionellen und Laienarbeit gegen Bezahlung geleistet wird. Ein Beispiel für den ersten Fall ist der/die Rechtsanwalt/in, der/die seine/ihre Fachkenntnisse einer Umweltschutzorganisation unentgeltlich zur Verfügung stellt. StudentInnen, die stunden- oder tageweise gegen Bezahlung Hilfsdienste beim Krankentransport leisten sind Beispiele für den zweiten Fall.
Eigen- oder Fremdbedarf
Ehrenamtliche Arbeit kann der Befriedigung eines kollektiven Eigenbedürfnisses dienen, wenn z. B. ein Mitglied eines Ortsverschönerungsvereines, das unentgeltlich an der Begrünung des Hauptplatzes seines Dorfes mitwirkt. (Man spricht in diesen Fällen auch von Selbsthilfeaktivitäten).
Fremdbedarf besteht, wenn ehrenamtliche Arbeit zur Erstellung von Leistungen durchgeführt wird, die primär von Dritten in Anspruch genommen wird, wie z. B. bei ehrenamtlicher Arbeit für den Rettungsdienst des Roten Kreuzes.
Leitende oder ausführende Tätigkeit
Es gibt Organisationen, die durch eine personelle Doppelstruktur zwischen Angestellten und ehrenamtlichen FunktionärInnen gekennzeichnet sind. Dies ist in der Regel bei Interessenvertretungen, oder darüber hinaus bei größeren NPOs, die Fremdleistungen erbringen, der Fall. Die formellen Leitungsorgane solcher Organisationen sind ehrenamtliche FunktionärInnen, die sich bei der Ausübung ihrer Geschäfte angestellter MitarbeiterInnen bedienen. Das Maß, in dem solche ehrenamtlichen Führungspersonen tatsächlich einen bestimmenden Einfluß ausüben, oder eher von den angestellten MitarbeiterInnen dominiert werden, schwankt beträchtlich zwischen den verschiedenen Organisationen.
Während diese Ehrenamtlichen an der Spitze der formellen Hierarchie stehen, gibt es andererseits auch Ehrenamtliche, die ausschließlich am untersten Ende der betrieblichen Hierarchie arbeiten. Nicht selten stehen sie in einer eigenen Hierarchie der ehrenamtlichen Arbeit.
Hauptberufliche oder nebenberufliche ehrenamtliche Tätigkeit
Die oben beschriebene Definition legt das Bild nahe, dass ehrenamtliche Arbeit grundsätzlich in der Freizeit ausgeübt wird und daher meist nebenberuflichen Charakter habe. Dies ist bei der größten Zahl der Ehrenamtlichen tatsächlich der Fall, wenn einige Stunden pro Woche unentgeltliche Mitarbeit geleistet wird.
Es gibt jedoch auch Menschen, die ihre ehrenamtliche Arbeit so extensiv betreiben, dass diese im Hinblick auf die eingesetzte Arbeitszeit und die dabei gebundene Energie einer hauptberuflichen Tätigkeit gleichkommt. In solchen Fällen muss die wirtschaftliche Absicherung aus anderen Quellen erfolgen. Beispiele hierfür sind Pensionisten, oft nach einer langen bezahlten Tätigkeit in einer Managementposition, oder Hausfrauen, deren Kinder keine ständige Betreuung mehr benötigen.
„Alte“ und „neue“ Ehrenamtliche
Den „alten“ Ehrenamtlichen werden tendenziell eher altruistische Motive wie Hilfsbereitschaft, der Wille zur Mitverantwortung, Glaube, oder moralische Verpflichtung zugeschrieben. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie in sozialen oder weltanschaulichen Milieus verwurzelt sind und ihre personellen Ressourcen langfristig und verbindlich ihrer Organisation zur Verfügung stellen.
Den „neuen“ Ehrenamtlichen dagegen werden eher egoistische Motive zugeordnet. Sie wollen stärker in ihrer persönlichen oder auch beruflichen Kompetenz gefragt werden. Sie wollen ihre Erfahrungen nutzen – als Gegenwelt oder Kompensation der beruflichen Erfahrungswelt. Sie wollen etwas bewegen. Sie betrachten ihr freiwilliges Engagement als Selbstverwirklichung, Selbsterfahrung und Sinnsuche. Sie zeichnen sich darüber hinaus dadurch aus, dass sie sich nicht mehr über einen längeren Zeitraum an eine Organisation binden wollen, sondern sie stellen eher begrenzte zeitliche Ressourcen für Tätigkeiten zur Verfügung, für die sie sich augenblicklich interessieren und die ein positives Image haben.
Ehrenamtliche Arbeit innerhalb und außerhalb von NPOs
Das gesellschaftliche Phänomen „ehrenamtliche Arbeit“ geht über die Tätigkeit in NPOs weit hinaus. Ein beträchtlicher Teil der ehrenamtlichen Arbeit wird außerhalb von Organisationen geleistet, nämlich im informellen Feld der soziokulturellen Infrastruktur (Familien, Nachbarn, Freunden).
NPOs haben gegenüber gewinnorientierten Unternehmen oder staatlichen Einrichtungen den Vorteil, für Ehrenamtliche viel attraktiver zu sein. In gewinnorientierten Unternehmen baut die ehrenamtliche Person meist auf spezifische Erwartungen, wie etwa dem Erwerb von beruflicher Erfahrung oder die Hoffnung, zu einem späteren Zeitpunkt bessere Chancen auf einen bezahlten Arbeitsplatz zu haben ( z. B. Volontäre in einer Zeitungsredaktion; Gastärzte in Spezialkliniken etc.). Im öffentlichen Sektor, insbesondere in den Kommunalverwaltungen, existieren zahlreiche Versuche, durch Bewusstmachen der gesellschaftlichen Relevanz und der persönlichen Vorteile, die durch ehrenamtliche Arbeit entstehen können, Personen für die Mitarbeit bei kommunalen Anliegen zu gewinnen.
Freiwilliges Engagement als Ressource
Die Zahl der Organisationen, die auf ehrenamtliche MitarbeiterInnen angewiesen sind, um ihre Arbeit leisten zu können, wird angesichts der immer knapper werdenden Zuschüsse und Entgelte immer größer.
In einer Zeit, in der sich immer mehr gemeinnützige Organisationen um Anteile um einen Spendenkuchen, der sich in den letzten Jahren nicht wesentlich vergrößert hat, bemühen und versuchen, Geldquellen wie Sponsoring, Erbschaften etc. nutzbar zu machen, hält man Ausschau nach neuen Ressourcen. Die Potentiale für freiwilliges Engagement in der BRD sind verschiedenen Umfragen zufolge noch nicht ausgeschöpft.
Wie die „Eurovol“ – Studie ergab, liegt Deutschland mit einem Anteil von 16% der Bevölkerung, die sich freiwillig engagieren, an drittletzter Stelle im Vergleich von 8 europäischen Ländern. Nur in Bulgarien (14%) und der Slowakei (11%) sind die Anteile geringer. An der Spitze liegen die Niederlande (34%) und Schweden (32%), d. h. Staaten, die über Jahrzehnte hinweg für ihren hohen Standard an Sozialleistungen bekannt sind.
Die Differenz zum Anteil derer, die potenziell zu einem freiwilligen Engagement bereit sind, ist hoch. So ergab eine Umfrage, die Ende 1996 im Rahmen des John Hopkins Comperative Nonprofit Sector Project durchgeführt wurde, dass nur jeder vierte Bundesbürger freiwilliges Engagement kategorisch ablehnt. Andererseits ist ein etwa genauso hoher Anteil vorbehaltlos bereit, ehrenamtlich tätig zu werden.
Bei der Betrachtung einzelner Bereiche, in denen freiwilliges Engagement möglich ist, zeigte sich eine starke Zurückhaltung bei der Bereitschaft zur Mitarbeit in politischen und religiösen Fragen. Dagegen lehnte nur jede/r zweite Befragte ein Engagement in Kultur, Sport und Umwelt-, Tier-, und Naturschutz ab, und nur 40% sprachen sich gegen ein Engagement im sozialen gemeinnützigen Bereich aus. An erster Stelle der Gründe für eine Nichtbeteiligung stand – wie bei anderen Untersuchungen auch – dass man nicht persönlich gefragt oder gebeten worden ist.
Die Akquisition von Ehrenamtlichen
In jeder Organisation, in der ehrenamtliche Arbeit eine wichtige Rolle spielt, stellt sich zunächst die Frage, wie Ehrenamtliche für die Mitarbeit gewonnen werden können. Voraussetzung für eine erfolgreiche Akquisition von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen ist es, klare Perspektiven aufzuzeigen, die den jeweiligen Motiven entgegenkommen. Gemeinnützige Organisationen müssten die Gewinnung von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen als eine Aufgabe des Personalmarketings betrachten.
Ein Sonderproblem liegt in der Akquisition geeigneter Persönlichkeiten für Leitungsfunktionen in großen Organisationen. Eine solche Persönlichkeit muss eine Vielzahl von Qualifikationen besitzen und zu einem großen Zeitgeschenk entschlossen sein. Es geht um die Kombination von fachlichen Qualitäten, Kontaktfähigkeit, Repräsentanzfähigkeit und –bereitschaft nach außen, und nicht zuletzt um gute persönliche Verbindungen zum öffentlichen Leben.
Unterstützung und Förderung freiwilligen Engagements zeigen in der BRD erhebliche Defizite und es gibt fast keine unterstützende Infrastruktur für die Vermittlung, Beratung, und Begleitung Ehrenamtlicher.
Entwicklungsstand in den Niederlanden
In vielen europäischen Nachbarländern gibt es Systeme von Freiwilligenzentren. In Holland gibt es ein Nationales Freiwilligenzentrum, das von der Regierung finanziell unterstützt wird. Es ist verantwortlich für die landesweite Öffentlichkeitsarbeit zum Themenkomplex „Freiwilligenarbeit“, organisiert Kongresse und Fortbildungen, ist Informationsstelle für gemeinnützige Verbände und das Zentrum für etwa 120 lokale Freiwilligenzentren, die ihrerseits die direkte Anlaufstelle für potenzielle ehrenamtliche MitarbeiterInnen sind. Dem Nationalen Freiwilligenzentrum sind etwa 45 landesweit tätige gemeinnützige Verbände angeschlossen. Dazu gehören Verbände aus dem Sozialbereich ebenso wie solche aus den Bereichen Sport, Umwelt und Kultur. Durch diese Kooperationen kommt es zu einer Ressourcenbündelung.
Entwicklungsstand in der Bundesrepublik Deutschland
Hierzulande agieren zwar seit einiger Zeit politische Parteien und Organisationen des Dritten Sektors in dieser Richtung, jedoch nicht miteinander. Bis 1995 gab es gerade einmal eine gute Handvoll von Freiwilligenagenturen. Die Entwicklung führt zu der absurden Situation, dass in manchen Städten mindestens zwei Freiwilligenzentren in unterschiedlicher Trägerschaft existieren, während es flächendeckend nach wie vor kein Netz gibt.
Im Jahre 1997 wurde auf Initiative der damaligen Bundesministerin Claudia Nolte die privatrechtliche Stiftung „Bürger für Bürger“ gegründet. Diese Stiftung soll in Berlin eine nationale Freiwilligenagentur einrichten, die sich als bundesweite Ansprechpartnerin für die traditionellen Verbände, die lokalen und regionalen Freiwilligenagenturen und zugleich als Angebot an alle an ehrenamtlicher Arbeit interessierten BürgerInnen verstehen soll. Zur Mitarbeit eingeladen wurden alle Familien-, Senioren-, Frauen-, und Jugendverbände sowie die Träger ehrenamtlicher Arbeit im sozialen, sportlichen, kulturellen, ökologischen und politischen Bereich.
Daneben und fast zeitgleich richtete die staatsunabhängige Aktion Gemeinsinn e. V. eine Arbeitsstelle „Bürgerschaftliche Initiativen – freiwilliges Engagement – Ehrenamt“ ein, finanziert von der Robert-Bosch-Stiftung und der Heinz-Nixdorf-Stiftung.
Rahmenbedingungen der Politik
Bürgerengagenemt im Ehrenamt und in der Freiwilligenarbeit gerät in Deutschland umso mehr in die Diskussion, je ungewisser die Zukunft des Sozialstaates wird. Dass Bürgerengagement jedoch eine Lückenbüßerfunktion in Bereichen einnehmen soll, die nicht mehr finanzierbar erscheinen, sollte nicht geschehen. Vielmehr sollte eine Verbesserung der Rahmenbedingungen und eine bessere gesellschaftliche Anerkennung für die ehrenamtliche Arbeit angestrebt werden.
Vorschläge hierzu wären z. B. im finanziellen Bereich die Aufwandsentschädigung, damit Freiwillige, die Zeit und Engagement investieren nicht gezwungen werden auch noch Geld mitzubringen. Weiterhin könnte man eine steuerliche Anerkennung, eine Anrechnung des freiwilligen Engagements auf die Rente oder die Übernahme der Arbeitnehmerbeiträge zur Pflegeversicherung in Betracht ziehen.
Vorschläge im immateriellen Bereich könnten z. B. bessere Möglichkeiten zur Qualifizierung und Weiterbildung freiwilliger MitarbeiterInnen, der Vermerk der ehrenamtlichen Arbeit auf Zeugnissen, und einer Verbesserung der Rahmenbedingungen von ehrenamtlicher Arbeit von Arbeitslosen sein.
Alternative Unterstützungsmöglichkeiten
Freiwilligen-Zentralen müssen nicht der einzige Weg sein, um die große Differenz zwischen der Zahl derjenigen, die grundsätzlich zu einem Engagement bereit sind, und den tatsächlich Aktiven, zu überbrücken. Es gab in den letzten Jahren eine Reihe von Modellprojekten, die zum Teil zielgruppenbezogen ehrenamtliche MitarbeiterInnen für verschiedene Bereiche gewonnen haben. Dabei wurden auch Sonderformen des freiwilligen Engagements entwickelt, die auf dem Prinzip von Leistung und Gegenleistung beruhen. Zur Verdeutlichung hier einige Beispiele:
- Ein Modellprojekt war von 1992 bis 1996 die Seniorenbüros der Bundesregierung, die das Ziel hatten, Anlaufstellen für ältere Menschen zu schaffen und Möglichkeiten zum nachberuflichen Engagement im sozialen und anderen Bereichen anzubieten und zu vermitteln.
- Die Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Wirtschaft steht im Mittelpunkt des Modellprojektes „Wechsel/Wirkung“, das im Herbst 1997 in Schleswig-Holstein gestartet ist. Im Rahmen dieses Projektes sollen Beschäftigte aus Profit- und Non-Profit-Unternehmen für eine befristete Zeit im jeweils anderen Milieu lernen und ihren eigenen spezifischen Erfahrungs- und Wissensschatz einbringen. Durch die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und sozialen Organisationen sollen Partnerschaften gebildet und „Wechsel/Wirkung“ als Bestandteil von Personalentwicklungskonzepten für ManagerInnen gesehen werden. Durch den direkten Kontakt beider Bereiche sollen neue Kommunikationsformen entstehen, sowie Schnittstellen und verbesserte Möglichkeiten der Zusammenarbeit geschaffen werden. Vorbild dieses Projektes ist das Projekt „Seiten-Wechsel“, das seit 1994 in der Schweiz durchgeführt wird und in dem sich soziale Organisationen den Unternehmen aus der Wirtschaft als attraktive Lernfelder präsentieren.
- In Großbritannien nehmen seit Beginn der 90er Jahre 500 der 1000 größten Unternehmen an Projekten teil, die auf ihre Einbindung in die Gesellschaft in Form einer dauerhaften Zusammenarbeit mit Freiwilligenprojekten zielen.
Die Projekte gehen davon aus, dass Engagement in gesellschaftlichen Fragen sich zum Vorteil aller auswirken kann, und knüpfen an das zunehmende Interesse der Wirtschaft – auch in Deutschland - zu diesen Fragen an. Konzepte, dieses Interesse konstruktiv für die eigenen Interessen zu nutzen, müssen im Sozialbereich erst noch entwickelt werden.
Ausblick
Insgesamt ist zu erwarten, dass die Akquisition, Unterstützung und Begleitung freiwilliger MitarbeiterInnen in Deutschland in den nächsten Jahren professionalisiert werden wird. Ob damit die Potentiale zum freiwilligen Engagement wirklich genutzt werden können und wie groß die Chancen für neue Formen der Bürgerbeteiligung sind, wird sich erst zeigen, wenn die Möglichkeiten zur Entfaltung von Eigeninitiative verbessert worden sind. Um in der BRD eine Kultur zu entwickeln, in der freiwilliges Engagement ein hohes gesellschaftliches Ansehen genießt, sind eine Reihe von Voraussetzungen sowohl im Wertebewusstsein der BürgerInnen als auch in der Politik, erforderlich, die erst noch erfüllt werden müssen.
Ehrenamt als Managementaufgabe
Integration und Begleitung ehrenamtlicher Mitarbeiter ist eine Aufgabe der Personalentwicklung. Diese Aufgabe ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal des Managements gemeinnütziger Organisationen gegenüber dem Management in der gewerblichen Wirtschaft. Non-Profit-ManagerInnen müssen zwei unterschiedliche Mitarbeitergruppen führen: Haupt- und Ehrenamtliche.
Im alltäglichen Arbeitseinsatz zeigt sich der besondere Charakter des ehrenamtlichen Personals auf vielfache Weise. Probleme ergeben sich vor allem bei den Auswirkungen auf die Leistungsqualität und in der Abstimmung der ehrenamtlichen Arbeit mit bezahlten Arbeitskräften.
Zusammenhang zwischen Ehrenamtlichkeit und Leistungsqualität
Negativ auf die Leistungsqualität kann sich ehrenamtliche Arbeit dann auswirken, wenn man der Versuchung erliegt, aus Kostengründen Arbeiten durch Ehrenamtliche Verrichten zu lassen, die von ihren Inhalten oder vom erforderlichen Zeitaufwand her professionelle Arbeit verlangen. Um Probleme in dieser Richtung zu vermeiden, müssen im Vorfeld einige Dinge im bezug auf die ehrenamtliche Arbeit innerbetrieblich geklärt sein.
Verfügbarkeit des ehrenamtlichen Personals
Sie kann sich nicht nur an den Wünschen der/des Ehrenamtlichen orientieren, sondern ist auch mit den Notwendigkeiten des Arbeitseinsatzes und den Bedürfnissen der LeistungsempfängerInnen abzustimmen.
Verlässlichkeit des ehrenamtlichen Personals
Sie stellt sich nicht nur als Frage der Zeiteinteilung, sondern bezieht sich auch auf Intensität und Art des Arbeitseinsatzes. Hohes Engagement kann dazu führen, dass Ehrenamtliche in einem Ausmaß zur Verfügung stehen, das bezahlte Arbeitskräfte auch bei Überstunden nicht leisten könnten oder wollten. Eine juristische Verpflichtung, wie sie das Arbeitsrecht vorsieht, gibt es aber nicht. An die Stelle dieser Verpflichtung kann sozialer Druck mit all seinen Unbestimmtheiten treten.
Selbstausbeutung
Die oft unbegrenzt scheinende Verfügbarkeit von ehrenamtlichem Personal hat auch Schattenseiten. Sie kann zur Selbstausbeutung werden, die langfristig die körperliche und seelische Gesundheit zu gefährden vermag. Darüber hinaus gibt es Konstellationen, wo großzügige Verfügbarkeit fachlich kontraproduktiv und daher problematisch ist; eine Einsicht, die aber meist nur von Menschen mit entsprechendem Fachwissen gewonnen werden kann.
Juristische Probleme
Schließlich ist mit dem regelmäßigen Einsatz ehrenamtlicher Arbeitskräfte die Notwendigkeit verbunden, eine Reihe von juristischen Problemen zu klären, die vor allem im Arbeits- und Sozialrecht, aber auch bei Haftungsvorschriften angesiedelt sind.
Abstimmungsprobleme zwischen ehrenamtlicher und bezahlter Arbeit
In den meisten NPOs wirken sich ehrenamtliche und bezahlte MitarbeiterInnen in irgendeiner Form zusammen. Die Probleme zwischen ehrenamtlichen FunktionärInnen und angestellten MitarbeiterInnen (z. Bsp. einer/einem Generalsekretär/in) sind sehr vielschichtig, können aber in den meisten Fällen auf Macht und Informationsprobleme zurückgeführt werden. Die juristisch definierte Hierarchie setzt die/den ehrenamtlichen FunktionärInnen in der Regel an die Spitze der NPO. Insbesondere dann, wenn ein/e Funktionär/in ihre/seine Tätigkeit in der NPO nur am Rande ihres/seines beruflichen und privaten Lebensspektrums ausübt, kann durch den Informationsvorspung und die fachliche Detailkenntnis auf seiten angestellter MitarbeiterInnen eine Umkehrung der realen Hierarchie entstehen, was entsprechende Konfliktpotentiale mit sich bringt.
Stehen in einer größeren NPO ganze Hierarchien von ehrenamtlichen FunktionärInnen und angestellten MitarbeiterInnen parallel nebeneinander, kommt es zu einer Verkomplizierung der Situation.
In einer anderen Art komplex zeigen sich die Probleme der Zusammenarbeit zwischen ehrenamtlichen und bezahlten MitarbeiterInnen auf der Ebene der ausführenden Tätigkeiten. Einerseits existiert auch hier ein beachtliches Konfliktpotential hinter dem wechselseitige Geringschätzung und Konkurrenzängste – vor allem auf seiten der bezahlten MitarbeiterInnen – stehen könnten.
Andererseits gibt es viele Formen der Koordination oder Kooperation zwischen beiden Gruppen, die ein gedeihliches Zusammenwirken ermöglichen, die Arbeitssituation beider verbessern und die Leitungsqualität positiv beeinflussen können. Die Organisation solcher Formen der Zusammenarbeit ist eine wichtige Managementfunktion, wobei es in der Praxis meist um Regelung und Kooperation zwischen Laien und Professionellen geht.
Werte der ehrenamtlichen Arbeit
Ehrenamtliche Produzieren Werte, die in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) meist nicht erfasst werden.
Produktionswert der ehrenamtlichen Arbeit
Fast jeder kennt in seinem Alltagsleben Einzelbeispiele für gespendete Arbeit. Den Gesamtwert zu messen ist jedoch ein schwieriges wirtschaftstheoretisches und –statisches Problem. Die Konvention der VGR und die des Alltagslebens binden den „Wert“ einer Leistung meist an Geld, der besonders deutlich wird, wenn das Produkt verkauft wird. Fehlt ein solcher Güterpreis, bietet der für den Arbeitseinsatz ausbezahlte Lohn noch eine gewisse Orientierungshife.
Um nun die unentgeltlich erbrachte Arbeitsleistung mit anderen wirtschaftlichen Leistungen zu vergleichen, muß eine Bewertung mit monetären Größen konstruiert werden. Dazu benutzt man „Marktpreise“ (Preis für den Einkauf einer Leistung) oder Opportunitätskosten“ (fiktiver Lohn der/des Ehrenamtlichen). Ermittelt man den Produktionswert der ehrenamtlichen Arbeit durch die Multiplikation der ehrenamtlichen Arbeitsstunden mit irgendwelchen Stundenlöhnen, erhält man zwar beeindruckende Größenordnungen, aber eine Vergleichbarkeit mit den üblichen wirtschaftsstatistischen Daten ist nur scheinbar gegeben.
Eine exakte Quantifizierung des Produktionswertes der ehrenamtlichen Arbeit ist nicht möglich und wäre auch nicht sinnvoll, weil sie in ihr fremden Kategorien beschrieben werden müsste.
Der Vergleich der Arbeitsvolumina von ehrenamtlicher Arbeit und bezahlter Arbeit erlaubt unter bestimmten Bedingungen Rückschlüsse auf die Produktionswerte. (Im Jahr 1994 entsprach das ehrenamtliche Arbeitsvolumen im Nonprofitbereich 680000 Vollzeitstellen im alten Bundesgebiet).
Die wirtschaftliche Relevanz kann dennoch eindeutig bejaht werden, wenn man bedenkt, dass im Nonprofit Sektor auf je zwei Beschäftigte ein/e ehrenamtlich Tätige/r kommt. Ebenfalls sehr deutlich wird die wirtschaftliche und politische Relevanz bei der aktuellen Diskussion um die Abschaffung der Wehrpflicht und die damit verbundene Abschaffung des Zivildienstes.
Einsparungen durch ehrenamtliche Arbeit
Die Renaissance der ehrenamtliche Arbeit in der politischen Diskussion beruht in Zeiten knapper öffentlicher Budgets und zunehmender Privatisierungswünsche auf der Hoffnung, durch den verstärkten Einsatz ehrenamtlichen Personals Einsparungen für den Staat zu erzielen und dadurch die Kürzung öffentlicher Sozialbudgets zu ermöglichen oder leichter verkraftbar zu machen.
In der vereinfachenden Sichtweise der staatlichen Finanzpolitik besteht diese Hoffnung zu Recht. Wenn bisher bezahlte Leistungen durch Ehrenamtliche erbracht werden, müssen weniger Ausgaben getätigt werden. Darum spielen NPOs in einer solchen Strategie eine entscheidende Rolle, haben sie doch gute Möglichkeiten, Arbeiten an Ehrenamtliche zu übertragen und damit „billiger“ zu produzieren als staatliche Anbieter, denen kaum ehrenamtliches Personal zu Verfügung steht.
Gesellschaftspolitische Grundwerte
Den Sichtweisen der ehrenamtlichen Arbeit liegen aus unterschiedlichen politischen Richtungen und aus verschiedenen sachlichen Gründen die ganze Palette von der Idealisierung bis zur strikten Ablehnung zugrunde. Einerseits stehen Ideale wie Bürgerautonomie, Unabhängigkeit, Freiheit, Solidarität, Identität etc. im Vordergrund, andererseits gibt es Vorwürfe der gesellschaftlichen Ausgrenzung, des Missbrauchs durch den Staat oder die Wirtschaft, der Frauenfeindlichkeit und des Konservatismus.
Die Schwierigkeiten in der Akzeptanz gesellschaftspolitischer Werte im Ehrenamt gehen mit der Schwierigkeit des Begriffes für das Phänomen der freiwilligen Arbeitsleistung Hand in Hand. Der Ausdruck „Ehrenamt“ stand in der Preußischen Städteordnung von 1808 für ein „Amt“ im Sinne der Ausübung öffentlicher Gewalt. Dieser Begriff wurde bis heute unverändert übernommen, nicht aber die dahinterstehenden gesellschaftspolitischen Konzepte. Der Begriff „Ehrenamt“ lässt sich nicht eindeutig definieren. Selbst die damit landläufig verbundene „Unentgeltlichkeit“ ist kein eindeutiges Kriterium, und das Wort „Freiwilligenarbeit“ ist durch sein Gegenstück, die „Zwangsarbeit“, belastet.
Vielleicht sollte man einfach einen neuen Begriff dafür erfinden, um, darauf aufbauend, den Freiwilligen eine neues Selbstverständnis zu geben.
Die Werte des Ehrenamtes wurden und werden von den „namenlosen“ Aktivisten bis heute durch Taten demonstriert.
Anhang:
Einige statistische Daten über die ehrenamtliche Arbeit
- Es gibt ca. 12 Millionen ehrenamtlich Tätige in Deutschland. Das entspricht etwa 17% der Bevölkerung.
- Der größte Bereich des ehrenamtlichen Engagements ist der Sportbereich, gefolgt vom Gesundheitsbereich und Bürgerinitiativen. In der freien Wohlfahrtspflege ist ein deutlicher Rückgang des Engagements zu vermerken.
- 10% der Ehrenamtlichen im Sport- und Politikbereich erhalten eine Aufwandsentschädigung.
- Geschlechterverteilung im Ehrenamt: 33% Frauen und 66% Männer engagieren sich im ehrenamtlich. Im sozialen Bereich engagieren sich jedoch 55% der Frauen (größtenteils im einfachen Bereich) und 45% der Männer (hauptsächlich im leitenden Bereich).
- Die größte Gruppe nach Altersstruktur liegt bei den 35 bis 44jährigen mit 46.4 %.
- Schulbildung:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- Ehrenamtliche mit durchschnittlichem Bildungsniveau sind hauptsächlich im Sport- und öffentlichen Bereich tätig. Mittleres bis hohes Bildungsniveau sind vorwiegend in Jugendverbänden und Ehrenamtliche mit sehr hohem Bildungsniveau sind vermehrt in Bürgerinitiativen zu finden.
- Mehr als 50% der ehrenamtlich Tätigen leben in Mehrpersonenhaushalten.
- Die Konfessionszugehörigkeit spielt keine Rolle.
- Die meisten Ehrenamtlichen sind FDP-Wähler (56%), an zweiter Stelle kommen CDU/CSU-Wähler (47%) gefolgt von Bündnis 90 und SPD.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeitskraftspende
Was ist ehrenamtliche Arbeit laut diesem Text?
Ehrenamtliche Arbeit ist eine Arbeitsleistung, der kein monetärer Gegenfluss gegenüber steht. Sie wird manchmal auch als "Freiwilligenarbeit" bezeichnet, aber dieser Begriff kann missverständlich sein.
Welche Motive für ehrenamtliche Arbeit werden im Text genannt?
Der Text nennt drei Hauptmotive: altruistische Komponente (Hilfe für andere oder die Gemeinschaft), Eigenwertkomponente (Nutzen für den Ehrenamtlichen selbst, z.B. soziale Integration oder persönliche Zufriedenheit), und Tauschkomponente (Gegenleistungen vom Leistungsempfänger, z.B. Information, Einfluss oder berufliche Qualifikationen).
Welche Formen der ehrenamtlichen Arbeit werden unterschieden?
Der Text unterscheidet zwischen Laienarbeit und professioneller Arbeit, Eigen- oder Fremdbedarf, leitender oder ausführender Tätigkeit, hauptberuflicher oder nebenberuflicher ehrenamtlicher Tätigkeit, "alten" und "neuen" Ehrenamtlichen, und ehrenamtlicher Arbeit innerhalb und außerhalb von NPOs (Non-Profit-Organisationen).
Was sagt der Text über freiwilliges Engagement als Ressource?
Der Text betont, dass freiwilliges Engagement eine wichtige Ressource ist, insbesondere angesichts knapper werdender Zuschüsse für gemeinnützige Organisationen. Deutschland hat im Vergleich zu anderen europäischen Ländern noch unausgeschöpfte Potentiale in diesem Bereich.
Wie funktioniert die Akquisition von Ehrenamtlichen laut dem Text?
Die Akquisition von Ehrenamtlichen erfordert klare Perspektiven, die den jeweiligen Motiven entgegenkommen. Gemeinnützige Organisationen sollten dies als Aufgabe des Personalmarketings betrachten. Es gibt Defizite in der Unterstützung und Förderung freiwilligen Engagements in Deutschland. In anderen Ländern gibt es bessere Strukturen wie Freiwilligenzentren.
Welche Rahmenbedingungen der Politik werden im Kontext von Ehrenamtlichkeit diskutiert?
Es wird betont, dass Bürgerengagement keine Lückenbüßerfunktion einnehmen sollte, sondern dass eine Verbesserung der Rahmenbedingungen und eine bessere gesellschaftliche Anerkennung für die ehrenamtliche Arbeit angestrebt werden sollte. Dazu gehören finanzielle Anreize wie Aufwandsentschädigungen und steuerliche Anerkennung, sowie immaterielle Anreize wie Qualifizierungsmöglichkeiten und Anerkennung auf Zeugnissen.
Was sind Beispiele für alternative Unterstützungsmöglichkeiten im Bereich des Ehrenamts?
Der Text nennt Beispiele wie Seniorenbüros, das Modellprojekt "Wechsel/Wirkung" (Zusammenarbeit zwischen Profit- und Non-Profit-Unternehmen) und Initiativen, die Unternehmen in die Zusammenarbeit mit Freiwilligenprojekten einbinden.
Wie wird Ehrenamt als Managementaufgabe beschrieben?
Integration und Begleitung ehrenamtlicher Mitarbeiter ist eine Aufgabe der Personalentwicklung und ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal des Managements gemeinnütziger Organisationen. Es gibt Herausforderungen in Bezug auf die Leistungsqualität (Verfügbarkeit, Verlässlichkeit, Selbstausbeutung, juristische Probleme) und die Abstimmung zwischen ehrenamtlicher und bezahlter Arbeit.
Welche Werte der ehrenamtlichen Arbeit werden genannt?
Ehrenamtliche Arbeit produziert Werte, die oft nicht in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung erfasst werden. Es werden der Produktionswert, Einsparungen durch ehrenamtliche Arbeit und gesellschaftspolitische Grundwerte diskutiert. Es gibt unterschiedliche Sichtweisen, von Idealisierung bis zur strikten Ablehnung.
Welche statistischen Daten über ehrenamtliche Arbeit werden im Anhang erwähnt?
Der Anhang enthält statistische Daten über die Anzahl der ehrenamtlich Tätigen in Deutschland (ca. 12 Millionen), die Bereiche des Engagements (Sport, Gesundheit, Bürgerinitiativen), Aufwandsentschädigungen, Geschlechterverteilung, Altersstruktur, Schulbildung und weitere soziodemografische Merkmale.
- Quote paper
- Marlene Felbinger (Author), 2000, Die Arbeitskraftspende, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108394