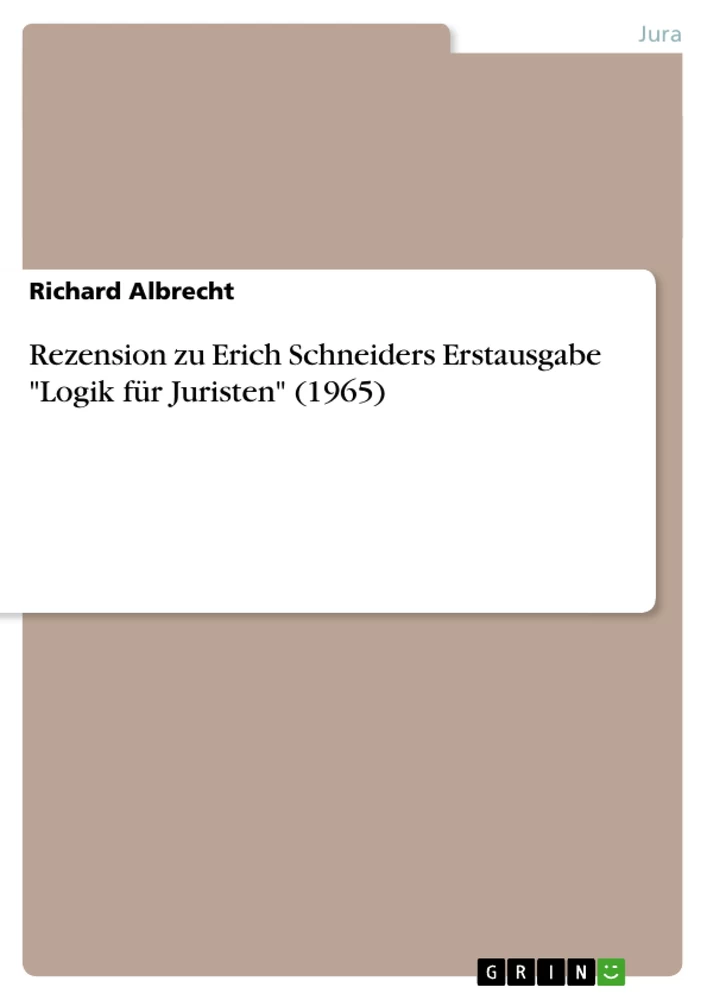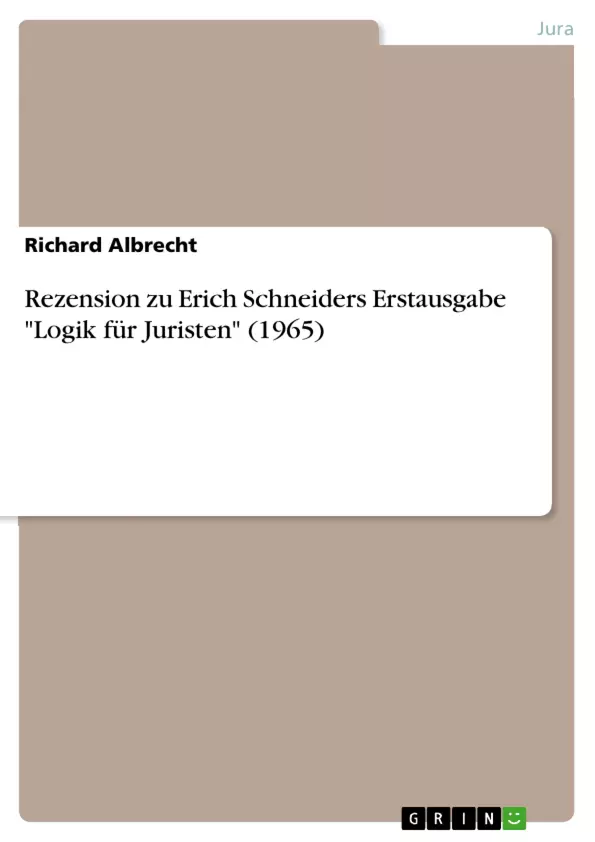Können Juristen wirklich bis drei zählen? Diese provokante Frage ist der Ausgangspunkt für Egon Schneiders "Logik für Juristen", einem Werk, das sich der essenziellen Bedeutung formaler Logik im juristischen Denken widmet. Jenseits trockener Theorie entfaltet sich ein leidenschaftliches Plädoyer für Klarheit und Präzision in der Rechtsanwendung. Schneider, ein erfahrener Jurist und streitbarer Publizist, führt den Leser durch die Grundlagen des Justizsyllogismus und deckt dabei Denkfehler auf, die in der juristischen Argumentation lauern. Das Buch ist jedoch mehr als nur eine Einführung in die formale Logik; es ist eine Aufforderung zur kritischen Reflexion über die Grundlagen richterlicher Entscheidungsfindung. Es geht um die unbedingte Notwendigkeit, Urteile auf Rechtssätze zu stützen und diese aus dem Gesetz zu begründen, um Rechtsbeugung zu vermeiden. "Logik für Juristen" erweist sich als intellektuelles Werkzeug, das Juristen befähigt, Voraussetzungen zu prüfen, Mittel- und Untersätze zu analysieren und somit zu einer fundierten und nachvollziehbaren Urteilsfindung zu gelangen. Dabei betont Schneider stets die Grenzen der Logik: Sie kann weder Wahrheitsprüfung noch Normbegründung ersetzen, sondern dient primär der Aufdeckung von Denkfehlern. Diese Fähigkeit, Fehler zu erkennen und zu vermeiden, ist jedoch von unschätzbarem Wert für jeden Juristen, der sich einer integren und rechtsstaatlichen Praxis verpflichtet fühlt. Schneiders Überlegungen, obwohl nicht immer "herrschende Meinung", bieten eine wichtige Denkanstösse, die auch heute noch relevant sind, wie die Berufung deutscher Obergerichte auf seine Arbeiten zeigt. Das Buch ist somit nicht nur eine Einführung in die juristische Logik, sondern auch ein Beitrag zur Rechtskritik und zur Förderung einer verantwortungsvollen Rechtsprechung, ein unverzichtbarer Begleiter für Studenten, Referendare und praktizierende Juristen, die ihr Handwerkszeug schärfen und ihre Argumentation auf eine solide Grundlage stellen wollen. Es schlägt eine Brücke zwischen formaler Logik und praktischer Rechtsanwendung und regt dazu an, tradierte Denkmuster zu hinterfragen und neue Perspektiven einzunehmen, ein Kompass im Dickicht juristischer Argumentation, der hilft, den Kurs der Wahrheit und Gerechtigkeit nicht zu verlieren.
Logik für Juristen
Rezension von Dr.rer.pol.habil.Richard Albrecht (Bad Münstereifel)
Für Rechtswissenschaft als theoretische Jurisprudenz könnte Ulrich Klugs "Juristische Logik" bedeutsam gewesen sein1. Für praktische Ausbildung/en hätte Egon Schneiders "Logik für Juristen"2 wichtig sein können.
Egon Schneider, ehemaliger Kölner Oberlandesgerichter, danach Rechtsanwalt und streitbarer Fachpublizist ("Justizspiegel")3, inzwischen hochbetagt und nicht mehr aktiv, führt in die formale Logik und den basalen Justizsyllogismus des Barbaraprinzips ein: a-a-a, nämlich logische Ableitung eines Urteils aus zwei anderen Urteilen, die durch einen gemeinsamen Mittelbegriff verbunden sind. Woraus, logisch, folgt: Auch Juristen (künftig die -innen immer eingeschlossen) müssen, wie Wissenschaftler, die diesen Namen verdienen, mindestens bis Drei zählen können; dies ist die unumgängliche Voraussetzung ("conditio sine qua non").
Schneider nennt auch die Grenzen seiner Darstellung: Logik ist intellektuell-analytisches Hilfsmittel (etwa vergleichbar der Quellenkritik im Rahmen Historischer Hilfswissenschaften im Zusammenhang mit Geschichtswissenschaft). Nicht mehr. Nicht weniger. Logik kann weder Wahrheitsprüfung/en noch Normbegründung/en ersetzen. Sondern ("nur") Denkfehler aufdecken.
Insofern ist auch für Juristen Logik als analytisch-intellektuelles "Handwerkszeug" fürs Denken unerlässlich.
Versucht man, wie folgend, Schneiders Kernaussagen herauszuarbeiten, dann sind für jedwede "Logik für Juristen" zentral: Prüfung/en der Voraussetzungen ("Grundirrtum") und des Mittel- und Untersatzes zwischen Voraussetzung und Folge einerseits und das Aufdecken von Denkfehlern durch gründliches Lesen (z.B. von Gerichtsentscheiden) andererseits, genauer: Ein logisch tragfähiger Schluss ist nur dann als "Mittel der Erkenntnis" brauchbar, wenn die "Konklusion aus wahren Prämissen folgerichtig abgeleitet wird."
Und: "Eine - an sich mögliche und sinnvolle - kritische Überprüfung lohnt in der Regel nicht, wenn die Begründungsweise erkennen lässt, dass nicht ehrlich argumentiert wird."
Für richterliche Rechtsprechung, wenn sie denn nicht "Rechtsbeugung durch Rechtsprechung" (Günter Sprendel) sein soll, gelten zwei zentrale Voraussetzungen: i) "Der Richter muss sich für jede Entscheidung, die er fällt, auf einen Rechtssatz berufen"; und ii) "Alle Entscheidungen sind aus dem Gesetz zu begründen"
Entscheidend ist für Schneider die richterliche Entscheidungsbegründung. Fehlen diese Gründe, dann gilt:
"Nach unseren logischen Überlegungen [...] reicht die Möglichkeit aus, dass das Urteil auf einer Gesetzesverletzung beruht" - und zwar immer dann, wenn die Berufung auf einen Rechtssatz und/oder die Begründung aus dem Gesetz fehlt.
Das sind dann jeweils materielle Rechtsverletzungen und im Sinne der Strafprozessordnung (§ 337) bzw. der Zivilprozessordnung (§ 548) Revisionsgründe, weil Rechtsnormen sei´s gar nicht sei´s falsch angewandt wurden: Denn wenn weder Rechtssätze noch Begründungen im richterlichen Entscheid mitgeteilt werden, kann - logischerweise - nicht überprüft werden, ob Gerichtsentscheide rechtsnormenkonform sind oder nicht.
Schneiders Überlegungen sind in praxi nicht konkret-juristische h.M. (hier nicht: His/Her Majesty, sondern herrschende Meinung oder ´mainstraim´). Sie stellen jedoch eine wichtige Denkposition dar. Deshalb fand ich´s wichtig, dass sich deutsche Obergerichter des Bundesgerichtshofs noch 2001 auf diesen Autor beriefen als es um Grenzen des NS-Rechtsberatungsgesetzes ging4...
Im forschungslogischen Zusammenhang sozialwissenschaftlicher Hermeneutik sind Egon Schneiders Hinweise in seinem derzeit in 5. Auflage vorliegendem Lehrbuch "Logik für Juristen"5 eingängig und kompatibel etwa mit Überlegungen zur kulturwissenschaftlich-gedankenexperimentellen Methode (C.Wright Mills6 ), des historisch möglichen Bewusstseins (Lucien Goldmann7 ) und des ´utopischen Paradigma´ in der empirischen Sozialforschung (Richard Albrecht8 ).
[...]
1 Ulrich Klug, Juristische Logik; Springer-Verlag; Berlin etc. 1958, 2. verbesserte Auflage, 164 p.
2 Egon Schneider, Logik für Juristen. Die Grundlage der Denklehre und der Rechtsanwendung; Verlag Franz Vahlen; Berlin-Frankfurt/Main 1965, XIII/397 p.; - das dort erwähnte Lehrbuch des Autors: "Rechtswissenschaft - eine Einführung in das Studium" (1963) konnte ich bisher übers NRW-Fernausleihsystem nicht bekommen
3 einige justizkritische Texte Schneiders sind online wiederveröffentlicht: "http://www.gabnet.com"
4 BHG III ZR 172/00 vom 26.7.2001 mit Bezug auf einen Aufsatz Schneiders von 1976
5 letzterschienen ist die 5., neubearbeitete und erweiterte Auflage (München: Franz Vahlen, 1999, XV/300 p.)
6 C. Wright Mills, The Sociological Imagination; Grove Press, N.Y. 1961², pp. 195-226
7 Lucien Goldmann, Kultur in der Mediengesellschaft; S.Fischer, Ffm. 1973, pp.7-18
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Rezension "Logik für Juristen"?
Die Rezension von Dr. Richard Albrecht behandelt Egon Schneiders Buch "Logik für Juristen" und dessen Bedeutung für die juristische Ausbildung und Theorie. Es wird untersucht, wie formale Logik und der Justizsyllogismus (Barbaraprinzip) im juristischen Denken angewendet werden können.
Was sind die Kernaussagen von Egon Schneider zur "Logik für Juristen"?
Schneider betont, dass Logik ein intellektuell-analytisches Hilfsmittel ist, ähnlich der Quellenkritik in der Geschichtswissenschaft. Sie dient dazu, Denkfehler aufzudecken, kann aber weder Wahrheitsprüfungen noch Normbegründungen ersetzen. Wichtige Aspekte sind die Prüfung der Voraussetzungen und des Mittel- und Untersatzes sowie das Aufdecken von Denkfehlern durch sorgfältiges Lesen von Gerichtsentscheiden.
Welche Bedeutung hat die richterliche Entscheidungsbegründung laut Schneider?
Die richterliche Entscheidungsbegründung ist für Schneider entscheidend. Fehlen Gründe für eine richterliche Entscheidung, kann dies als materielle Rechtsverletzung und Revisionsgrund gewertet werden, da die Überprüfung der Rechtsnormenkonformität unmöglich wird.
Welche Voraussetzungen müssen für richterliche Rechtsprechung gelten, um "Rechtsbeugung durch Rechtsprechung" zu vermeiden?
Zwei zentrale Voraussetzungen sind: Der Richter muss sich für jede Entscheidung auf einen Rechtssatz berufen, und alle Entscheidungen müssen aus dem Gesetz begründet werden.
In welchem Verhältnis stehen Schneiders Überlegungen zur herrschenden Meinung (h.M.)?
Schneiders Überlegungen entsprechen nicht der konkret-juristischen herrschenden Meinung, stellen aber eine wichtige Denkposition dar, auf die sich sogar das Bundesgerichtshof berufen hat.
Wie passen Schneiders Hinweise in den forschungslogischen Zusammenhang sozialwissenschaftlicher Hermeneutik?
Schneiders Hinweise sind eingängig und kompatibel mit Überlegungen zur kulturwissenschaftlich-gedankenexperimentellen Methode, des historisch möglichen Bewusstseins und des ´utopischen Paradigma´ in der empirischen Sozialforschung.
Welche anderen Werke werden in der Rezension erwähnt und in welchen Kontexten?
Ulrich Klugs "Juristische Logik" wird als bedeutsam für die theoretische Jurisprudenz genannt. C. Wright Mills' "The Sociological Imagination", Lucien Goldmanns "Kultur in der Mediengesellschaft", und Richard Albrechts "The Utopian Paradigm" werden im Zusammenhang mit sozialwissenschaftlicher Hermeneutik erwähnt.
- Quote paper
- Dr. Richard Albrecht (Author), 2003, Rezension zu Erich Schneiders Erstausgabe "Logik für Juristen" (1965), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108403