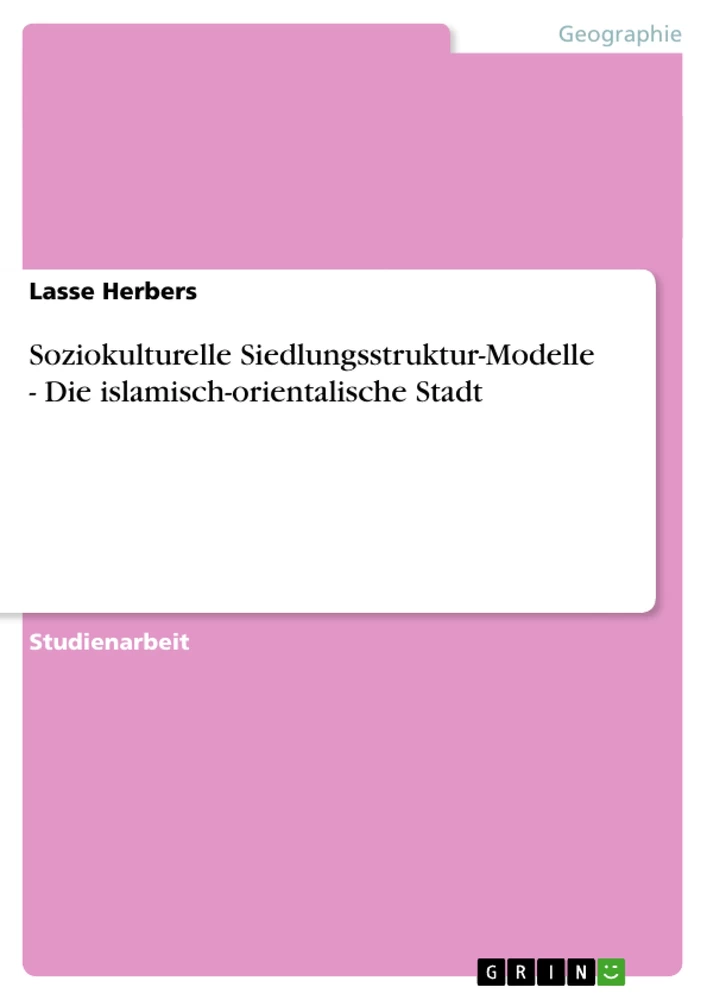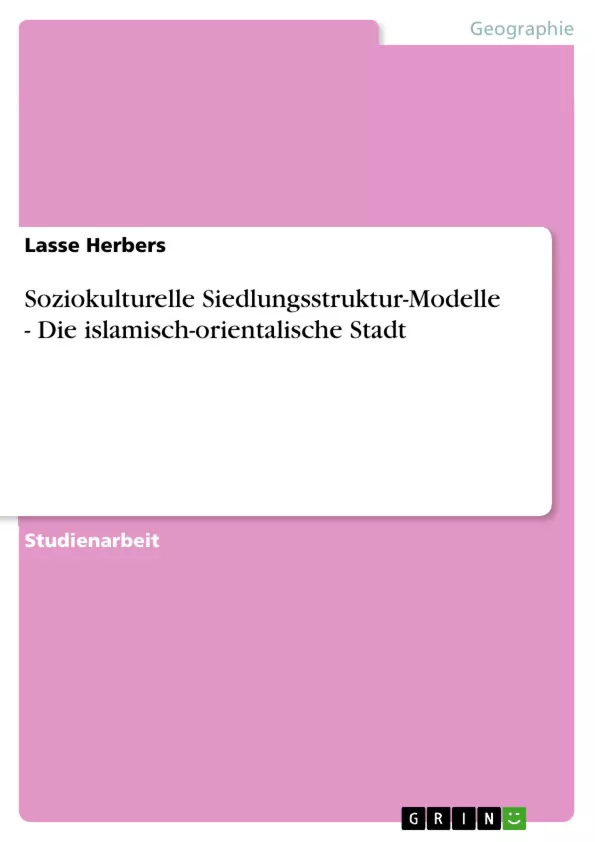Soziokulturelle oder auch historisch-genetische Stadtmodelle sind Darstellungs- und Erklärungsansätze für verschiedenartige Ausprägungen kultureller Einflüsse auf die Stadtentwicklung. ,,Dem kulturgenetischen Konzept liegt die Auffassung zugrunde, dass die von der einzelnen Kultur her gegebnen Voraussetzungen und Ausgangspositionen für die allgemein ähnlich verlaufenden Urbanisierungsprozesse (...) in jedem Kulturraum andere sind".1
Demnach entwickelt jeder Kulturraum eigene ihm spezielle Stadttypen.
,,Grundsätzlich stehen kulturhistorische Stadttypen im Zusammenhang mit den Entwicklungsstufen von Gesellschaft, Wirtschaft und politischen Organisationsformen."2
Für die orientalischen Städte ist besonders der Islam prägend, deswegen sprechen wir von der islamisch-orientalischen Stadt. ,,Der Islam beinhaltet nicht nur eine Religion, sondern eine ganz eigengeartete, in sich geschlossene Kultur und Lebensform"3
In einigen wissenschaftlichen Arbeiten wird nicht der Islam, sondern die vor-islamische Zeit als besonders orientalisch prägend benannt (Hofmeister), der Basar, arabisch Suq, aber gilt als eindeutig islamische Entwicklung (Wirth).
Es gibt weltweit noch viele andere große islamische Städte, die aber nicht orientalisch
geprägt und entwickelt sind (Bsp: Indonesien, Nigeria).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Entwicklung
- Der Islam als städtische Religion
- Grundmerkmale
- Altstadt
- Basar
- Neustadt
- Viertel der Wohnbevölkerung, Segregation
- funktionale Trennung
- asymmetrisches Straßensystem, Privatsphäre
- Erschließungs- und Sammelstraßen
- Durchgangsachsen und Verkehrsleitlinien
- Wohngassen und Anlieferwege
- Privatsphäre
- Rentenkapitalismus
- Verwestlichung/ moderner Wandel
- Altstadt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht soziokulturelle Siedlungsstruktur-Modelle, insbesondere die islamisch-orientalische Stadt. Ziel ist es, die charakteristischen Merkmale dieser Stadtform zu beschreiben und deren Entwicklung im historischen Kontext zu erläutern. Der Fokus liegt auf den kulturellen Einflüssen des Islam auf die Stadtplanung und -struktur.
- Der Einfluss des Islam auf die Entwicklung der orientalischen Stadt
- Die charakteristischen Merkmale der Altstadt (Medina) und ihre funktionale Organisation
- Die Rolle des Basars als wirtschaftliches und soziales Zentrum
- Das Prinzip der Segregation und die räumliche Trennung von Wohn- und Arbeitsbereichen
- Der Wandel der traditionellen Strukturen durch Verwestlichung und Modernisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der soziokulturellen Stadtmodelle ein und erklärt den Fokus auf die islamisch-orientalische Stadt. Sie hebt die Bedeutung des Islam als prägenden Faktor für die Stadtentwicklung hervor und differenziert zwischen orientalischen und anderen islamischen Städten. Es wird der kulturgenetische Ansatz erläutert, der davon ausgeht, dass verschiedene Kulturen unterschiedliche Stadttypen hervorbringen.
Historische Entwicklung: Dieses Kapitel beschreibt die historische Entwicklung der islamisch-orientalischen Stadt, beginnend mit der neolithischen Revolution und der Entstehung der ersten Städte im Vorderen Orient. Es beleuchtet den Einfluss von griechischen und römischen Städten und deren Transformation unter islamischer Herrschaft. Der Wandel vom planvollen Schachbrettmuster zu einem organisch gewachsenen Straßensystem wird hervorgehoben, ebenso wie die Entwicklung der Neustadt während der Kolonialzeit und die Auswirkungen der Industrialisierung und Urbanisierung.
Der Islam als städtische Religion: Dieses Kapitel analysiert die tiefgreifenden Auswirkungen des Islam auf die Stadtstruktur. Es betont die städtische Ausrichtung der islamischen Riten und Gebräuche, wie das Freitagsgebet in der Moschee, die Bedeutung von Waschungen und Badehäusern und die Rolle des Ramadan-Fastens. Der Einfluss islamischen Rechts (Sharia) auf die Stadtplanung, insbesondere auf die Organisation des Basars, die Segregation der Wohnbevölkerung und die Einrichtung von religiösen Stiftungen, wird detailliert dargestellt. Die soziale Fürsorge und die Rolle religiöser Stiftungen im städtischen Leben werden hervorgehoben.
Grundmerkmale: Dieses Kapitel beschreibt die charakteristischen Merkmale der islamisch-orientalischen Stadt. Es konzentriert sich auf drei Bezugssysteme: den räumlichen Bezug von Arbeit und Wohnen, die Prinzipien der Segregation und das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit. Die Altstadt (Medina) mit ihrer zentralen Moschee und dem Basar wird detailliert erläutert, ebenso wie das asymmetrische Straßensystem, die Stadtmauern und die Lage von Zitadelle und Außenbereichen. Der Basar als wichtiges Abgrenzungskriterium zu westlichen Städten und seine wirtschaftliche Bedeutung werden hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Islamisch-orientalische Stadt, Soziokulturelle Siedlungsstrukturmodelle, Islam, Stadtentwicklung, Basar, Segregation, Medina, Altstadt, Neustadt, Moschee, Sharia, Verwestlichung, Modernisierung, historisch-genetische Stadtmodelle.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Islamisch-Orientalischen Stadt
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht soziokulturelle Siedlungsstruktur-Modelle, insbesondere die islamisch-orientalische Stadt. Sie beschreibt die charakteristischen Merkmale dieser Stadtform und deren Entwicklung im historischen Kontext, mit Fokus auf den kulturellen Einfluss des Islam auf Stadtplanung und -struktur.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Einfluss des Islam auf die Entwicklung der orientalischen Stadt, die charakteristischen Merkmale der Altstadt (Medina) und ihre funktionale Organisation, die Rolle des Basars, das Prinzip der Segregation, den Wandel traditioneller Strukturen durch Verwestlichung und Modernisierung sowie die historische Entwicklung von der neolithischen Revolution bis zur Gegenwart.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur historischen Entwicklung, ein Kapitel zum Islam als städtische Religion, und ein Kapitel zu den Grundmerkmalen der islamisch-orientalischen Stadt. Jedes Kapitel bietet detaillierte Informationen zu den jeweiligen Aspekten.
Wie wird die historische Entwicklung der islamisch-orientalischen Stadt dargestellt?
Die historische Entwicklung wird von der neolithischen Revolution und der Entstehung erster Städte im Vorderen Orient bis zur Kolonialzeit und den Auswirkungen der Industrialisierung und Urbanisierung nachgezeichnet. Der Wandel vom planvollen Schachbrettmuster zu einem organisch gewachsenen Straßensystem wird hervorgehoben.
Welche Rolle spielt der Islam in der Stadtstruktur?
Der Islam hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Stadtstruktur. Die Arbeit betont die städtische Ausrichtung islamischer Riten (Freitagsgebet, Waschungen), den Einfluss des islamischen Rechts (Sharia) auf Stadtplanung, die Organisation des Basars und die Segregation der Wohnbevölkerung. Die soziale Fürsorge und die Rolle religiöser Stiftungen werden ebenfalls hervorgehoben.
Welche Grundmerkmale der islamisch-orientalischen Stadt werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die Altstadt (Medina) mit zentraler Moschee und Basar, das asymmetrische Straßensystem, Stadtmauern, Zitadelle und Außenbereiche. Ein Schwerpunkt liegt auf dem räumlichen Bezug von Arbeit und Wohnen, den Prinzipien der Segregation und dem Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit. Der Basar als wichtiges Abgrenzungskriterium zu westlichen Städten wird detailliert erläutert.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für das Verständnis der Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Islamisch-orientalische Stadt, Soziokulturelle Siedlungsstrukturmodelle, Islam, Stadtentwicklung, Basar, Segregation, Medina, Altstadt, Neustadt, Moschee, Sharia, Verwestlichung, Modernisierung, historisch-genetische Stadtmodelle.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die charakteristischen Merkmale der islamisch-orientalischen Stadt zu beschreiben und deren Entwicklung im historischen Kontext zu erläutern, wobei der Fokus auf den kulturellen Einflüssen des Islam auf die Stadtplanung und -struktur liegt.
- Arbeit zitieren
- Lasse Herbers (Autor:in), 2003, Soziokulturelle Siedlungsstruktur-Modelle - Die islamisch-orientalische Stadt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108426