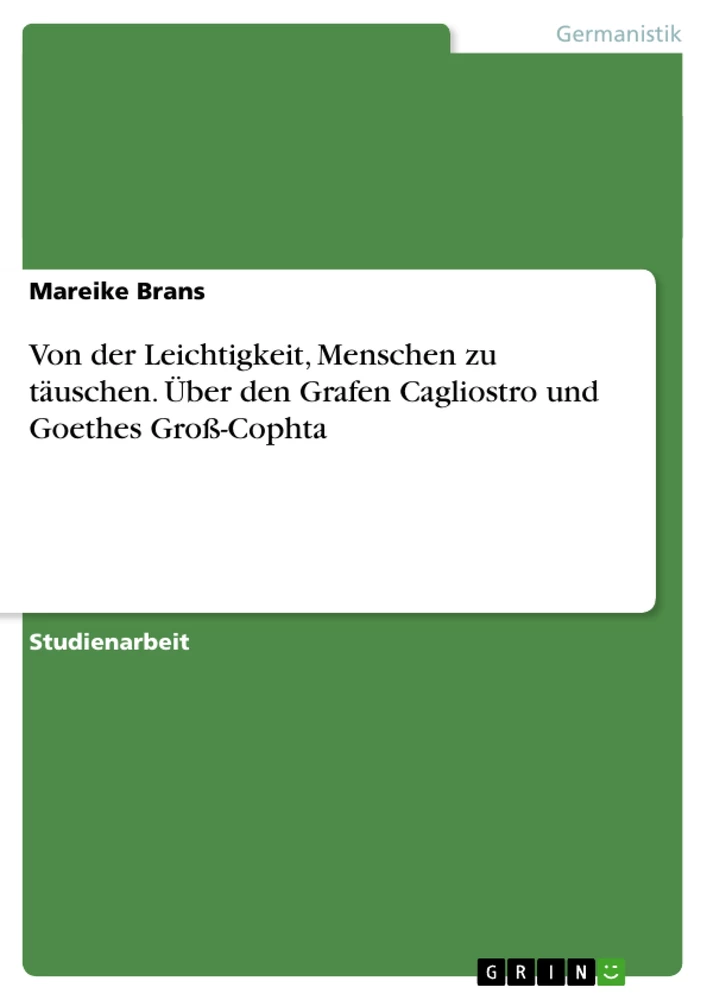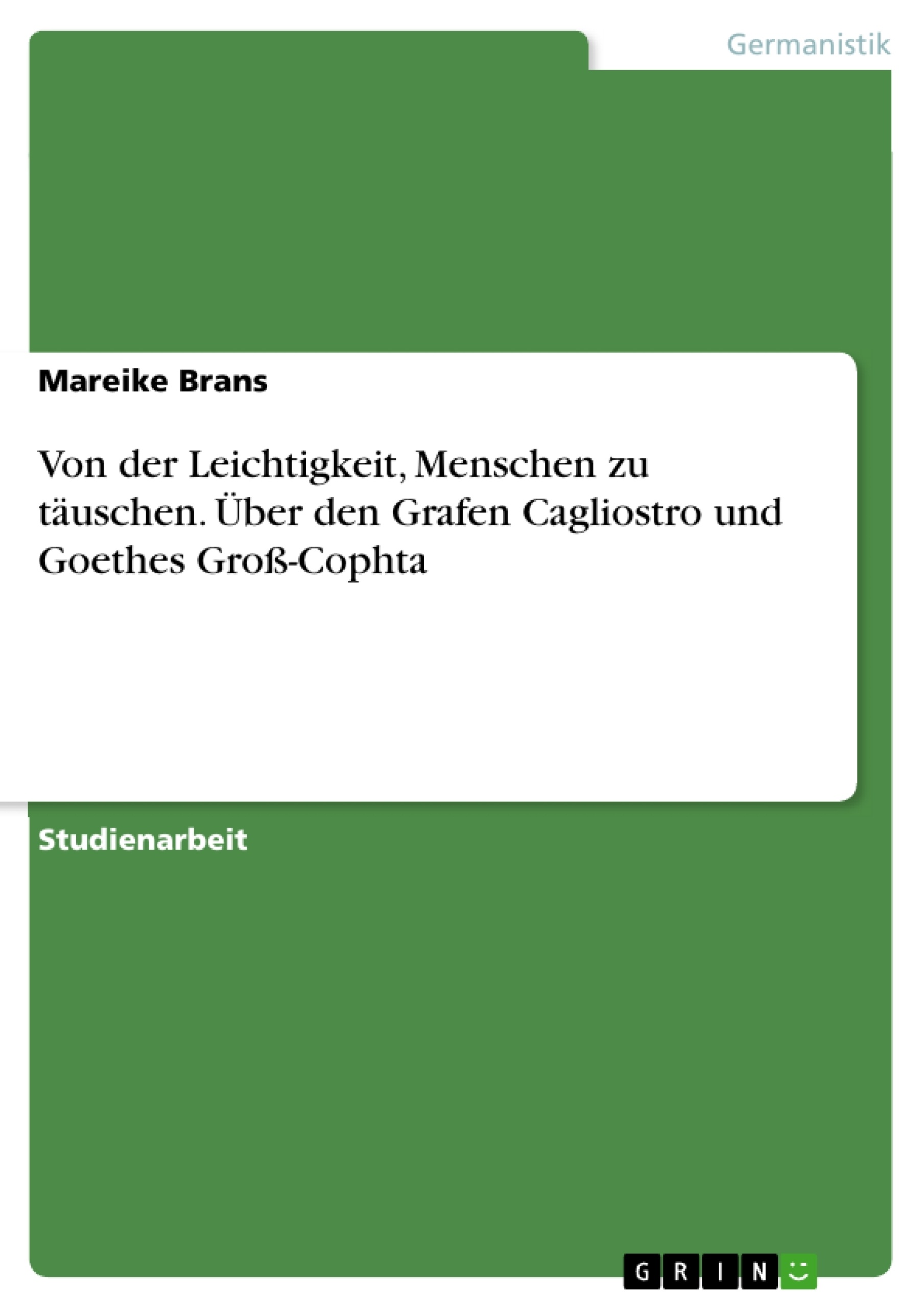Obwohl jeder Mensch, der sich für aufgeklärt hält, von sich behauptet, nicht an Wunder oder Geisterwesen zu glauben, geht von Dingen dieser Art doch seit jeher eine besondere Faszination aus. In den meisten Fällen geht es dabei um wissenschaftlich nicht erklär- oder beweisbare Phänomene, die der gesunde Menschenverstand als unmöglich bewertet. Bis in die heutige Zeit nutzen Menschen die Hoffnung auf solche Wunder, um Unerklärliches zu erklären, die Zukunft vorhersehen zu können oder an ein schwer erreichbares Ziel auf bequeme Weise zu gelangen. Dinge wie Parapsychologie oder außerirdisches Leben dienen zur Erklärung des Unerklärbaren; Esoterik, Astrologie und dergleichen sollen Hilfestellung für die zukünftige Lebensweise leisten; und angeblich wissenschaftlich bewiesene Wundermittel sollen bei Beschwerden wie Gewichtsproblemen behilflich sein.
Überall, wo Menschen aus Verzweiflung oder auch nur aus Bequemlichkeit offen für Wunder aller Art sind, ist der Weg bereitet für Scharlatane, die sich an diesem Glauben bereichern wollen. Deren Lohn ist neben materiellen Gütern oft auch Macht, gesellschaftliches Ansehen, Bewunderung und Dankbarkeit. So lange, bis ihr Betrug aufgedeckt wird - falls es dazu kommt.
Was sich bis heute gehalten hat, war auch schon im 18. Jahrhundert zu beobachten. Auch damals waren die Menschen nur allzu gern bereit, sich hinters Licht führen zu lassen. Der Kontakt mit einem verstorbenen Menschen, das Wissen um geheime Kenntnisse und Rezepte oder Wundermittel, durch die ewiges Leben oder unschätzbare Reichtümer zu erlangen waren, standen im Mittelpunkt des Interesses.
Ein Mann, der diese Bereitschaft der Menschen, sich täuschen zu lassen, auszunutzen wusste, war der Graf Cagliostro. Mit welchen Tricks und Scharlatanerien er die Leute an der Nase herumführte, und auch, wie Goethe, der von diesem Mann fasziniert war, sein Wirken literarisch aufarbeitete, soll in dieser Hausarbeit gezeigt werden. Es soll versucht werden zu erklären, woher die Bereitschaft der Menschen kam, Cagliostro auf den Leim zu gehen. Zusätzlich zu der näheren Betrachtung der von Goethe gezeichneten Personen und ihrer Motive werden Christoph Martin Wielands Thesen aus seinem Text ,,Über den Hang des Menschen an Magie und Geistererscheinungen zu glauben" herangezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Cagliostro: Ein Mann – zwei Lebensläufe
- Eine literarische Rezension Cagliostros - Goethes Groß-Cophta
- „Über den Hang der Menschen an Magie und Geistererscheinungen zu glauben“ - Warum die Menschen Cagliostro so gerne glaubten
- Abschlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Faszination um den Grafen Cagliostro im 18. Jahrhundert und Goethes literarische Auseinandersetzung mit dieser Figur. Ziel ist es, die Gründe für die große Glaubwürdigkeit Cagliostros bei seinen Zeitgenossen zu beleuchten und Wielands Thesen zum Hang der Menschen an Magie und Geistererscheinungen zu berücksichtigen.
- Cagliostros Lebenslügen und ihre Wirkung
- Die Rezeption Cagliostros in Goethes Werk "Groß-Cophta"
- Der Glaube an Wunder und übernatürliche Phänomene im 18. Jahrhundert
- Die Rolle von Scharlatanerie und Manipulation
- Analyse von Wielands Thesen zur Magiegläubigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der anhaltenden Faszination für das Übernatürliche ein, die auch im 18. Jahrhundert stark ausgeprägt war und von Scharlatanen ausgenutzt wurde. Sie stellt den Grafen Cagliostro als Beispiel vor und kündigt die Untersuchung seines Wirkens und Goethes literarischen Auseinandersetzung damit an. Die Arbeit zielt darauf ab, die Gründe für die Leichtgläubigkeit der Menschen gegenüber Cagliostro zu analysieren und dabei Wielands Thesen zu berücksichtigen.
Cagliostro: Ein Mann - zwei Lebensläufe: Dieses Kapitel beleuchtet die widersprüchlichen Lebensläufe Cagliostros. Es präsentiert die von Cagliostro selbst erfundene, sagenhafte Biografie, die seine angebliche Herkunft aus adeligem Geschlecht, seine Reisen nach Mekka und Ägypten, und seine Ausbildung in orientalischen Wissenschaften und Medizin beinhaltet. Im Kontrast dazu wird die tatsächliche Identität Cagliostros als Giuseppe Balsamo aus Palermo präsentiert, der im Kloster der Barmherzigen Brüder lebte und medizinische Kenntnisse erwarb. Der Vergleich dieser beiden Narrative verdeutlicht die Kunst der Selbstinszenierung und die Fähigkeit Cagliostros, eine unwahrscheinliche Identität zu konstruieren und aufrechtzuerhalten, um sein Publikum zu beeindrucken und zu manipulieren. Die Diskrepanz zwischen der erfundenen und der tatsächlichen Biografie unterstreicht die Bedeutung der Fiktion und Manipulation in Cagliostros Wirken.
Schlüsselwörter
Graf Cagliostro, Giuseppe Balsamo, Magie, Geistererscheinungen, Aufklärung, Scharlatanerie, Goethe, Groß-Cophta, Leichtgläubigkeit, 18. Jahrhundert, Christoph Martin Wieland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: "Graf Cagliostro und seine Rezeption im 18. Jahrhundert"
Was ist das Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Faszination um den Grafen Cagliostro im 18. Jahrhundert und die literarische Auseinandersetzung Goethes mit dieser Figur. Im Mittelpunkt steht die Frage, warum Cagliostro bei seinen Zeitgenossen so glaubwürdig war.
Welche Aspekte werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit beleuchtet Cagliostros widersprüchliche Lebensläufe, seine Selbstinszenierung als Magier, die Rezeption seiner Figur in Goethes Werk "Groß-Cophta", den Glauben an Wunder und übernatürliche Phänomene im 18. Jahrhundert, die Rolle von Scharlatanerie und Manipulation und analysiert Wielands Thesen zur Magiegläubigkeit.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit enthält eine Einleitung, ein Kapitel über Cagliostros Leben (mit zwei gegensätzlichen Biografien), ein Kapitel zur literarischen Rezension in Goethes "Groß-Cophta", ein Kapitel zu den Gründen für den Glauben an Cagliostro (unter Berücksichtigung von Wielands Thesen) und eine Abschlussbetrachtung. Zusätzlich gibt es ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Rolle spielt Goethe in der Hausarbeit?
Goethes literarische Auseinandersetzung mit der Figur Cagliostro in seinem Werk "Groß-Cophta" wird analysiert, um die Rezeption Cagliostros in der Literatur des 18. Jahrhunderts zu beleuchten.
Welche Bedeutung hat Christoph Martin Wieland für die Hausarbeit?
Wielands Thesen zum Hang der Menschen an Magie und Geistererscheinungen werden berücksichtigt, um die Leichtgläubigkeit gegenüber Cagliostro zu erklären und zu analysieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Graf Cagliostro, Giuseppe Balsamo, Magie, Geistererscheinungen, Aufklärung, Scharlatanerie, Goethe, Groß-Cophta, Leichtgläubigkeit, 18. Jahrhundert, Christoph Martin Wieland.
Was ist das Ziel der Hausarbeit?
Das Ziel ist es, die Gründe für die große Glaubwürdigkeit Cagliostros bei seinen Zeitgenossen zu beleuchten und Wielands Thesen zum Hang der Menschen an Magie und Geistererscheinungen zu berücksichtigen.
Welche Quellen werden in der Hausarbeit verwendet? (Diese Frage kann nur beantwortet werden, wenn die Hausarbeit die Quellenangaben enthält)
Diese Information fehlt im bereitgestellten HTML-Code. Die Quellenangaben sind nicht enthalten.
- Quote paper
- Mareike Brans (Author), 2003, Von der Leichtigkeit, Menschen zu täuschen. Über den Grafen Cagliostro und Goethes Groß-Cophta, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108443