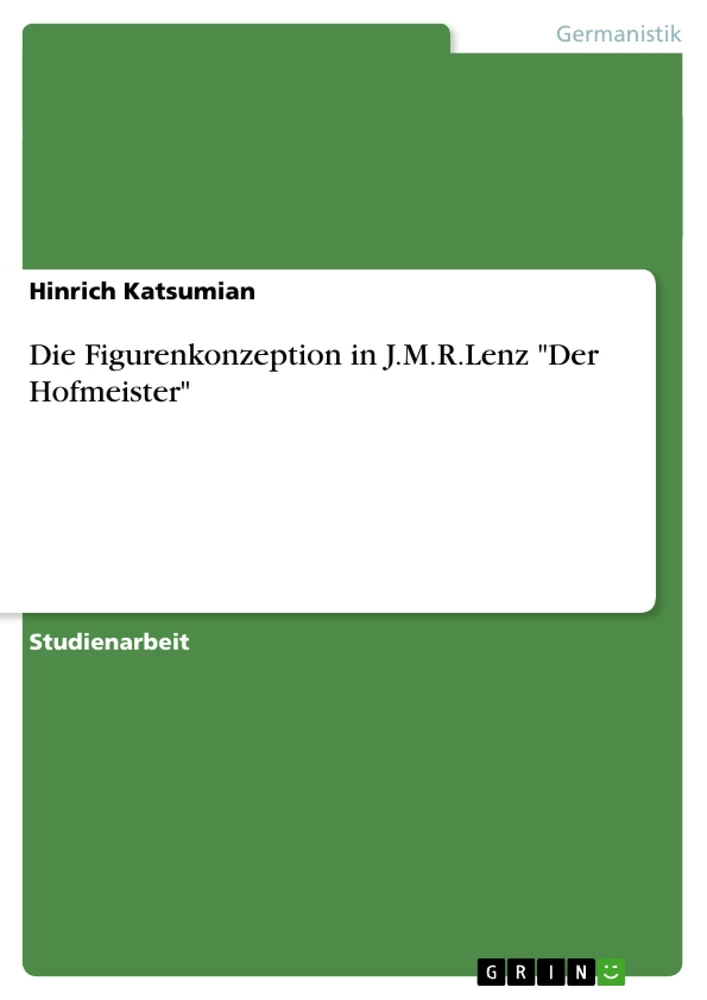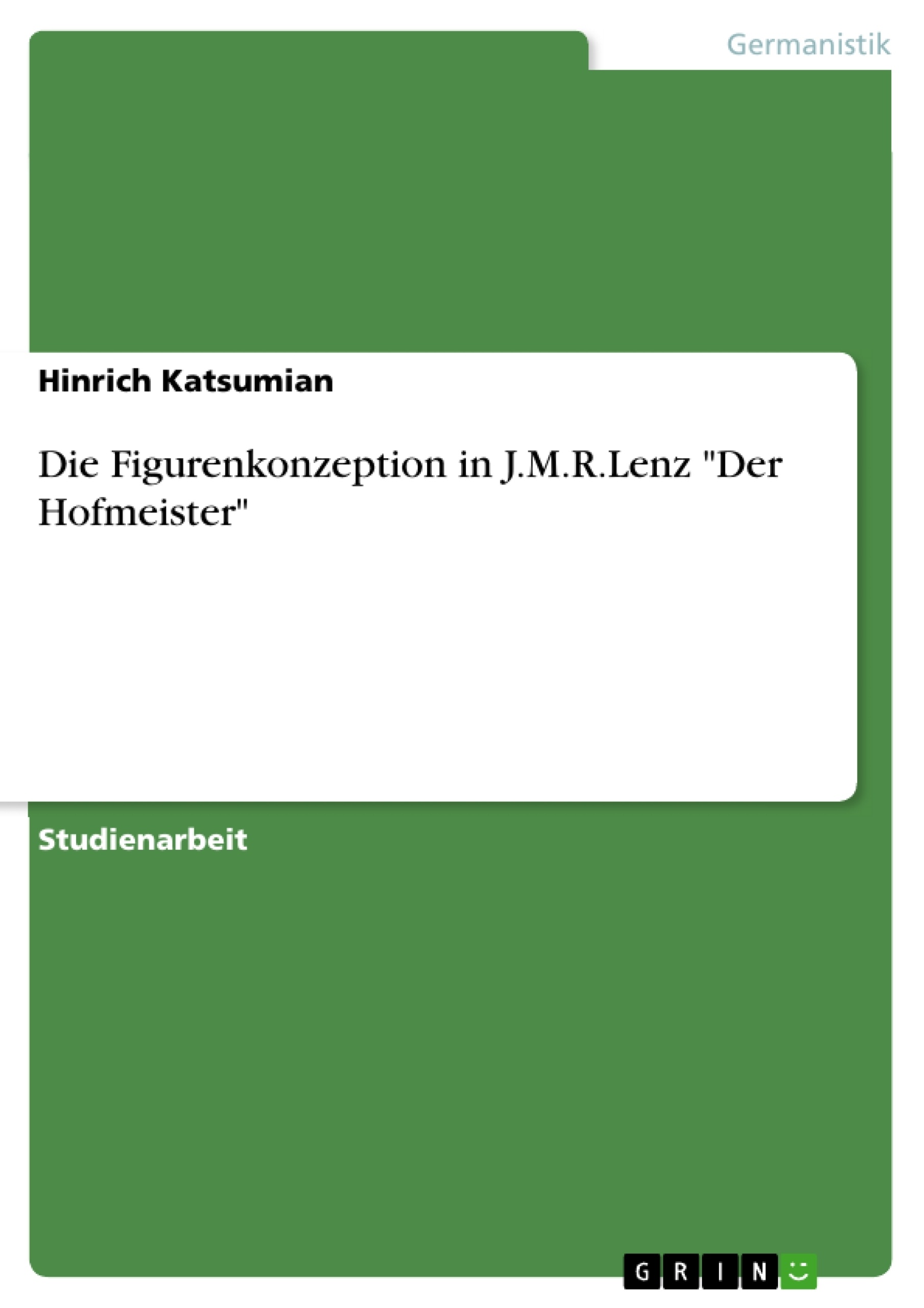Was wäre, wenn die Helden des Sturm und Drang nicht die strahlenden Figuren wären, die wir zu kennen glauben? Jakob Michael Reinhold Lenz' "Der Hofmeister oder die Vortheile der Privaterziehung" dekonstruiert auf beunruhigende Weise das idealisierte Menschenbild seiner Zeit und entführt uns in eine Welt, in der Arroganz, Machtmissbrauch und bürgerliche Hybris an der Tagesordnung sind. Diese messerscharfe Analyse der Ständegesellschaft seziert die Figuren bis ins kleinste Detail, entlarvt ihre Schwächen und Widersprüche und präsentiert ein verstörend realistisches Spiegelbild des 18. Jahrhunderts. Anders als in heroischen Dramen sucht man hier vergebens nach strahlenden Helden; stattdessen begegnen wir einer Galerie von Antihelden, deren Handlungen von Eitelkeit, Ignoranz und dem unerbittlichen Kampf um soziale Anerkennung getrieben sind. Der "Hofmeister" ist keine bloße Komödie, sondern eine bitterböse Abrechnung mit den vermeintlichen Idealen der Aufklärung und ein erschütternder Beweis für die Unvereinbarkeit von Anspruch und Wirklichkeit. Dabei legt Lenz den Finger schonungslos auf die Wunden der Gesellschaft, indem er die Mechanismen der Machtentfaltung und die subtilen Formen der Demütigung offenlegt. Die Frage, die sich dem Leser unweigerlich aufdrängt, ist: Inwieweit sind wir selbst Teil dieses grotesken Spiels? Entdecken Sie ein Meisterwerk des Sturm und Drang, das keine einfachen Antworten liefert, sondern vielmehr zum kritischen Hinterfragen der eigenen Überzeugungen anregt. Tauchen Sie ein in die Welt von Läuffer, dem gepeinigten Hofmeister, der Majorin, der herrschsüchtigen Aristokratin, und Wenzeslaus, dem asketischen Schulmeister, und erleben Sie ein Theaterstück, das nichts beschönigt und die Abgründe der menschlichen Natur offenbart. "Der Hofmeister" ist eine unerbittliche Studie über die Unvollkommenheit des Menschen und die fragwürdigen Fundamente der Gesellschaft, die auch heute noch erschreckend aktuell ist. Ein Schlüsselwerk für alle, die sich für Literaturgeschichte, Gesellschaftskritik und die dunklen Seiten der menschlichen Natur interessieren. Lassen Sie sich von Lenz' unvergleichlicher Beobachtungsgabe und seinem ätzenden Humor fesseln und entdecken Sie ein Meisterwerk, das lange nach dem Lesen nachwirkt. Die Figurenkonstellation des Dramas spiegelt auf komplexe Weise die politischen und gesellschaftlichen Spannungen ihrer Zeit wider.
Inhaltsverzeichnis
01. Einleitung
02. Ziele des Sturm und Drangs
03. Das Menschenbild des Sturm und Drang - die Helden im Drama
04. Exkurs: Die Helden bei Lenz
05. Exkurs: Machtdemonstrationen
06. Die Figuren
07. Läuffer
08. Der Adel
09. Wenzeslaus
10. Schluss
01. Einleitung
Mit dieser Hausarbeit will ich die Figuren im Drama "Der Hofmeister oder die Vortheile der Privaterziehung" von Jakob Michael Reinhold Lenz analysieren.
Die Figuren die Lenz in seinem ersten großen Drama gestaltet sind paradigmatisch für seine weiteren Stücke. Sie sind in der Bewegung des Sturm und Drangs einmalig und werden erst sehr viel später von der Literatur entdeckt. Um die Originalität der Personen im ”Hofmeister” zu unterstreichen, umreiße ich kurz die Intensionen der Aufklärer und das Menschenbild des Sturm und Drang.
Meiner Ansicht nach hat Lenz peinlich genau darauf geachtet, daß ihm keine der Figuren zu positiv und vollkommen gerät. Es gibt im ”Hofmeister” einen Mechanismus, welcher die Charaktere blamiert und bloßstellt. Ich möchte diese dramaturgische Konstruktion genauer betrachten. Lenz versucht nicht einen Helden auf die Bühne zu bringen, mit dem sich der Zuschauer identifizieren kann. Er vermeidet jede Illusion und erschafft stattdessen ein Szenario nah an der Wirklichkeit, die ihrerseits nicht frei von Idealhandlungen ist. Die von Lenz entwickelten Charaktere sind für den Sturm und Drang untypisch, obwohl er einer der führenden Köpfe der Bewegung war. Der Sturm und Drang schuf und propagierte den Kraftmenschen, doch in Lenz´ Stücken fehlt er. Die Machtstrukturen innerhalb der Gesellschaft spielen dabei eine besondere Rolle. Denn sie liefern die Begründung für die oft absurden Handlungen der Figuren. Im zweiten Teil der Arbeit will ich auf das Phänomen der Demontage des Figuren eingehen. Lenz entwickelt ein subtiles System zur Desavouierung der Protagonisten, um selbst den Bühnenexistenzen nicht zu viel Macht zu verleihen. Der Grund dafür ist meines Erachtens darin zu sehen, daß Lenz die Hybris der Menschen generell brechen wollte, d.h. die Arroganz des Adels und der überlebte Vernunftdogmatismus der Bürger. Aufgrund dieser Antagonismen schien es notwendig einen neuen gesellschaftlichen Kompromiß auszuhandeln Die Verständigung über einen solchen Kompromiß wurde aber verhindert durch ignorante Despoten. Diese saßen in beiden Parteien; im Adel und im Bürgertum.
02. Ziele des Sturm und Drangs
Die literarische Bewegung des Sturm und Drang war Teil der Aufklärung. Die sich formierenden Gruppen junger Autoren, waren ein deutlicher Aufbruch der neuen Generation, gegenüber etablierten aufklärerischen Autoren wie Gellert, Gottsched und Wieland. Doch das Schreiben und Handeln der Sturm und Drang Autoren basierte vollends auf dem Denken der Aufklärung. Die politischen Ziele der Aufklärer wurden vollständig beibehalten, aber in radikalisierter Form unmittelbar eingefordert. Die Sturm und Drang Autoren waren in keiner Weise revolutionär. Sie wollten das monarchische System nicht abschaffen, sondern modifizieren. Im absolutistischen Deutschland des 18. Jahrhunderts, eines im westeuropäischen Vergleich nicht nur kulturell rückständigen Landes, waren die aufklärerischen Gedanken sowohl in der bürgerlichen als auch in der adligen Oberschicht weit verbreitet, jedoch ohne das dieser Einfluß vom Landesherren nennenswert reflektiert wurde. 1730 erschien Gottscheds "Versuch einer Critischen Dichtkunst vor die Deutschen", 1741 bzw. 1744 die zweibändige Übersetzung des "Dictionnaire historique et critique" von Pierre Bayle, wiederum durch Gottsched. Ab 1751 begannen d´Alembert und Diderot die französiche Encyclopädie herauszugeben.
Man kann also davon ausgehen, daß die aufklärerischen Ideen spätestens mit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts fest im Diskurs des deutschen Geisteslebens verankert waren. Die ehemals umstürzlerischen Thesen des Bürgertums waren längst Tatsachen, d.h. etablierte Theorien, die empirisch belegt werden konnten. Der Mythos einer von Gott gesetzten Ständehierachie war unter einer derartigen Argumentationsmasse, wie sie die Encyclopädie darstellte, nicht aufrecht zu erhalten. Die Gesellschaft hatte längst begonnen, sich von der mittelalterlichen Stände- und Prestigegesellschaft zu einer Kapitalgesellschaft zu entwickeln.
Hinzu kamen die bedeutenden kulturellen Leistung und der generelle Aufschwung des Geisteslebens gerade der zweiten Jahrhunderthälfte. Das finanzielle Potential begann zum entscheidenden Maßstab der sozialen Stellung zu werden, während die unantastbare Aura des Adelstitels allmählich verblasste. Ein sozialer Aufstieg war zumindest für das Bürgertum möglich, d.h. es konnte sich überhaupt ein Großbürgertum entwickeln und so ein Gegenpol zum Adel entstehen. Friedrich Wilhelm I., der 1713 den preußischen Thron übernahm, war ein entschiedener Protegé des Manufakturwesens, also Förderer der frühkapitalistischen Produktionsweise.[1] Das Bürgertum wurde zur zweiten kapitalbesitzenden Klasse. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts existierte eine kleine, relativ selbstständige bürgerliche Oberschicht, die weitgehend unabhängig vom Adel ihr Leben gestaltete, sofern sie nicht an einer Assimilation in den Adel interessiert war. Trotz dieser Entwicklung gelang es jedoch dem etablierten Bürgertum nicht, in ernst zu nehmenden Maße Einfluß auf die Politik zu nehmen. Der affirmative Charakter der Aufklärung verhinderte ihre politische Durchsetzung. Das Vernunftdiktat unterband jede Form von Radikalität. Vernunft bedeutete in diesem Fall, grundsätzlich die Hegemonie des Adels anzuerkennen, ihn zu Zugeständnissen überreden und die offene Konfrontation zu vermeiden. Rechte vom Landesherren abbitten führte zu keinem Erfolg, da alle Argumente nur ideeller Natur sein konnten. "Es kennzeichnet die `affirmative Kultur´ des Bürgertums, daß sie nur eine edlere, keine bessere Welt entwirft."[2] Veredeln ist die kleinere Einheit des Fortschritts. Die Veredelung der Realität lief auf eine Stagnation hinaus.
Dem Adel wurden keine Zugeständnisse abgetrotzt, etwa vergleichbar dem englischen Bill of Rights. Die Stagnation und Ineffizienz der Aufklärung war um 1770 unübersehbar und führte zu einer Verschärfung der politischen Spannungen. Gemessen am langen Zeitraum der Präsenz der aufklärerischen Theorien im Diskurs des geistigen Lebens, hatten die Aufklärer nahezu keine ihrer Ziele erreicht. Die verbalen Mittel hatten sich als wirkungslos erwiesen. Der pietistische Vernunftdogmatismus, der schmerzfreie Weg zur Liberalisierung blieb folgenlos. Eine Liberalisierung der sozialen Verhältnisse hatte im Verhältnis zu Westeuropa und zum "Alter" der Idee zu wenig stattgefunden. "Im 18. Jahrhundert kommt zum ersten Male der Augenblick, wo die aufgeklärte Menschheit an sich selber irre wird."[3] Es bestand eine unüberbrückbare Distanz zwischen aufklärerischer Theorie und der Realität. Dazu waren keine Anzeichen eines absehbaren Politikwechsels in Sicht. Korff sieht hier den eruptiven Ausdruck eines bereits vorhandenen, tiefer wurzelnden Kulturpessimismus, aus dem heraus es zum Phänomen Sturm und Drang kommt. Dem entgegen wirkten die Sturm und Dränger indem sie die Position des einzelnen Menschen neu bestimmten. Man kann hier einen Wendepunkt des Interesses sehen; von den gesellschafts-reformistischen Ansätzen der Aufklärer zum Individuum. Offensichtlich führte die Rationalisierung der Welt, die Massendisziplinierung, nicht zu einer Verbesserung der Welt. Die jungen Autoren distanzierten sich deutlich vom leidenschaftslosen Vernunftdenken und waren bemüht, der Subjektivität und Emotionalität mehr Raum zu schaffen. Die Gesellschaft sollte sich im besten Fall aus frei entfalteten Individuen zusammensetzen, deren Zusammenhalt ein gefühlsmäßiger, und nicht primär ein rationaler ist. Nach R. Pascal ist das die "Sehnsucht des Sturm und Drang nach organischen, gefühlsbedingten gesellschaftlichen Bindungen"[4].
Der Sturm und Drang ging nicht von der restlosen Erkenntnis der Welt aus. "Die Welt erschien der Aufklärung als etwas Verständliches, Erklärbares und zu Erklärendes, dem Sturm und Drang hingegen als etwas grundsätzlich Unbegreifliches, Geheimnisvolles und, vom Standpunkt der menschlichen Vernunft, Sinnloses."[5] Es ist erkennbar, daß der freie Umgang der Aufklärer mit der Welt und den Handlungs- und Erkenntnismöglichkeiten darin, sich nicht vollständig auf den Sturm und Drang übertrug. Den festen Glauben in die Zukunft, wie er in der Aufklärung auftrat, betrachteten die jungen Autoren mit Skepsis. Man kann darin ein Symptom des von Korff diagnostizierten Kulturpessimismus sehen.
Das erste Ziel der Aufklärung war die Emanzipation des Bürgertums gegenüber dem Adel. Das Bürgertum beanspruchte einen Platz im politischen und kulturellen Leben. Während die Aufklärer mit moralischen Appellen auf die Landesherren Einfluß zu nehmen suchten, gaben sich die Sturm und Dränger zumindest einen revolutionären Schein. Immerhin bedeutete das eine erhebliche Grenzverschiebung. Sie bewirkten eine Radikalisierung der politischen Rhetorik. Aber das Bürgertum war zu schwach, um diesen Impuls aufzunehmen und einen gemeinsamen politischen Willen daraus zu formulieren. Denn es gab keine einheitliche politische Aussage der Sturm und Drang Autoren. Ihre verschiedenen Kreise waren poetische Vereinigungen, weniger politische Interessengruppen. Es gab politische Intentionen der Autoren, doch die Sturm und Dränger entwickelten vornehmlich ein neues, ideales Menschenbild, keine Staatstheorien und Gesellschaftskonzepte. Lenz faßt es so zusammen: "Solange wir selbst nicht Gold sind, nützten uns die goldenen Zeiten zu nichts, und wenn wir das sind, können wir uns auch mit ehernen und bleiernen Zeiten aussöhnen."[6]
Im Zentrum des Interesses stand der Mensch. Der edlere, freie Mensch, der sich folglich bessere Verhältnisse schafft. Dabei gestalteten sie dramatische Figuren die aufgrund ihres Individualitätsanspruchs mit der Realität in Konflikt geraten. Überlegungen, welche die absolutistische Machtausübung der Landesherren entfernt in Frage stellten, konnten nur anonym in der Literatur artikuliert werden. Die reale, tatsächliche Handlungsbereitschaft hin zu Reformen fand in der Gegenwart keinen Niederschlag und wurde besonders in der Literatur sichtbar, aber sie versickerte dort auch. Man war nicht bereit die Grenzen des öffentlichen Rechts für politischen Forderungen zu überschreiten.
Es gab keine Öffentlichkeit, die für Fragen der politischen Erneuerung sensibilisiert war. Die Sturm und Dränger sprachen für eine verschwindend geringe Minderheit und konnten sich keineswegs auf Rückhalt in der Bevölkerung berufen. Eine breite politische Willensbildung hatte nicht stattgefunden, denn die Ungleichzeitigkeit der einzelnen Fürstentümer verhinderte eine gemeinsame Meinungsbildung. Daher resultierte ein Mangel an Adressierbarkeit. Die wenigen politisch Interessierten bzw. Aktiven hatten ihre regionalen Szenerien, die jeweils eigene Lösungen verlangten. Eine einheitliche Politisierung, somit die Frage nach der deutschen Nation, war dadurch verhindert.
03. Das Menschenbild des Sturm und Drang - die Helden im Drama
Das Drama des Sturm und Drang ist besonders für ausufernde Protagonisten berühmt. Ohne Zweifel entstanden diese exemplarischen Helden zur Kompensation von Defiziten der Realität, welche durch persönliche Unfreiheit gekennzeichnet war. Der Kraftmensch ist eine nach eigenem Willen handelnde Person, oftmals gegen die bestehende Ordnung, welche die Konsequenzen für ihr Handeln in Kauf nimmt. "[T]he Kraftmensch expresses an impulsive individuality that appears to need no authority beyond itself."[7] Die typischen Merkmale des Kraftmenschen sind der wilde oder starre Blick, sowie sein getriebenes, gewaltiges Wesen. Seine Sprache entspricht seiner Erscheinung. Es häufen sich Interjektionen, Aposiopesen, Ellipsen, d.h. Stilmittel der Erregung. Der Kraftmensch lebt im Defizit und kann sich nur in den seltensten Fällen ganz verwirklichen. Seiner gewonnenen Freiheit steht eine gesellschaftliche Ächtung gegenüber. Freiheit schien sich nur in Armut einzustellen. Die Freiheit des Schulmeisters Wenzeslaus hat ihren Grund im Desinteresse des Fürsten. Für Wenzeslaus bedeutete das ein Leben in ärmlichen Verhältnissen. Teilweise war von den Autoren mit dem Kraftmenschen eine Vorbildwirkung beabsichtigt, um die Bevölkerung zu mehr Courage gegenüber dem Adel zu ermutigen. Götz von Berlichingen war der Erste einer Reihe von Kraftmenschen, Selbsthelfern, großen Kerls, Kraftgenies usf., die zum Symbol für den Sturm und Drang wurden. Der Kraftmensch ist eine Allegorie des tätigen Individuums nach dem Ideal des antiken Prometheus. Für die damaligen Verhältnisse ist der frei entscheidende und handelnde bürgerliche Mensch jedoch bloße Idee und vollkommen Unreal. Ein Zugeständnis an die Realität ist der Umstand, daß ein Großteil der Kraftmenschen Adlige sind. Hier handelt es sich um `verbürgerlichte´ Adlige, die ihre Herkunft quasi verleugnen. Diese Konstellation scheint notwendig, damit den Zeitgenossen das Stück überhaupt glaubwürdig erscheinen konnte. Kraftmenschen treten dort auf, wo eine gewisse Distanz zur gegenwärtigen Realität besteht. Die Dramen sind entweder zeitlich oder geographisch entfernt zur Gegenwart angelegt. Dramen, die unmittelbar in der Gegenwart spielen, lassen einen solchen Menschen vermissen.[8]
Lenz, der durchaus unexemplarisch für den Sturm und Drang in puncto Figurengestaltung ist, hat in seinen großen Dramen keinen Kraftmenschen geschaffen. Er schrieb realistische Zeitstücke, in denen der Entwurf einer derartigen Person nicht durchzuhalten war. Schiller verlegte noch 1782, zur Uraufführung der "Räuber", die Handlung ins 16. Jahrhundert um einen Eklat zu vermeiden. Der Kraftmensch war ein Experiment und der Versuch auf der Bühne zu Lösungen zu kommen, die für die Wirklichkeit beispielhaft und gestaltend wirken sollten. Insofern hatte der Kraftmensch die Funktion, den vom Sturm und Drang gewünschten Menschen zu antizipieren.
Für Alan C. Leidner "the typical protagonist of Sturm und Drang is driven not by `the truest motives´ to `the best and noblest ends´, but by ambition and revenge to acts of violence."[9] Leidner weist damit auf die private Ausrichtung des Sturm und Drang. Die Kompromißlosigkeit und Anstrengung zur Verbesserung der Lage erschöpft sich im Rahmen eines privaten Horizontes. Wo die Aufklärer im Zuge der Vernunft Wirkungen für die ganze Gesellschaft im Blick hatten, konzentrierten sich die jungen Autoren auf eine "Selbsthelferlösung". Ihre Lösungen waren singuläre Ereignisse, die fast keine Allgemeingültigkeit bzw. allgemeine Anwendbarkeit besaßen. Ziel der Sturm und Dränger war die bürgerliche Familie, innerhalb derer sich fortschrittliche und liberale Positionen durchsetzen sollten. Aus der Freiheit des Einzelnen sollte sich die Freiheit der Gesellschaft ergeben. Die Kraftpersonen waren dabei meist für eine ganze Menschengruppe zuständig.[10] Trotzdem war in keiner Weise denkbar, daß je der Status der Minorität verlassen wurde. Während die Stücke der Aufklärung an die adlige Oberschicht adressiert waren, damit deren Umdenken Folgen auf die Politik habe, richtete sich der Sturm und Drang direkt an das Bürgertum. Es bleiben dennoch Theaterlösungen, zum Teil unterstützt durch den deus ex machina,[11] die wenig mit der Wirklichkeit gemein haben. Lenz bildet hier eine Ausnahme. Er betreibt einen beträchtlichen Aufwand, um nicht zu einer Selbsthelferlösung zu gelangen. Zwar gelingt ihm das nicht vollständig, Lenz konstruiert ebenso Einzellösungen, aber versäumt es nicht, einen konkreten Verbesserungsvorschlag einzuflechten. K.R.Scherpe nennt das den "sozialpragmatischen Impetus", der sich im "Hofmeister", den "Soldaten", im "Neuen Menoza" und selbst im "Landprediger" wiederfinden läßt.[12] Der sozialpragmatische Impetus ist meiner Ansicht nach Lenz´ Bemühung mit seinen Dramen auf die Gegenwart Einfluß zu nehmen. Das Ziel hieß, den Dialog zwischen den Ständen zu initiieren. Es ist in jedem Fall ein Versuch der Einflußnahme. Das es Lenz mit seinen Reformvorschlägen ernst gewesen ist, bestätigt der Umstand, daß dieses Phänomen mehrfach auftritt. Lenz greift damit voraus auf die "sozialrevolutionären" Ansprüche und Themen der Mainzer Republikaner, Büchners und des jungen Deutschlands.
A.C.Leidner verweist weiterhin darauf, daß die Sturm und Drang Protagonisten explizit nicht vom Vernunftdenken geleitet wurden. Der neue Mensch sollte weniger von der Vernunft als von Emotion und subjektivem Empfinden geführt werden. Vereinfacht bringt Korff es auf den Punkt: Aufklärung = Vernunftwesen, Sturm und Drang = Triebwesen.[13] Die sture Logik der Vernunft, das kühle Wägen des Möglichen, das die Aufklärer ihrem Handeln zu Grunde legten, betrachtete der Sturm und Drang als Beschneidung elementarster menschlicher Eigenschaften. Bürgerlicher Stolz und persönliche Ehre wurden zu emotional stark aufgeladenen Begriffen, die selbst mit Gewalt verteidigt wurden. Das ökonomisch gefestigte Bürgertum der Städte entwickelte ein starkes Selbstbewußtsein und reklamierte ein Mindestmaß an persönlichen Rechten und Freiheiten. Das Menschliche, das für die Sturm und Drang Autoren eine zentrale Kategorie war, ist ein schwer faßbarer Begriff zwischen individueller Freiheit, nach Willen und Fähigkeiten zu leben, sowie äußerer Handlungsfreiheit. Es ist auch das Unnütze, Melancholische und schließt Fehlerproduktion und Scheitern mit ein. Mit dem Sturm und Drang setzt eine Art Paradigmenwechsel ein, der dem einzelnen Menschen mehr charakteristische Eigenheiten zugesteht, was im weiteren auf den Entelechiegedanken der Klassik verweist. Man muß es zumindest als Antagonismus zum aufklärerischen Leistungsgedanken betrachten.
Die idealistischen Vorstellungen vom Menschen liefen im antiken Prometheusbild zusammen. Prometheus ist die göttliche Entsprechung des Kraftmenschen. Er dient als unausgesprochene Legitimationsfigur für eine Reihe von Dramenhelden. Dennoch bleiben der Großteil von ihnen Selbsthelfer die persönliche Konflikte lösen und nicht für Forderungen einer Masse von Menschen streiten. Prometheus signalisiert die Revolution. Doch das revolutionäre Potenzial des Prometheusmythos lag den Sturm und Drängern fern. Der kommende Mensch sollte wie er die Welt selbst gestalten und verbessern, aber ohne gewaltätig gegen die Obrigkeit vorzugehen. Das Bürgertum hoffte zu mehr Einfluß zu gelangen, indem sich seine ökonomische und moralische Überlegenheit herausstellte und sich so der Adel an ihm orientieren würde. Shaftesbury sieht den idealen Menschen als "second Maker"[14] nach Gott. Bei Lenz taucht dieser Gedanke kurz im Zusammenhang mit dem von ihm geforderten Standpunkt auf.[15] Meiner Ansicht nach war für Lenz Prometheus nicht von zentraler Bedeutung, da ihm die Realisierung eines Kraftmenschen fern lag. Seine Idee einer Gesellschaftsreform ging wohl eher vom Volk aus, als das sie von einer Person geführt wurde.
04. Exkurs: Die Helden bei Lenz
Lenz hatte direkten Anschluß an die Sturm und Drang Bewegung und registrierte die Tendenz zu ”großen Kerlen”. Weder im "Hofmeister" noch in späteren Stücken findet sich ein exemplarischer Held. Schon in den "Anmerkungen" projektiert Lenz den großen, unabhängigen Menschen. "[E]s ist die Rede von Charakteren, die sich ihre Begebenheiten erschaffen, die selbstständig und unveränderlich die ganze große Maschine selbst drehen, ohne die Gottheiten in den Wolken anders nötig zu haben, als wenn sie wollen zu Zuschauern; nicht von Bildern, von Marionettenpuppen- von Menschen."[16] Lenz ist mit der Konzeption vom Kraftmenschen vertraut, aber er gestaltet selbst keinen. Er fühlt sich der Realität verpflichtet, in dem Sinne, daß man "sein Gemälde mit der Sache verwechseln"[17] soll. Seine Stücke spielen unmittelbar in der Gegenwart und reflektieren aktuelles Zeitgeschehen[18]. Der Kraftmensch existierte jedoch in der Gegenwart des 18. Jahrhunderts nicht. Während der Großteil der Sturm und Drang Autoren phantastische und idealisierte Szenarien mit ungeheuren Menschen entwirft, "führt Lenz mit seinem Schicksal und in seinen wichtigsten literarischen Figuren das Scheitern dieses grossartigen Entwurfs einer ganzheitlichen Existenz vor Augen."[19] Seine Figuren scheitern zwangsläufig und agieren nicht nach der Dramaturgie des Großteils der Sturm und Drang Autoren. "Lenz verzichtete nicht nur auf den `gemischten´ Helden, er verzichtete sogar ganz auf Helden."[20] Nach Aristoteles Entwurf des Helden der Tragödie, auf den sich Lessing bezieht, soll der Mensch als Mensch, d.h. unvollkommen, erkennbar bleiben. Er soll nicht Einseitig gut oder schlecht dargestellt sein, vielmehr als Gemisch aus beidem. Dennoch wurde Lessings Theorie vom gemischten Helden von Lenz ebenso abgelehnt, bzw. nicht angewandt, wie er sich überhaupt gegen jedes Moment von Heldentum konsequent verweigert.
In den ”Anmerkungen” kommt Lenz zum Schluß: "Meiner Meinung nach wäre immer der Hauptgedanke einer Komödie eine Sache, einer Tragödie eine Person."[21] Entsprechend eigener Benennung, auch wenn diese gelegentlich schwankt werden seine großen Dramen sämtlichst als Komödien ausgewiesen. Damit ist nach den Thesen der ”Anmerkungen” festgelegt, daß es in seinen Werken um Dinge bzw. Gemeinschaftsangelegenheiten geht. Die Tragödie bedingt seiner Meinung nach den Helden bzw. der Held bedingt die Tragödie. In Komödien stehen Personengruppen im Vordergrund, keine Individuen. "Es ist nicht die Tragik individuellen Schicksals und Leidens, die Lenz in seinen Komödien betont, sondern das Trauerspiel eines Gesellschaftszustandes, der sich gewaltätig auf die unteren Stände niederschlägt: auf Läuffer im Hofmeister und Marie Wesener in den Soldaten."[22]
In dem kurzen Drama "Pandemonium Germanicum" läßt Lenz die Figur Herders den Satz sprechen: "Mensch, die sind viel zu groß für unsere Zeit"[23] und bezieht sich damit auf die Dramenfiguren von Lenz. Er selbst empfand das Außergewöhnliche seiner Bühnencharaktere, die in ihrer Dimensionalität keine Entsprechung in ihrer Zeit hatten. Ihnen fehlt die Bühnenlogik, die Berechenbarkeit im Handeln. Man muß dieses "groß" als Volumen betrachten.
Das Vielschichtige von Lenz´ Figuren läßt verschiedene Facetten innerhalb der selben Person zu. Seine Figuren sind zum Teil an den Typen der traditionellen Komödie orientiert, aber sie gehen über diese hinaus.[24] Lenz verleiht dem Typ Individualität. Diese offene, unverbindliche Gestaltung ermöglicht irrationale und sogar absurde Momente, wie sie zuerst bei Lenz[25] und später bei Klinger[26] auftraten. Das hatte keinen Aufstand der Kritik zur Folge und lag sogar etwas im Trend. Daran lässt sich auch erkennen, wie weit sich der Sturm und Drang vom Literaturbegriff Gellerts oder Gottscheds entfernt hatte.
Zum Dramenende erfolgt der Rekurs auf den im ganzen Stück impliziten sozialpragmatischen Impetus, der über das Stück hinausgeht und eindeutig politischen Charakter hat.[27] Es wird die Reform des Schulwesens gefordert, die tatsächlich die Grundfeste der Ständegesellschaft in Frage gestellt hätte. Natürlich ist der Modellcharakter der Szene unübersehbar. Doch der hier vermittelte richtungweisende Impuls ist nicht die Sache einer Figur, sondern folgerichtig ein ge-meinsam formulierter Reformansatz. Um dem Gedanken die nötige Bedeutung zu verschaffen, wird er von einer Gemeinschaft (V/ 12) vorgebracht und damit Dauerhaftigkeit und allgemeiner Nutzen evoziert. Lenz vermeidet damit den Anschein einer Selbsthelferlösung und erreicht gleichzeitig eine Massen wirkung, indem eine unverbindliche Gruppe mit einer Reformidee den Schlußauftritt erhält. So ist der selbe Effekt gewonnen; die Meinungsmeldung der Massen, und, als wenn der Fürst bzw. der König, als Institution, im Namen des Volkes gesprochen hätten. Es entsteht eine Aussage mit großem Gewicht. Der erfolgreiche Held wäre eine Individuallösung.
05. Exkurs: Machtdemonstrationen
Mit besonderer Sorgfalt widmet sich Lenz den Machtstrukturen innerhalb des Hauses von Berg. In kleinen Einschüben, als Holpersteine des Verständnisses, wird der Despotismus des Adels auf elementarster Kommunikationsebene vorgeführt. In einer Mischung aus Frechheit, Respektlosigkeit, Dummheit und gespielter Naivität wird sich über einen allgemeingültigen Konsens hinweggesetzt und neue Verhandlungen in der jeweiligen Frage erzwungen.
Nachdem die Majorin das Hofmeistergehalt um die Hälfte herunter gehandelt hat, ist sie nicht zu Zugeständnissen bereit, wie zu erwarten wäre, sondern stellt Forderungen. "Dafür verlang ich aber auch[...]"(I,3) Die syntaktische Kombination zweier komplementärer Aussagen eines Sachverhaltes ist entgegen jedes Verständnis. Lenz scheut sich nicht, diesen offensichtlichen Nonsens der Majorin in den Mund zu legen, um ihre Dummheit zu demonstrieren, aber auch ihre Macht. Denn selbst in der größten Dummheit liegt die Entscheidung bei ihr. Die Majorin gibt sich naiv, um keine Diskussion führen zu müssen, weil die Entscheidung längst gefallen ist. Der Dialog ist nur formal, er wird nur zum Schein geführt. Es ist keine Verständigung, sondern eine Benachrichtigung. Der Mechanismus der gestellten Naivität wird offenkundig, als ihm mit größtem Sarkasmus auf die Frage nach einem Pferd geantwortet wird.(II,1) Den Gesprächssituationen haftet eine merkwürdige Ambivalenz an. Einerseits sind sie objektiv unwahr bzw. unrichtig, andererseits verbreiten sie eine subtile Arroganz. Sie sind feinsinnige und evidente Demonstrationen der Macht. Eine entsprechende Situation findet sich im vierten Auftritt des ersten Akts. Läuffers Gehalt wird noch einmal heruntergesetzt, diesmal vom Major, und wieder erhält er zusätzlich einen Auftrag. Er hat zusätzlich die Tochter des Hauses zu unterrichten. Beide Male ist Läuffer nicht imstande etwas gegen diese Forderungen zu unternehmen. Solche Konflikte zeigen die herrschende Ungerechtigkeit, gleichzeitig verdeutlichen sie unmißverständlich, wo über Recht und Unrecht entschieden wird. Läuffer ist dem Hause von Berg als Domestik ausgeliefert. Gelegentlich erlaubt sich Lenz Seitenhiebe zur Majorin.[28] Zwar kann er sie auf diese Weise menschlich kompromittieren, ihre Macht zieht er damit jedoch nicht in Zweifel. Es verstärkt nur das Ohnmachtsgefühl der Unmündigkeit.
06. Die Figuren
Für die Teilnehmenden der Schlußszene des "Hofmeisters" ergibt sich eine Gemeinsamkeit: Sie geben einen Teil ihres bisherigen Selbstverständnis auf und erklären, Veränderungen in ihren Leben vorzunehmen. Die Bühnenfiguren, und möglichst mit ihnen die Zuschauer, überdenken ihren Standpunkt , da sie die Fehler ihres Handelns erkennen. Das konstruierte Schlußtableau mutet wie eine moderne Katharsis an. Das Besondere dieses Schlusses ist der offene Dialog zwischen Adel und Bürgertum. Gemeinsam beschließt die Schlußgruppe ein gemeinsames Engagement in Schulangelegenheiten. Nach den aufgetretenen Katastrophen sind die Figuren am Ende zur Räson gebracht. Noch bevor die Bühnenfiguren von der Handlung zur Einsicht über ihr Handeln gebracht werden, vermittelt Lenz dem Zuschauer die Unzulänglichkeit der Personen und ihres Standpunktes. Er nimmt den Zuschauern, die zunächst die Wahrheit der Bühnenworte voraussetzen und ihnen willkürlich vertrauen, die Sicherheit zur Einschätzung der Figuren. Die unmittelbare Reaktion ist das Mißtrauen der Zuschauer gegenüber den Worten und dem Auftreten der Akteure. Das geschieht, indem Lenz sie in Situationen und Gespräche verwickelt, in denen sie zu sich selbst in Widerspruch geraten. Der Geheime Rat entlarvt sich als Schwätzer, wenn er den Pastor mit überzogenen Freiheitsidealen traktiert, dennoch später den Verleumdungen Dritter traut. Wenzeslaus hat eine klare Sicht auf die Zustände und lebt in relativer Freiheit. Er erhält sich diesen Zustand jedoch durch sein anspruchsloses, asketisches Dasein, dank dessen er seine Armut erträgt. Der Major muß in dem Maße, wie seine Pläne mit Auguste scheitern, sein theoretisches Menschenbild revidieren, wonach das formbare Individuum in jeden Zustand gebracht werden kann. Die Majorin kann aristokratisches Standesempfinden und Lebensart nicht durchsetzten. Pätus und Fritz sind auf den deus ex machina angewiesen, um noch in ihre Geschicke eingreifen zu können. Die Verlogenheit der Figuren wird sichtbar, indem Lenz sie mit Situationen konfrontiert, in denen sie ihren bisherigen Axiomen geradezu abschwören müssen. Lenz läßt ihre Theorien sich selbst widerlegen, ihre Meinungen lächerlich oder gefährlich konträr zur menschlichen Natur erscheinen. Mit der drastischen Schilderung der Folgen ihres Handelns zieht er die ihre Aussagen in Zweifel und nimmt den Bühnenfiguren den Nimbus der Wahrheit. Ihre Argumentationen werden als falsch und halbwahr deutlich, damit das Publikum kritisch die Handlung verfolgt. Es geht in der Konsequenz darum, daß Alternativen zu den gesellschaftlichen Verhältnissen gesucht werden, wenn die Spannungen in der Gegenwart zu groß werden. Zu Spannungen führen die diktatorischen Entscheidungen des Adels, an denen ihre Untergebenen scheitern. Aber Lenz sah diesen Despotismus auch auf Seitens des Bürgertums. Wenzeslaus, Rehaar, der alte Pätus sind da wo sie es können, ebensolche Despoten. Es geht Lenz nicht darum den Adel als moralisch Schuldigen zu exponieren, sondern beide Parteien, Adel und Bürgertum, von der Notwendigkeit der Kooperation zu überzeugen. Die Wahrheit bzw. moralischen Maßstäbe sind ambivalent und immer neu zu bestimmen. Lenz vergibt keinen sicheren Standpunkt im Sinne des Besitzes einer dauerhaften Wahrheit, und beansprucht auch für sich selbst keinen. "Lenz´s work is a forum for the intellect that constantly keeps itself open to truth […]"[29] Lenz stellt den falschen Glauben an eine sichere, tradierte und konkrete Wahrheit bloß, die feste Regeln für die Gegenwart vorgibt. Der dogmatische Umgang mit Wahrheit und Moral, den eine aufgeklärte Allianz aus Adel und Bürgertum dem Menschen auferlegt, ist möglicherweise das tiefere Ziel seiner Kritik.
Die Figuren sind in ein kompliziertes Beziehungsgeflecht eingebettet, so daß singuläres Handeln verunmöglicht wird. Etwaige Einzelaktionen scheitern und bringen statt Erfolg nur Repressalien. Er schafft nicht die Illusion der aussichtsreichen Rebellion gegen die gegebene Ordnung, was z.B. ein geächtetes Heldendasein zur Folge hätte. Lenz´ realistische Darstellungsweise und unmittelbare Gegenwärtigkeit zwingen ihn, die direkten Folgen einer Tat ebenso vorzuführen. Es zeigt sich jedoch das die Figuren ihr anfängliches Engagement nicht durchhalten können und die ursprüngliche Initiative scheitert. Die Figuren sind nicht zu Helden disponiert. Es gibt im ”Hofmeister” keinen Protagonisten, weil Lenz keinem Charakter das Potenzial zu großen Taten zugesteht. Die persönlichen Wünsche bzw. Ziele der Figuren erfüllen sich nicht. Die Folgen der wenigen eigenen Handlungen, also Handlungen ohne Anweisung, sind fatal. Pätus steigt in das Fenster Jungfer Rehaars und muß sich deshalb mit Fritz duellieren (IV,2). Der Kuß zwischen Gustchen und Fritz hat das Briefverbot zur Folge, das zur Entfremdung zwischen beiden führt (I, 5/6). Läuffer muß für die einzige private Handlung, die er nur für sich unternimmt, flüchten, wird angeschossen und endet als Kastrat. Niemand handelt aus der Freiheit des Vermögens heraus. Die Ansprüche der Charaktere erfüllen sich nicht. Sie alternieren zwischen Rebellion und Affirmation. Sie lehnen sich auf und kapitulieren. Im "Hofmeister" gibt es keine revolutionären Personen, die eine realistische, gestalterische Idee für Gegenwart und Zukunft haben. Zwar klingen einzelne reformerische Gedanken an, gleichwohl werden diese durch die vortragende Person blamiert. Keine der Figuren fühlt sich willens oder disponiert Verantwortung und Engagement für einen Reformansatz zu übernehmen. In einer Mischung aus Verzagtheit und Unfähigkeit sind die Figuren nicht fähig über sich hinaus zu denken. Die Figuren im Hofmeister sind konsequent "unheldisch". Den Personen fehlt das Schöpferische und das Produktive des Prometheus, eher sind sie das Gegenteil und immerfort am Reagieren, doch dafür sind sie realistisch.
Mit dem ersten Auftritt des Hofmeisters erzeugt Lenz Mißtrauen. Der Zuschauer wird in ein Intrigennetz einbezogen, ohne das ihm die Mittel gegeben sind, es zu durchschauen. Es kann keine Sympathisierung der Zuschauer mit dem positiven Helden geben. Keine der Bühnenfiguren verkörpert das Gute, Fortschrittliche oder fungiert als Perspektive. Lenz gestaltet konsequent keine homogenen, eindimensionalen Charaktere, sondern durch die detaillierte Schilderung ihres Milieus werden sie realistisch. Er präsentiert die Realität, ohne einen Ausweg aus ihr zu zeigen. Ein großer Teil der realistischen Schilderung ergibt sich aus der rigorosen Darstellung der Schwächen der Akteure. Im "Hofmeister" gibt es keine Figur die kein Manko hat. Nahezu jede Figur hat ihre "lächerliche Seite" (II,6). Zu jeder Figur findet sich eine gezielte Indiskretion, um sie zu desavouieren.[30] Diese eher unbedeutenden Seitenhiebe, sind in der Anzahl bemerkenswert. Sie stehen frei für sich und unterlaufen die Art, wie sich die Person sonst im Stück präsentiert. Es scheint als ob Lenz explizit auf deren Unvollkommenheit hinweisen bzw. eine Person nicht ohne Kehrseite vorstellen wollte. Zum Teil ist die Motivation für die Details nicht direkt erkennbar, wie der Mundgeruch Gustchens in einem früheren Entwurf der Szene (II,5)[31] oder die Fontanelle am Fuß der Majorin. Der "entschiedene[...] Hang zur Intrige", den Goethe Lenz zuschrieb, wird hier sicher eine Rolle gespielt haben.[32] Im allgemeinen benutzt Lenz dieses Mittel, um das Beschränkte der Personen vorzuführen. Sie können auch von Lenz mit der Intension geschaffen worden sein, ein mögliches Identifizieren der Zuschauer mit der Bühnenfigur in jedem Fall zu verhindern. Selbst mit den positiv erscheinenden Personen verhindert Lenz eine Identifikation.
Aber die Denunziationen zielen nicht auf die auf die Erniedrigung des Einzelnen ab, sondern dienen dazu, die Unvollkommenheit des Menschen zu zeigen und damit auf die Schwierigkeiten beim finden der Wahrheit zu verweisen. Die Funktion der Desavouierung der Charaktere besteht meines Erachtens darin, die starre und saturierte Haltung des allgemeinen Konsens deutlich zu machen, welcher sich auf Traditionen gründet und in der Gegenwart die Wahrheit nicht mehr fassen kann.
Eine Figur gewinnt durch die Bloßstellungen an Breite und persönlicher Charakteristik, auch wenn sie für den Zuschauer an Erfaßbarkeit verliert.
Besonders evident wird das an der Figur des Hofmeisters Läuffer, dessen Unvermögen unverhohlen zur Schau gestellt wird.
07. Läuffer
Die erste Szenen zeigt Läuffer allein auf der Bühne, im kritischen Dialog mit sich selbst. Obgleich er sich relativ umsichtig mit seiner eigenen Position auseinandersetzt, wird den Zuschauern bedeutet, daß dieser Person gegenüber ein gewisses Mißtrauen angebracht ist. Man erfährt von seinem beruflichen Scheitern. Es geht um "Fehler", er sei "nicht tauglich" und man "sieht mich vermutlich nicht für voll an."(I,1) Läuffer ist unzufrieden mit seiner Position. Er nennt die gescheiterten Projekte: er wird nicht Adjunkt, nicht Pastor und auch kein Klassenpräzeptor an der Stadtschule Insterburg. Nach Läuffers Verständnis sind sein Alter und seine weltmännische Überqualifikation für die Pfarrstelle von Nachteil. Sonst kann er keine Makel an sich entdecken. Verantwortlich für die berufliche Misere sind seiner Meinung nach sein Vater und vor allem der Geheime Rat von Berg, der ihn nicht an der Stadtschule lehren lassen will. Läuffer glaubt sich unterschätzt und ist sich nicht bewußt, wie er sich in den Augen des Rates Anerkennung verschaffen könnte. Er bleibt ihm fern:"[...]ich scheu ihn ärger als den Teufel. Der Kerl hat etwas in seinem Gesicht, das mir unerträglich ist." (I,1) Hier setzt das System der Intrigen und Verdächtigungen ein, in das der Zuschauer voll integriert wird.
Lenz erklärt nicht, warum Läuffer vom Geheimen Rat abgelehnt wird. Es bleibt ein unbegründeter Makel an der Figur. Man kann Läuffer schwer verstehen, einerseits weil man sich noch nicht im Drama orientieren kann, andererseits sind die Gedankengänge sehr eigen. Mit Hilfe einer nicht nachvollziehbaren Syntax überschreitet Lenz die Grenzen allgemeiner Logik. Nach Läuffers Aussage scheint jeder Grund zur Ablehnung möglich: "Er ist Pedant, und dem ist freilich der Teufel selber nicht gelehrt genug. Im halben Jahr hätt ich doch wieder eingeholt, was ich von der Schule mitgebracht, und dann wär ich für einen Klassenpräzeptor noch immer viel zu gelehrt gewesen; aber der Herr Geheime Rat muss das Ding besser verstehen."(I,1)
Lenz läßt keine genaue Erklärung zu. Ist Läuffer als Universitätsabsolvent zu gut oder zu schlecht für eine Stadtschule, oder ist es seine persönliche Unattraktivität? Der Satz bleibt unverständlich. Läuffer signalisiert, daß der Geheime Rat hohe Ansprüche hat. Er müßte also seine Fähigkeiten noch verbessern, aber hat er nicht gerade die Universität abgeschlossen? Um dennoch zu gelehrt zu sein. "[S]oll das Satire sein, oder"?(I,1)
Läuffers Talfahrt ist damit nicht beendet, denn der Geheime Rat gibt ihm weder die Stellung in der Schule, noch ist er bereit, mit ihm ein ernsthaftes Gespräch zu führen. Der blanke Hohn des Geheimen Rates macht ihn zu "Monsieur Läuffer"(I,1), dem Bonvivant; er spricht mit ihm vornehmlich über die Leipziger Kaffeehäuser. Läuffer fragt zu Recht, ob es sich dabei um Spott handelt. Mit der Ahnung, daß der Geheime Rat "mich vermutlich nicht für voll"(I,1) ansieht, liegt er also nicht falsch. Wie zum Beweis seiner proklamierten Unsicherheit, verschwindet Läuffer eilig mit viel freundlichen Scharrfüssen (I,1), während der Major und der Geheime Rat auftreten.
Der Hofmeister Läuffer wird auf eine traurige Art eingeführt. Seine Schwächen werden unmißverständlich in der ersten Szene ausgestellt. Der erste Akt zeigt Läuffers vorsichtiges Ausloten der Möglichkeiten im Haus. Er ist Hofmeister von der Majorins Gnaden. Wenn er zu Beginn versucht, seine gesellschaftliche Position, sein dignitas Empfinden, zu behaupten, so muß er doch schnell seine wahre Stellung anerkennen. Er fügt sich nicht widerstandslos in die servilen Rituale des Schloßlebens, doch sind seine Interventionen zur Anerkennung seiner Person von Beginn an hoffungslos. Läuffer erscheint in sehr demütiger Stellung (I,3) neben der Majorin. Er versucht sich tapfer ins Gespräch zu bringen (I,3). Nach der verheerenden Abfuhr durch die Majorin in Gegenwart des Grafen Wermuth, will Läuffer wenigstens soweit Widerstand leisten, indem er demonstrativ stehen bleibt. Er versucht durch Präsenz seine Existenz zu demonstrieren, doch er wird ohne weiteres aus dem Raum entfernt.
Während der Major ihm in der folgenden Szene ein weiteres Mal das Gehalt kürzt (I,4), widerspricht er formal ohne auch nur an den Erfolg seiner Intervention zu denken. Später ist er nicht einmal mehr zum Widerspruch fähig. Junker Leopold kann ihn ohne Skrupel schlagen, weil er weiß, welches Gewicht die Belange des Hofmeisters im Hause haben.(II,5) Er kann sein bürgerliches Selbstwertgefühl in diesem Haus nicht behaupten.
Läuffer ist, bzw. wurde in kürzester Zeit dazu komprimiert, das "artige Männichen"(I,2) zu sein, als das ihn der Major von Anfang an betrachtet. Harmlos und zur Revolte nicht fähig. Die vollständige Blamage und Demontage der Figur während der ersten 4 Szenen setzt sich fort: Läuffer wird vom Major angefahren, ob er nicht anständig auf dem Stuhl sitzen kann.(I,4); Er kennt weder "Romeo und Julia", noch die "Neue Heloise"(II,5); Wenzeslaus kritisiert Läuffers Latein und bezeichnet ihn "kaum zum Kollaborator tüchtig"(III,4) und endgültig der mißratene Versuch der Kastration. "Sein Dramatiker betrügt ihn sogar um die Tragik der Kastration."[33] Läuffer ist erfolglos und ohne besondere Talente. Die vorgegebene Weltläufigkeit, durch die er sich geistig über das Haus von Berg überlegen fühlte, ist Resultat seines Kleingeistes. Er erkennt seine Misere und versucht seine Position zu verbessern, aber scheitert ständig neu.
08. Der Adel
Das Stück intendiert nicht eine Belehrung des Bürgertums, sondern zuerst die des Adels, da er durch seine Machtposition die Gegenwart gestaltet. Deshalb steht die Majorsfamilie im Zentrum des Stückes. Genauer betrachtet ist der "Hofmeister" ein Adelsdrama, denn die Belange der Bürger spielen eine untergeordnete Rolle. Sie initiieren die Handlung, indem sie Probleme produzieren. Auf deren Lösung haben sie sowenig Einfluß, wie auf die Produktion, wenn man die Reglementierung der Untertanen als unerfüllbar anerkennt.
Die Majorin und der Major werden in ihrer ländlichen Einfältigkeit gezeigt, welche sie durch ihre Macht als Standespersonen beliebig ausleben können. Dabei kommt der Major dem Bild des Kraftmenschen am nächsten, denn er ist zu spontanen, emotionalen Handlungen fähig. Von der Wirklichkeit belehrt, revidiert er seine übertriebenen Vorstellungen vom Leben seiner Tochter und findet den menschlichen Zugang zu ihr wieder. Er besitzt eine gewisse Lernfähigkeit, einmal gefaßte Ansichten, wenn auch unter Zwang, zu verwerfen. Emotionales, menschliches Empfinden gewinnt einen höheren Stellenwert als aristokratisches Standesdenken. Der Major findet erst zur inneren Zufriedenheit zurück, nachdem er endgültig seine Vorstellungen über die Zukunft seiner Tochter aufgegeben hat. Die Figur des Majors macht innerhalb des Stückes die größte Wandlung durch. Er wird als brutaler Haustyrann eingeführt, der von niemandem ernst genommen, aber Dank seiner Macht gefürchtet wird. Die Organisation des Hauses und die Erziehung des Junkers Leopold besorgt die Majorin. Es ist nicht ersichtlich ob sich der Major am ohnehin spärlichen gesellschaftlichen Leben beteiligt, in jedem Fall ist es die Domäne seiner Frau. Nur einen Bereich beansprucht er für sich selbst: Das alleinige Sorgerecht für Gustchen. Merkwürdig erscheint aber, daß der Vater und die Tochter bis zur Szene am Teich(IV,4) keinen gemeinsamen Auftritt haben. Ihre Kommunikation funktioniert nur indirekt und stockend. Denn in seinem Bemühen, Auguste einen angesehenen Bräutigam zu verschaffen und sie auf einen solchen vorzubereiten, merkt er nicht, wie sie vereinsamt.(II,5) Nicht nur die Majorin ist Schuld an der Isolierung Augustes, sondern auch er selbst, indem er sie von aller Gesellschaft fern hält. Er ist unfähig, seine Liebe zu seiner Tochter zu kommunizieren, er kennt sie nicht einmal. So betet er verzweifelt und beschuldigt seine Frau, wo er selbst versagt hat.(II,6) Denn er ist keineswegs Herr in seinem Haus. Leopold weiß längst ihn zu umgehen(II,5), seine Frau macht sich lustig über ihn(II,6) und für Gustchen findet er keine Worte. Die intensive Feldarbeit kommt einer Flucht gleich und Majorin ist nicht im Unrecht, wenn sie von der "lächerlichen Seite"(II,6) ihres Mannes spricht.
Der Geheime Rat wird nachhaltiger mißkreditiert. Er überfordert den Pastor mit seinen liberalen, aufklärerischen Reden und stellt ein Freiheitsideal auf, das für das Milieu des Stückes vollkommen überdimensioniert ist. "Freiheit ist das Element des Menschen wie das Wasser des Fisches, und ein Mensch der sich der Freiheit begibt, vergiftet die edelsten Geister seines Bluts, erstickt seine süßesten Freuden des Lebens in der Blüte und ermordet sich selbst."(II,1)
Dieser euphorischen Preisung der Freiheit steht sein eigener Kleingeist entgegen, der seinen Sohn Fritz im Gefängnis sitzen lässt, während er auf die Aussagen von Fremden vertraut.(III,3) Der Geheime Rat stellt Ansprüche auf, denen er selbst nicht gerecht wird. Er befindet seinen Sohn für schuldig aufgrund der Tatsache, daß er sich im Arrest befindet. Trotz seinem liberalen Positionen aus dem Gespräch mit Pastor Läuffer(II,1), wird der Geheime Rat am in der entsprechenden Situation als starrer Aristokrat und dummer Pedant bloßgestellt.[34] Nach einer solchen konsequenten Wendung der Ansichten, kann man ihn nur noch als Schwätzer betrachten. Dennoch sind Major und Geheimer Rat die aufgeklärten, fortschrittlichen Standespersonen, denen an einem Kompromiß mit dem Bürgertum gelegen ist. Den Kontrast zu den aufgeklärten und natürlichen Menschen der Schlußszene verkörpert vor allem die Majorin. Ihr zur Seite stehen der Graf Wermuth und Herr von Seiffenblase. Sie erschöpfen sich ganz in der Rolle der schlechten Aristokraten, die zu keinen Zugeständnissen an das Bürgertum bereit sind. Lenz zeichnet sie als Verlogen und notorisch Übertreibend.[35]
Lenz teilt den Adel in zwei Kategorien: Tätig und Untätig; je nachdem Bereitschaft zum fortschrittlichen Umdenken vorhanden ist. Dieser Teil des Adels, der nicht zu einer Neuorientierung bereit ist, wird von der Majorin, dem Grafen und Herr von Seiffenblase repräsentiert. Sie sind demonstrativ von der Schlußharmonie ausgeschlossen. Das tätige Individuum ist ein Symbol der Bürgerlichkeit. Die "Fontanelle" der Majorin(II,6) brandmarkt sie regelrecht als krank und faul.
Mit der Verführung fällt auch Gustchen aus dem Kreis der integeren Personen, obwohl sie dadurch einen Opferstatus erhält. Sie lässt sich mit einer angestellten, mittellosen Person ohne Stand ein. Eine Heirat ist von vornherein ausgeschlossen. Gustchen betrügt ihren Bräutigam. Dabei geschieht diese Affäre aus Langeweile, man kann gar nicht von Liebe zwischen ihr und dem Hofmeister sprechen. Ihre Beziehung entstand lediglich aus den beengten Verhältnissen und Mangel an Gesprächspartnern im Hause von Berg. Daraus kann sich keine heroische Liebe über die Standesschranken hinweg entwickeln. Immerhin ist Gustchen die Einzige, die Läuffer jemals beim Vornamen nennt. Der Hofmeister heißt Hermann Läuffer.(II,5) Aber die ganze Beziehung hat etwas schwer Verzweifeltes und es bleibt im Dunklen, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Möglicherweise vertreten Auguste und Fritz die neue Adelsschicht, denen an einer Annäherung zum Bürgertum gelegen ist. Die Harmonie des Endes macht einen sehr instabilen Eindruck, ein Rückfall in das traditionelle Standesgefüge ist wohl wahrscheinlich.
09. Wenzeslaus
Das Leben der auftretenden Bürger ist vollständig auf den Adel ausgerichtet, es gibt nicht die Alternative eines selbstständigen bürgerlichen Lebens. In das bürgerliche Leben erhält man wenig Einblick, da Läuffer, sein Vater, Wenzeslaus, die Pätusfamilie oder Rehaar in ihrer Art nicht repräsentativ das Bürgertum darstellen. Aber die Bürger werden klar als die tätige Gesellschaftsschicht dargestellt, am deutlichsten im Schulmeister Wenzeslaus. Vergleichsweise nimmt die Handlung mit bürgerlicher Beteiligung dennoch wenig Raum ein. Huyssen stellt deshalb fest: Es "fehlt in Lenz´ Stück der aufgeklärte Bürger".[36] Keine der Figuren fungiert als Projektionsfläche bürgerlicher Gesellschaftsvorstellungen. Im Gegenteil, die bürgerlichen Gesellschaftsvorstellungen blamieren sich in ihren Vertretern. Dabei ist der Geheime Rat in Szene (II,1) der Hauptvertreter bürgerlicher Interessen. Die Bürger sind nahezu ausschließlich Dialogpartner des Adels. Teilweise ist in ihre Charaktere die devote Haltung gegenüber dem Adel eingeschrieben. Das ist besonders bei Rehaar und Pastor Läuffer der Fall. In der Person Rehaars wird die Unterwürfige Haltung als Methode bloßgestellt, die jedes Gefühl der Ungerechtigkeit hinnimmt, gleichzeitig aber die Person selbst nicht weiter zum rechtmäßigen Handeln verpflichtet.(V,2)
Wenzeslaus ist die Karikatur des aufgeklärten Bürgers, der mit der Reglementierung seines Daseins aus den Prinzipien der Vernunft, sein menschliches Leben eingebüßt hat. Seine Thesen werden schon allein durch sein Wesen mißkreditiert. Denn er vertritt durchaus ernst zu nehmende Positionen und ist in seinem Selbstverständnis als Bürger wesentlich sicherer als Läuffer. Seine bürgerliche Arbeitsmoral, die das Arbeiten zum konstituierenden Element des Lebens macht und alle weiteren Tätigkeiten des Lebens darauf ausrichtet, emanzipiert ihn vom Adel. Aber er führt dieses selbstbestimmte Leben auf Kosten seines Körpers. Die Verstümmelung des Körpers, die Läuffer mit der Kastration an sich vornimmt, hat bei Wenzeslaus längst stattgefunden. Er wendet Gewalt gegen sich an und befürwortet sie als Mittel zum gottgefälligen Leben. Dementsprechend singt er ein Hosianna auf Läuffers Kastration. Wenzeslaus, der sich noch am sinnvollsten im Leben eingerichtet hat und dessen Lebensweisheiten zwar altbacken, aber anwendbar sind, wird durch seine komplette Lebensführung kompromittiert. Der Preis, den er für seine Freiheit und Mündigkeit zahlt, ist zu hoch. Er lebt ein Märtyrerleben für die bürgerliche Gesellschaft.
10. SCHLUSS
Im Ganzen erhält man den Eindruck, das sich die Verfehlungen des Adels und der Bürger die Waage halten und keine Seite für sich moralische Integrität beanspruchen kann. Man erkennt deutlich Lenz´ Alibiabsicht, die Bürger nicht in einem zu gutem Licht erscheinen zu lassen. Es geht nicht darum, einer Partei die Vorteile der Anderen zu zeigen. Vielmehr werden beiden die gemeinsamen Ursprünge und die Möglichkeit des gegenseitigen Nutzens vorgeführt. Eine Erfahrung des Dramas ohne Kraftmensch ist die, das die Menschen gleich sind und ihnen die selben Gefahren drohen. Zu dieser Überlegung gehört auch die Desavouierung, mit deren Hilfe Lenz die äußere Erscheinung bricht. Sie ist ein Mittel um die anderen Seiten der Figur ebenfalls darzustellen. Auch wenn sie hier meistens kompromittierend eingesetzt wird. Die Bloßstellungen sind ein nicht immer probates Mittel, aber sehr effektiv.
Es wird eine Gemeinschaft beschworen, mit der die gesellschaftlichen Probleme lösbar wären. Diese Gemeinschaft setzt sich aus allen Bevölkerungsschichten zusammen. So treten bei Lenz sämtliche Schichten in Erscheinung und die Schlußharmonie geschieht Stände und Schichten übergreifend. Der Kompromiß findet statt, nachdem die Figuren zur Räson gekommen sind . Die Wirklichkeit belehrt die Machthaber. Mit dem sozialpragmatischen Impetus sichert sich Lenz Einfluß auf die Gesellschaft. Er nutzt seine Möglichkeiten politisch zu arbeiten. Dabei stand nicht die Politik im Vordergrund, doch politisches Denken war fester Bestandteil der Kunst. Auch deshalb war Lenz gezwungen sein Stück anonym zu veröffentlichen. Lenz ist vergleichsweise politisch engagierter als der Großteil der Sturm und Drang Autoren. Er bemüht sich um eine Wirkung seiner Stücke, sie sollen Folgen haben. Bemerkenswert scheint mir besonders der Massenanspruch, also Lösungen für alle Schichten, anzubieten. Deshalb ist es nicht auszumachen wer im Zentrum dieses Dramas steht. Letztlich ist es die ganze Gesellschaft. Wenn Läuffer je im Zentrum des Stückes stand, so ist er es am Ende nicht mehr. Sein Name steht zumindest für Bewegung und in dieser verbleibt er bis zum Ende. Er verliert im Laufe des Stückes immer weiter an Bedeutung. Das Stück teilt sich auf verschiedene Handlungsplätze und unabhängige Handlungsstränge verlaufen parallel. Der Hofmeister wird systematisch aus dem Zentrum des Geschehens gerückt, die eigentlichen Prozesse finden im Haus des Majors von Berg statt. Aber es ist im eigentlichen Sinne kein Ende, vielmehr ein Abbruch der Übertragung. Ohne besondere Anstrengung kann man den Gang der Dinge weiterdenken.
LITERATURLISTE
-Lenz, Jacob Michael Reinhold: Werke und Briefe in drei Bänden. Sigird Damm(Hg.), Bd.I-III, Leipzig 1987.
-Lenz, Jacob Michael Reinhold: Der Hofmeister oder Vorteile der Privaterziehung. Husum/ Nordsee 1994.
-Lenz, Jacob Michael Reinhold: Anmerkungen übers Theater. Shakespeare-Arbeiten und Shakespeare-Übersetzungen. Stuttgart 1995.
-Lenz, Jacob Michael Reinhold: Erzählungen. Stuttgart 1996.
-Goethe, Johann Wolfgang: Aus meinem Leben - Dichtung und Wahrheit.
Hamburger Ausgabe, München 1998. Bd. 9/10
-Lessing, Gotthold E.: Werke 1767-1769. Frankfurt/Main 1985. Bd. 6
Sekundär:
-von Borries, Erika/Ernst: Aufklärung, Empfindsamkeit und Sturm und Drang. München 1991.
-Böckmann, P.: Formgeschichte der deutschen Dichtung. Hamburg 1949. Bd. I
-Barner, W./Grimm,G./Kiesel,H./Kramer, M.: Lessing Ein Arbeitsbuch den literaturgeschichtlichen Unterricht. München 1975.
-Damm, Sigrid: Vögel, die verkünden Land. Das Leben des J.M.R. Lenz. 3. korrigierte Auflage, Frankfurt/M.1989.
-Dictionary of Literary Biography-Volume 94: German Writers in the Age of Goethe: Sturm und Drang to Classizism. Gale Research Inc. Detroit1990.
-Huyssen, Andreas: Drama des Sturm und Drang. München 1980.
-Imamura, Takeshi: JMR Lenz `Seine dramatischer Technik und ihre Entwicklung´ St. Ingbert 1996.
-Kiesel, H./Münch P.: Gesellschaft und Literatur im 18. Jahrhundert. München 1977.
-Korff, H.A.: Die Dichtung von Sturm und Drang im Zusammenhange der Geistesgeschichte. (Reprint) New York/London 1972.
-Kohlenbach, Michael: Der Hofmeister. Synoptische Ausgabe. Handschrift und Erstdruck. Basel/Frankfurt 1986.
-Leidner, Alan C.: The Impatience Muse. Germany and the Sturm und Drang. The University of North Carolina Press, Chapel Hill and London 1994.
-Leidner, Alan C. and Madland, Helga S. (Hrsg.): Space to Act. The Theater of J.M.R. Lenz. Camden House, Inc., Columbia (USA), 1993.
-Madland, Helga S. Image and Text: J.M.R.Lenz. Amsterdamer Publikationen zur Sprache und Literatur. Amsterdam - Atlanta. GA 1994.
-Madland, Helga S.: Gesture as Evidence of Language Scepticism in Lenz´s Der Hofmeister and Die Soldaten. In: The German Quarterly. Vol. 54, No. 1. 1984.
-Mayer, Hans: Das unglückliche Bewußtsein. Zur deutschen Literaturgeschichte von Lessing bis heute. Frankfurt 1986.
-Orehovs, Ivars: J.M.R.Lenz Der Hofmeister. In: Ginkgobaum 12, 1993.
-Preuß, Werner Hermann: Selbstkastration oder Zeugung einer neuen Kreatur. Bonn 1983.
-Pascal, Roy: Der Sturm und Drang. Stuttgart 1977.
-Pfütze, Curt: Die Sprache in JMR Lenzens Dramen. Dissertatio Universität Leipzig 1890.
-Scherpe, Klaus R.: Dichterische Erkenntnis und `Projektemacherei‘. In: Sturm und Drang, Manfred Wacker(Hg.). Darmstadt 1985.
-Schlaffer, Heinz: Der Bürger als Held. Frankfurt/Main 1973.
-Schleef, Einar: Droge Faust Parzifal. Frankfurt/Main 1997.
-Schmidt, Henry J.: How Dramas End. Essays on the German Sturm und Drang, Büchner, Hauptmann, and Fleißler. The University of Michigan Press 1992.
-Schmidt, Erich: Lenz und Klinger. Zwei Dichter der Geniezeit. Berlin 1878.
-Stammler, Wolfgang: Der Hofmeister. Dissertation Halle 1908.
-Wurst, Karin A.: J.R.M. Lenz als Alternative. Köln, Weimar, Wien 1992.
-von Wiese, Benno: Deutsche Dichter des 18. Jahrhunderts. Berlin 1977.
[...]
[1] J. Jacobs "Prosa der Aufklärung" München 1976. S.16
[2] H. Schlaffer "Der Bürger als Held" Frankfurt/Main 1973. S.140
[3] H.A. Korff "Die Dichtung des Sturm und Drang im Zusammenhange der Geistesgeschichte" (Reprint), New York/London 1972.
[4] R. Pascal "Der Sturm und Drang" Stuttgart 1977. S.74
[5] Arnold Hauser ”Sozialgeschichte der Kunst und Literatur” München 1990. S.635
[6] Lenz "Der neue Menoza" (II,6) In: "Werke und Briefe in 3 Bänden" Hg. S. Damm, Bd. I, Leipzig 1987.
[7] Alan C. Leidner "The impatient muse" London 1994. S.48
[8] zu dieser Einteilung: A. Huyssen "Drama des Sturm und Drang" München 1980. S.78
[9] A.C.Leidner S. 47
[10] Vor allem: Götz, Karl Wild, Karl Moor In der Erzählung "Der Landprediger" führt Lenz diese Konstellation exemplarisch am Selbsthelfer Joseph Mannheim aus.
[11] Als deus ex machina Lösung erscheint mir der Lotteriegewinn Pätus´ in Sz.
[12] Klaus R. Scherpe "Dichterische Erkenntnis und `Projektemacherei´" In: M. Wacker "Sturm und Drang" Darmstadt 1985. S. 282
[13] H.A. Korff, S. 49
[14] A.A.C. Earl of Shaftesbury "Soliloquy: or, Advice to an Author and Charakteristics of Men, Manners, Opinions, Times." erschienen: Glouchester 1710.
[15] Lenz "Anmerkungen zum Theater" (Erstdruck 1774) In: "Werke" Bd. II, S. 648
Der wahre Dichter "nimmt Standpunkt" und schafft wie die "kleinen Götter" seine eigene Welt.
[16] Lenz "Anmerkungen" S. 654 In: "Werke und Briefe in 3 Bänden" Hg. S.Damm, Bd. II, Leipzig 1987.
[17] Lenz "Anmerkungen" S. 648
[18] siehe die Verweise auf erschienene Bücher, sowie der Türkenkrieg 1768-74
[19] Peter von Matt, Seminarpapier, Universität Zürich SS 99
[20] "Deutsche Literaturgeschichte" Stuttgart 1992. S.134
[21] Lenz "Anmerkungen" S. 669
[22] A. Huyssen "Drama des Sturm und Drang" München 1980. S.115
[23] Lenz "Pandemonium Germanicum" In: "Werke" Bd. I, S. 269
[24] der Major, der Geheime Rat, die Studenten, Majorin
[25] die Kastration (V,3), Pätus wirft das Kaffeeservice aus dem Fenster (II,3) Hofm.; Seraphine versenkt das Juwelenkästchen im Hafen von Marseille (II,1) Die Freunde machen den Philosophen
[26] Klingers phantastische Ortswahl, Kampfbeschreibungen oder der überdimensionaler Held Karl Wild in "Sturm und Drang"
[27] u.a. Bildungsreform im Hofmeiser, Soldatenehen in den Soldaten
[28] die "Fontanelle" (II,6)
[29] A.C. Leidner, S. 105
[30] Pätus wirft das Kaffeeservice aus dem Fenster, weil er nach der Bemerkung Fritz´ entdeckt, daß der Kaffee nach Gerste schmeckt. (II,3) die "lächerliche Seite" des Majors (II,6), Wenzeslaus Reaktion auf Läuffers Kastration (IV,3)
[31] Lenz Werke Bd. I, Anmerkungsapparat zum "Hofmeister" S. ??
[32] J.W. Goethe ”Dichtung und Wahrheit” München 1998. Bd. 10, 14. Buch, S.8
[33] H. Mayer, S.121
[34] v.a. in folgenden Szenen: (I,6), (III,3) und (IV,9)
[35] In Gegenwart des Grafen steigt der Lohn des Hofmeisters schlagartig auf 500 Dukaten.(II,3) Dem Graf selbst sind 600 Austern und 20 Flaschen Champagner "recht gut bekommen" (II,6)
Häufig gestellte Fragen zu Jakob Michael Reinhold Lenz' "Der Hofmeister"
Was ist das Hauptziel dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit analysiert die Figuren in Jakob Michael Reinhold Lenz' Drama "Der Hofmeister oder die Vortheile der Privaterziehung". Sie untersucht, wie Lenz' Figuren paradigmatisch für seine weiteren Stücke sind und sich von den Intentionen der Aufklärer und dem Menschenbild des Sturm und Drang unterscheiden.
Welche Ziele verfolgte die literarische Bewegung des Sturm und Drang?
Der Sturm und Drang war Teil der Aufklärung, forderte politische Ziele in radikalisierter Form ein und wollte das monarchische System modifizieren. Die Autoren betonten Subjektivität und Emotionalität, wobei die Gesellschaft aus frei entfalteten Individuen bestehen sollte, deren Zusammenhalt gefühlsmäßig ist.
Wie unterscheidet sich das Menschenbild des Sturm und Drang von dem der Aufklärung?
Im Sturm und Drang wurde der Kraftmensch geschaffen und propagiert. Es entstand ein Typus von Protagonisten, der von Ehrgeiz und Rache zu Gewalttaten getrieben wird. Die neuen Menschen sollten weniger von Vernunft als von Emotion und subjektivem Empfinden geleitet werden.
Welche Rolle spielt der "Kraftmensch" im Werk von Lenz?
Lenz schuf in seinen großen Dramen keinen Kraftmenschen. Seine Stücke sind realistische Zeitstücke, in denen der Entwurf einer derartigen Person nicht durchzuhalten war. Lenz betrieb einen beträchtlichen Aufwand, um nicht zu einer Selbsthelferlösung zu gelangen.
Was versteht man unter dem "sozialpragmatischen Impetus" bei Lenz?
Der sozialpragmatische Impetus ist Lenz' Bemühung, mit seinen Dramen auf die Gegenwart Einfluss zu nehmen. Das Ziel war, den Dialog zwischen den Ständen zu initiieren. Er griff damit voraus auf die "sozialrevolutionären" Ansprüche und Themen der Mainzer Republikaner, Büchners und des jungen Deutschlands.
Wie stellt Lenz die Machtdemonstrationen des Adels dar?
Lenz widmet sich den Machtstrukturen innerhalb des Hauses von Berg mit besonderer Sorgfalt. Er zeigt den Despotismus des Adels auf elementarster Kommunikationsebene, indem er Frechheit, Respektlosigkeit, Dummheit und gespielte Naivität verwendet, um allgemeingültige Konsens zu untergraben.
Was ist das Besondere an den Figuren in Lenz' "Hofmeister"?
Die Figuren geben einen Teil ihres bisherigen Selbstverständnisses auf und erklären, Veränderungen in ihren Leben vorzunehmen. Lenz vermittelt den Zuschauern die Unzulänglichkeit der Personen und ihrer Standpunkte, indem er sie in widersprüchliche Situationen verwickelt. Es geht darum, Alternativen zu den gesellschaftlichen Verhältnissen zu suchen.
Welche Rolle spielt Läuffer im Drama?
Der Hofmeister Läuffer wird auf traurige Art eingeführt, wobei seine Schwächen unmissverständlich ausgestellt werden. Er wird zum "artigen Männichen" komprimiert, das harmlos und zur Revolte unfähig ist. Seine vollständige Blamage und Demontage wird im Laufe des Stücks deutlich.
Wie wird der Adel in Lenz' "Hofmeister" dargestellt?
Das Stück intendiert primär eine Belehrung des Adels, da er durch seine Machtposition die Gegenwart gestaltet. Die Majorin und der Major werden in ihrer ländlichen Einfältigkeit gezeigt, wobei der Major eine gewisse Lernfähigkeit besitzt. Der Adel wird in tätige und untätige Kategorien unterteilt, je nach Bereitschaft zum fortschrittlichen Umdenken.
Welche Bedeutung hat die Figur Wenzeslaus im Kontext des Bürgertums?
Wenzeslaus ist die Karikatur des aufgeklärten Bürgers, der mit der Reglementierung seines Daseins aus den Prinzipien der Vernunft sein menschliches Leben eingebüßt hat. Er verkörpert die bürgerliche Arbeitsmoral und emanzipiert sich vom Adel, jedoch auf Kosten seines Körpers.
Welchen Schluss zieht die Hausarbeit über "Der Hofmeister"?
Die Hausarbeit kommt zu dem Schluss, dass sich die Verfehlungen des Adels und der Bürger die Waage halten und keine Seite für sich moralische Integrität beanspruchen kann. Das Drama vermittelt, dass die Menschen gleich sind und ihnen die selben Gefahren drohen. Die Desavouierung ist ein Mittel, um die anderen Seiten der Figur darzustellen. Lenz bemüht sich um eine Wirkung seiner Stücke und bietet Lösungen für alle Schichten der Gesellschaft an.
- Quote paper
- Hinrich Katsumian (Author), 1998, Die Figurenkonzeption in J.M.R.Lenz "Der Hofmeister", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108474