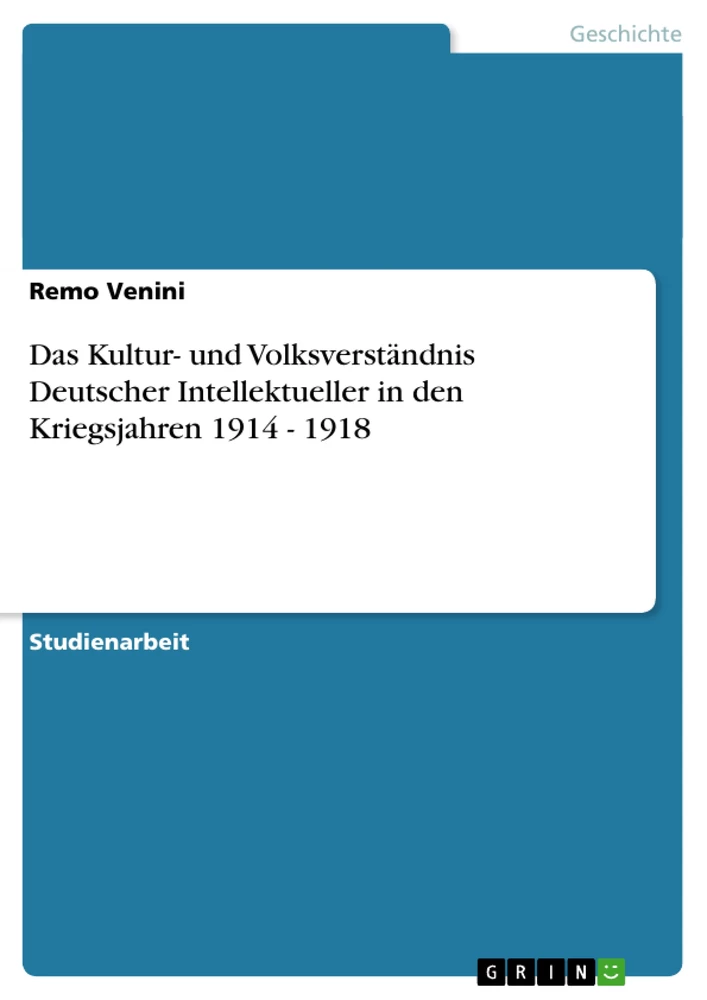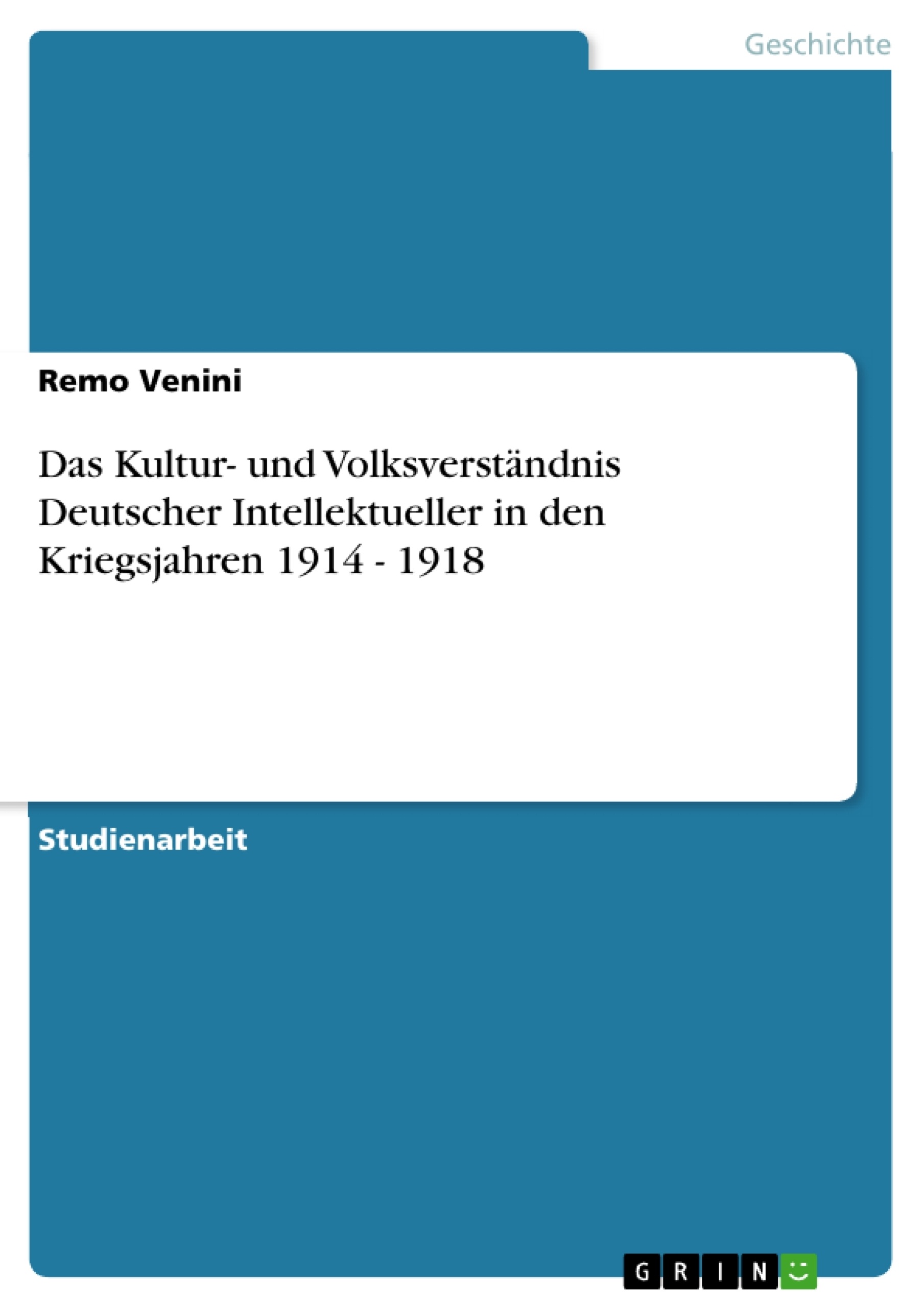Kriege beginnen häufig in den Köpfen - so auch bei Weltkriegen.
Im Vorfeld des 1. Weltkrieges griffen daher führende Intellektuelle zum Stift, um den Gegner zu diffarmieren. Begriffe wie Zivilisation, Kultur und Volk wurden wild herumgeschleudert. Das erhoffte Ziel dieser deutschen Intellektuellen war es, den Gegner geistig/moralisch niederzuringen, um dann im Gegenzug das eigene, deutsche Volk zu überhöhen.
Die vorliegende Proseminararbeit versuchte, die Bedeutung der Begriffe Kultur, Zivilisation und Volk gemäss den Quellen zu rekonstruieren - warum war die deutsche Kultur der französischen/englischen überlegen und was zeichnet das Volk aus?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Lethargie und Neubeginn - Eine Übersicht der möglichen Ursachen des Kriegsausbruches
- 2.1. Allgemein
- 2.2. Kultur
- 3. Der deutsche Kulturbegriff
- 3.1. Die Merkmale der deutschen Kultur
- 3.1.1. Überlegenheit
- 3.1.2. Die deutsche Freiheit - Der innere Frieden
- 3.1.3. Bildung
- 3.1.4. Diverse
- 3.2. Der Zweck der deutschen Kultur
- 3.1. Die Merkmale der deutschen Kultur
- 4. Das deutsche Volk
- 4.1. Stimmen der Bewunderung und der Verachtung
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Kultur- und Volksverständnis deutscher Intellektueller in den Jahren 1914-1918. Sie analysiert die Merkmale des deutschen Kulturbegriffs, seinen Zweck und die Beschreibung des deutschen Volkes durch Intellektuelle dieser Zeit, unter Berücksichtigung sowohl positiver als auch negativer Aspekte.
- Der deutsche Kulturbegriff und seine Merkmale
- Der Zweck und die Funktion der deutschen Kultur
- Das Verständnis des deutschen Volkes durch Intellektuelle
- Die Rolle der Kultur im Kontext des Ersten Weltkriegs
- Mögliche Ursachen des Kriegsausbruches
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschreibt den Wandel der „Zivilisationskritik“ in den „Kulturkrieg“ und die Bedeutung der Begriffe „Kultur“ und „Volk“ in der Rechtfertigung des Krieges. Das Kapitel über die Ursachen des Kriegsausbruches beleuchtet sowohl allgemeine Faktoren wie imperialistische Bestrebungen und militärische Aufrüstung als auch kulturpessimistische Strömungen. Die darauffolgenden Kapitel untersuchen die Merkmale des deutschen Kulturbegriffs (Überlegenheit, Freiheit, Bildung etc.) und den Zweck, dem die deutsche Kultur dienen sollte. Abschließend wird das Verständnis des deutschen Volkes durch die Intellektuellen der Zeit behandelt.
Schlüsselwörter
Deutscher Kulturbegriff, Erster Weltkrieg, Intellektuelle, Nationalismus, Volksverständnis, Zivilisationskritik, Kulturkrieg, Imperialismus.
- Arbeit zitieren
- Remo Venini (Autor:in), 2003, Das Kultur- und Volksverständnis Deutscher Intellektueller in den Kriegsjahren 1914 - 1918, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108561