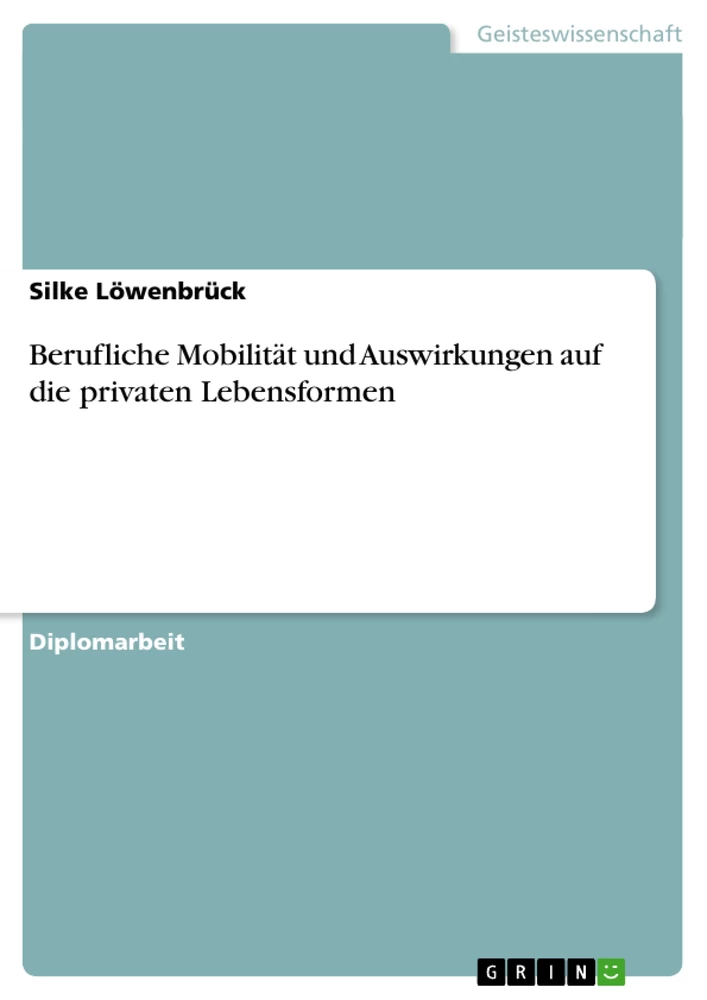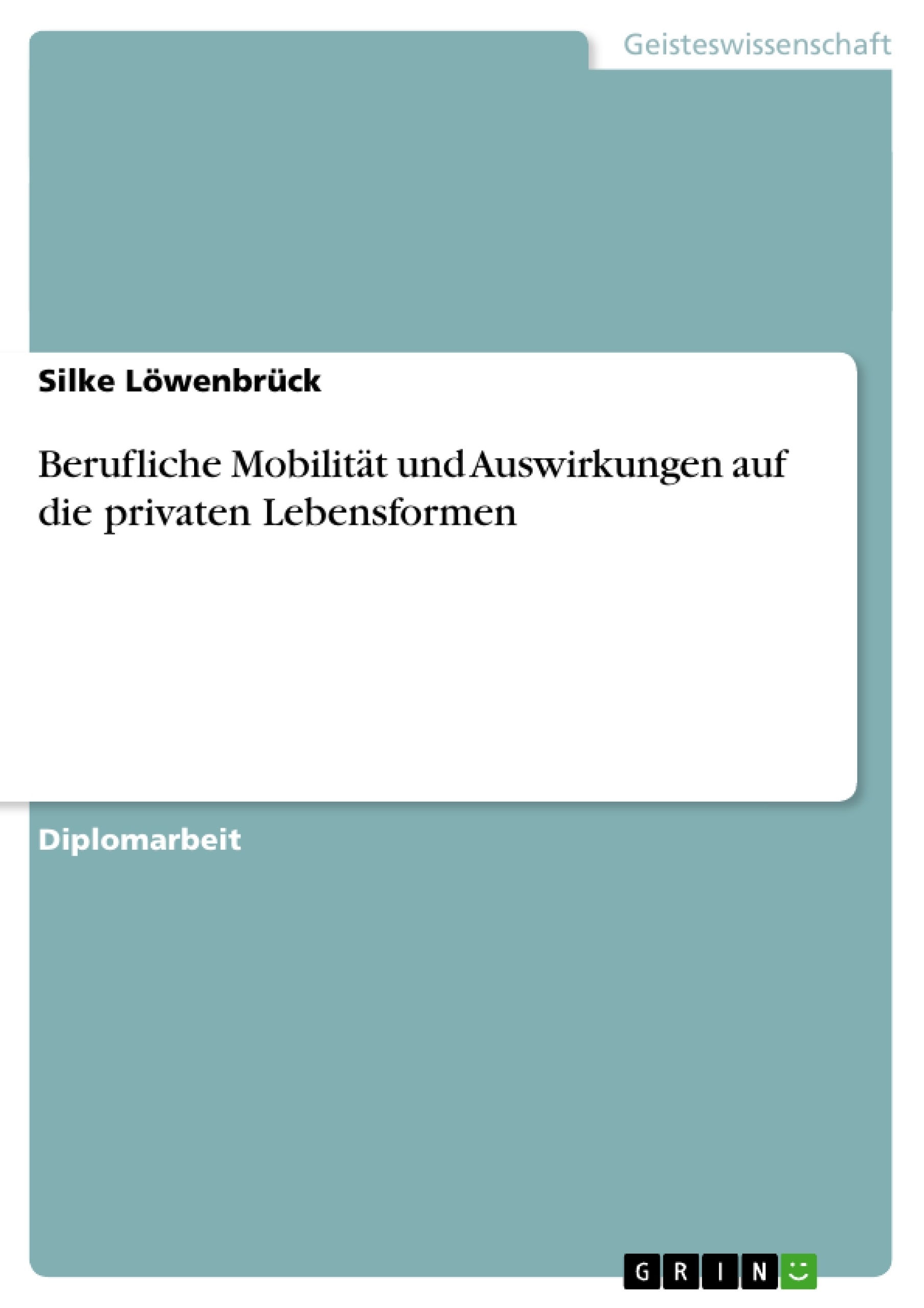In unserer heutigen Arbeitswelt scheinen - nicht zuletzt durch die erst kürzlich verfassten Reformpläne von Peter Hartz - die Anforderungen an Arbeitnehmer stetig zu steigen. Meine Diplomarbeit beschäftigt sich mit einem weit verbreiteten, aber wenig wahrgenommenen Thema: der beruflichen Mobilität. Nach Angaben des Soziologen Norbert Schneider ist jeder sechste Beschäftigte, der in einer Partnerschaft oder Familie lebt, aus beruflichen Gründen mobil. Unter Singles dürfte der Anteil noch weitaus höher liegen. Die Forderung nach Mobilität ist in aller Munde, doch es genügt schon lange nicht mehr, lediglich die Auswirkungen auf wirtschaftlicher und arbeitsmarktpolitischer Ebene zu betrachten. Ich will in dieser Arbeit den Fragen nachgehen, wie Mobilität im Beruf die Menschen beeinflusst und wie sie ihr Leben prägt. Wer ist überhaupt betroffen und welche Gründe gibt es für ein mobiles Verhalten? Wie wirkt sich berufliche Mobilität auf die Entwicklung und die Persönlichkeit des Individuums aus und welche Folgen hat die Situation für die Partnerschaft und die Familie? Um die gesellschaftliche Bedeutung von Mobilität besser verstehen zu können, sollte man sich darüber bewusst werden, dass daraus ganz neue, manchmal unkonventionelle Lebensformen entstanden sind, die es in dieser Form vor einigen Jahrzehnten noch nicht gab. Die rasant steigende Anzahl dieser "neuen" mobilen Lebensformen ist Grund genug, sich eingehender und intensiver mit diesem Phänomen zu beschäftigen. Es gab in den vergangenen Jahren schon eine Reihe von Forschungen, die sich vor allem mit der Situation von Pendlern auseinander setzten (vgl. u.a. Erich Ott, 1990, 1992), doch erst in den letzten Monaten wurde damit begonnen, umfassendere Studien zu erarbeiten, die Mobilität als ganzheitliches Erscheinungsbild untersuchen. Die Studie "Berufsmobilität und Lebensform", die unter der Leitung von Norbert F. Schneider an den Universitäten Bamberg und Mainz durchgeführt wurde, geht zum ersten Mal detailliert auf die Erscheinungsformen, Gründe und Auswirkungen von beruflicher Mobilität ein und dient mir beim Erstellen dieser Arbeit als Anhaltspunkt und Grundlage. Der Schwerpunkt meiner [...]
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Berufliche Mobilität
- Definition
- Räumliche Mobilität
- Soziale Mobilität
- Mobilität im geschichtlichen Kontext
- Definition
- Warum sind Menschen mobil?
- Gründe für Mobilität
- Der Prozess der Entscheidungsfindung
- Einflüsse auf die Entscheidung
- Mobilitätsfördernde und –hemmende Aspekte
- Auswirkungen der Berufsmobilität auf die privaten Lebensformen
- Die Entstehung neuer Lebensformen
- Fernpendler
- Shuttles
- Getrennt Zusammenlebende
- Varimobile
- Umzugsmobile
- Die Entstehung neuer Lebensformen
- Psychosoziale Folgen für Betroffene
- Individuell erlebte Vor- und Nachteile
- Auswirkungen auf die Partnerschaft
- Auswirkungen auf die Familienplanung und das Familienleben
- Vereinbarkeit von Berufsmobilität und Familie
- Organisation des Alltags
- Zukunftsaussichten der Betroffenen
- Unterstützung und Entlastung für beruflich Mobile
- Wünsche und Anregungen von Betroffenen
- Bestehende Ansätze und Leistungen
- Leistungen des Arbeitgebers
- Verbesserungen in Politik und Wirtschaft
- Ideen und Innovationen
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Auswirkungen beruflicher Mobilität auf private Lebensformen. Die Arbeit analysiert verschiedene mobile Lebensformen, ihre Ursachen und die daraus resultierenden psychosozialen Folgen für die Betroffenen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Betrachtung von Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten.
- Definition und Abgrenzung verschiedener mobiler Lebensformen (Fernpendler, Shuttles, getrennt Zusammenlebende, Varimobile, Umzugsmobile)
- Analyse der Gründe für berufliche Mobilität und die Entscheidungsfindungsprozesse
- Untersuchung der psychosozialen Auswirkungen auf Individuen, Partnerschaften und Familien
- Bewertung bestehender und gewünschter Unterstützungsmaßnahmen durch Arbeitgeber, Politik und Gesellschaft
- Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen und Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Die Arbeit entstand aus dem Interesse an nicht-traditionellen Lebensformen und konzentriert sich schließlich auf die Untersuchung der Ursachen und Konsequenzen beruflicher Mobilität und der daraus resultierenden Lebensmodelle.
Einleitung: Die Einleitung präsentiert das Thema berufliche Mobilität als ein weit verbreitetes Phänomen, dessen Auswirkungen über die wirtschaftliche Ebene hinausreichen und die privaten Lebensformen stark beeinflussen. Die Arbeit untersucht die Gründe für Mobilität, deren Auswirkungen auf Individuen, Partnerschaften und Familien sowie die gesellschaftliche Bedeutung neuer mobiler Lebensformen.
Berufliche Mobilität: Dieses Kapitel definiert berufliche Mobilität als Wechsel von Positionen in der Arbeitswelt und Anpassung an veränderte Bedingungen. Es differenziert zwischen räumlicher und sozialer Mobilität und beleuchtet die historische Entwicklung des Phänomens, von eingeschränkter Mobilität im Mittelalter bis hin zur heutigen Forderung nach Flexibilität und Mobilität auf dem Arbeitsmarkt.
Warum sind Menschen mobil?: Dieser Abschnitt erörtert die Gründe für berufliche Mobilität, differenziert zwischen freiwilligen und unfreiwilligen Entscheidungen und analysiert die Einflüsse auf die Entscheidungsfindung, sowohl individuelle Faktoren als auch externe Gegebenheiten. Der Einfluss von Qualifikation, Arbeitslosigkeit und technologischem Fortschritt auf die Mobilitätsbereitschaft wird diskutiert, ebenso wie mobilitätsfördernde und -hemmende Aspekte.
Auswirkungen der Berufsmobilität auf die privaten Lebensformen: Hier werden verschiedene neue Lebensformen im Kontext beruflicher Mobilität beschrieben und analysiert. Die Kapitel untersuchen Fernpendler, Shuttles, getrennt Zusammenlebende, Varimobile und Umzugsmobile hinsichtlich ihrer Merkmale, Ursachen und Auswirkungen auf das Privatleben.
Psychosoziale Folgen für Betroffene: Dieser Abschnitt beleuchtet die individuell erlebten Vor- und Nachteile verschiedener mobiler Lebensformen, differenziert nach den Bereichen Beruf, soziale Kontakte und Persönlichkeit. Die Auswirkungen auf Partnerschaften und Familien werden im Detail analysiert, wobei die Themen Familienplanung, Organisation des Alltags und die Vereinbarkeit von Berufsmobilität und Familie im Vordergrund stehen.
Unterstützung und Entlastung für beruflich Mobile: Dieses Kapitel behandelt die Wünsche und Anregungen beruflich mobiler Menschen nach Unterstützung und Entlastung. Es analysiert bestehende Ansätze und Leistungen von Arbeitgebern, Politik und Gesellschaft und präsentiert innovative Ideen und Initiativen zur Verbesserung der Situation.
Schlüsselwörter
Berufliche Mobilität, Lebensformen, Fernpendler, Shuttles, getrennt Zusammenlebende, Varimobile, Umzugsmobile, Partnerschaft, Familie, Vereinbarkeit, Psychosoziale Folgen, Unterstützung, Entlastung, Arbeitsmarkt, Globalisierung, Individualisierung.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Auswirkungen beruflicher Mobilität auf private Lebensformen
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Auswirkungen beruflicher Mobilität auf private Lebensformen. Sie analysiert verschiedene mobile Lebensformen, ihre Ursachen und die daraus resultierenden psychosozialen Folgen für die Betroffenen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Betrachtung von Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten.
Welche mobilen Lebensformen werden untersucht?
Die Arbeit analysiert detailliert verschiedene mobile Lebensformen, darunter Fernpendler, Shuttles (Paare mit räumlich getrennten Arbeitsplätzen), getrennt Zusammenlebende, Varimobile (Personen mit stark variierenden Wohnorten) und Umzugsmobile (Personen, die häufig umziehen).
Welche Gründe für berufliche Mobilität werden betrachtet?
Die Arbeit erörtert die Gründe für berufliche Mobilität, differenziert zwischen freiwilligen und unfreiwilligen Entscheidungen und analysiert die Einflüsse auf die Entscheidungsfindung. Berücksichtigt werden individuelle Faktoren sowie externe Gegebenheiten wie Qualifikation, Arbeitslosigkeit und technologischer Fortschritt.
Welche psychosozialen Folgen werden untersucht?
Die Arbeit beleuchtet die individuell erlebten Vor- und Nachteile verschiedener mobiler Lebensformen, differenziert nach den Bereichen Beruf, soziale Kontakte und Persönlichkeit. Die Auswirkungen auf Partnerschaften und Familien werden im Detail analysiert, inklusive der Themen Familienplanung, Organisation des Alltags und der Vereinbarkeit von Berufsmobilität und Familie.
Welche Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten werden betrachtet?
Die Arbeit behandelt die Wünsche und Anregungen beruflich mobiler Menschen nach Unterstützung und Entlastung. Sie analysiert bestehende Ansätze und Leistungen von Arbeitgebern, Politik und Gesellschaft und präsentiert innovative Ideen und Initiativen zur Verbesserung der Situation.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in ein Vorwort, eine Einleitung, Kapitel zu beruflicher Mobilität, den Gründen für Mobilität, den Auswirkungen auf private Lebensformen, den psychosozialen Folgen, Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten und einen Ausblick. Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Berufliche Mobilität, Lebensformen, Fernpendler, Shuttles, getrennt Zusammenlebende, Varimobile, Umzugsmobile, Partnerschaft, Familie, Vereinbarkeit, Psychosoziale Folgen, Unterstützung, Entlastung, Arbeitsmarkt, Globalisierung, Individualisierung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, die sich mit beruflicher Mobilität, soziologischen Aspekten des Arbeitsmarktes, Familienforschung und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie befassen. Sie bietet auch wertvolle Einblicke für Arbeitgeber, politische Entscheidungsträger und alle Personen, die von beruflicher Mobilität betroffen sind.
- Quote paper
- Silke Löwenbrück (Author), 2003, Berufliche Mobilität und Auswirkungen auf die privaten Lebensformen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10856