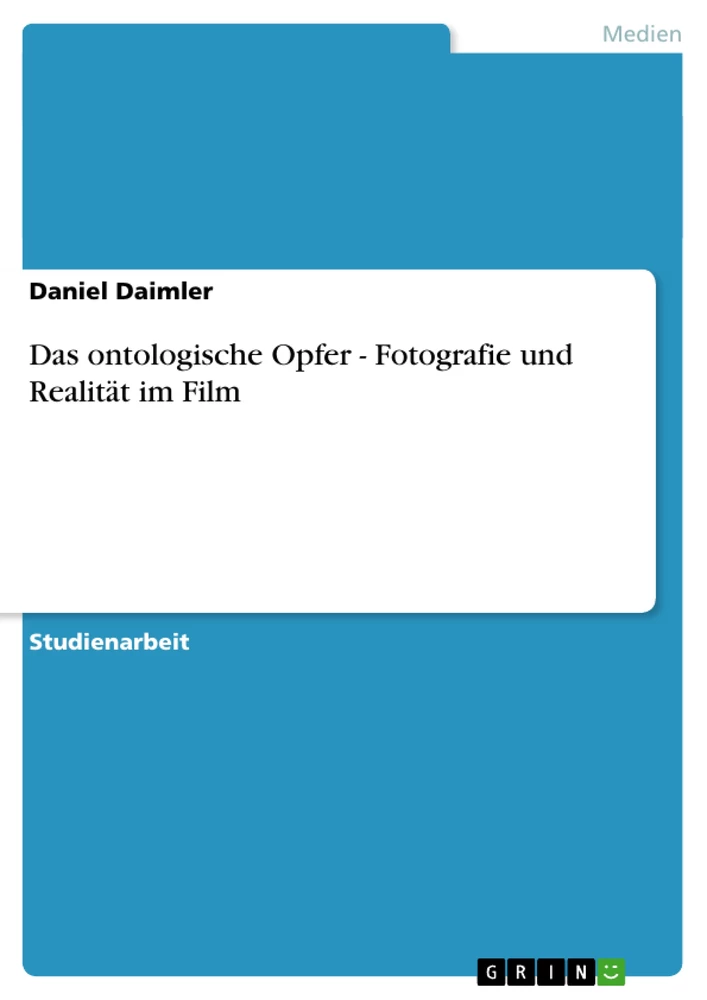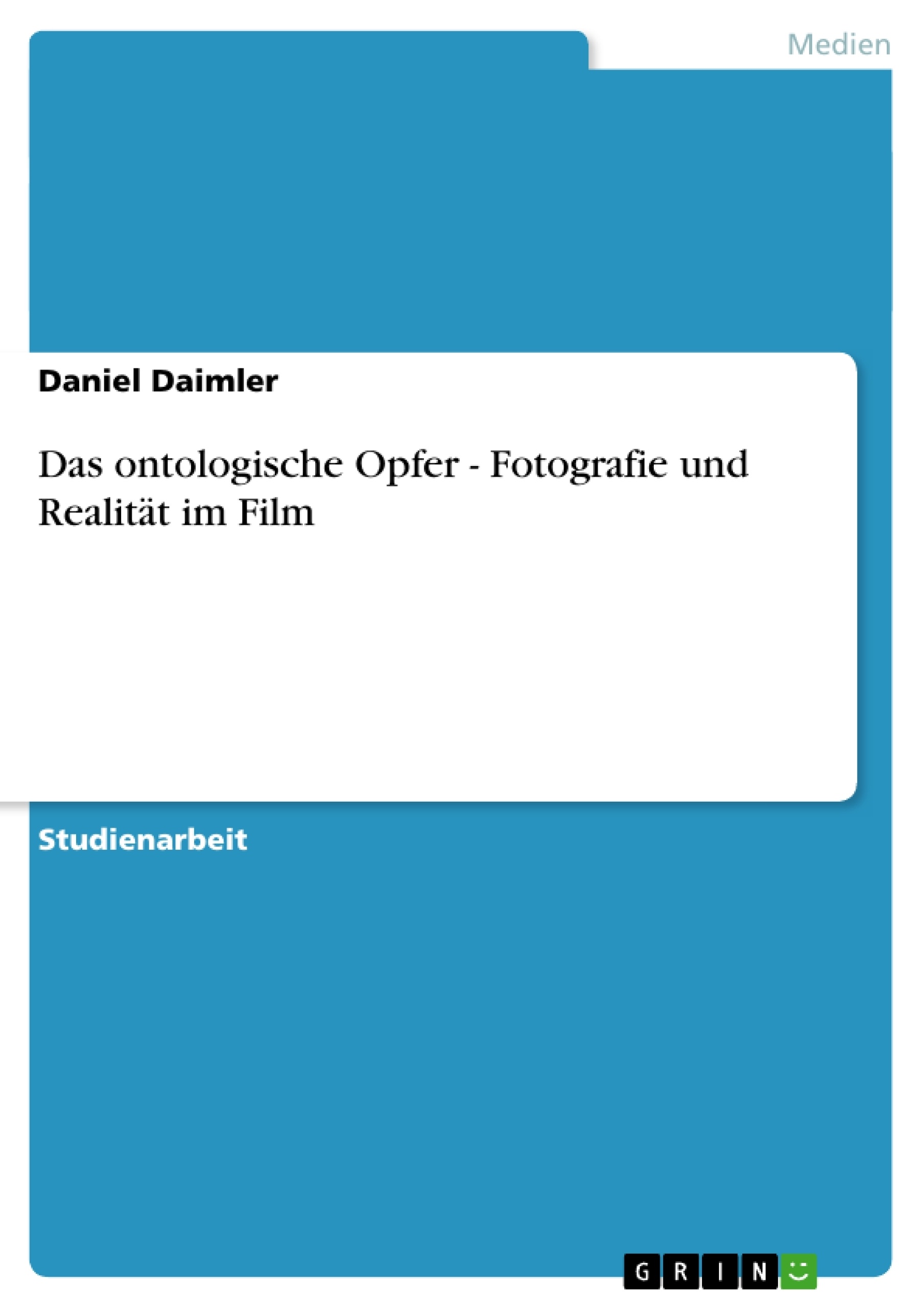Inhalt
1 Der fotografische Schuß
2 Der Garten der Wahrheit
2.1 Fotografie als Fetisch
2.2 In dubio contra reo
2.3 „Tun wir, als wären wir blind“
3 Fotografie und Realität im Film
4 Bibliographie
1 Der fotografische Schuß
There is an aggression implicit in every use of the camera.
Susan Sontag (2002: 7)
Im Jahre 1882 entwarf der Mediziner Etienne Jules Marey die sogenannte „fusil photographique“ (die fotografische Flinte), eine Apparatur, die in der Lage war, 12 Bilder pro Sekunde bei einer Belichtungszeit von 1/720 Sekunde zu fixieren und damit nahe an die Leistung einer modernen Filmkamera herankam. Marey nannte sein Verfahren „Chronophotografie“ und nutzte es zum „Sichtbarmachen des Unsichtbaren“ (photokina 1974: 16), wie beispielsweise der Bewegungsabläufe eines Boxers oder eines Radfahrers. Damit leistete Marey neben anderen primär wissenschaftlich motivierten Fotografen wie Eadweard Muybridge oder Pierre Jules César Janssen einen entscheidenen Beitrag zur Entwicklung der modernen Kinematografie.
Das eigentlich Bemerkenswerte an Mareys Erfindung ist aber ihre ausgeprägte Ähnlichkeit in Form und Handhabung zu einer Schußwaffe: der Fotograf legt die fotografische Flinte an, indem er den Kolben fest gegen seine Schulter presst, erfaßt sein Motiv (nicht durch das Zielfernrohr, sondern direkt durch den Lauf) und drückt den Abzug. Zum einen gibt Marey damit gewissermaßen der lexikalischen Semantik der zeitgenössischen Foto- und Kinematografie (vgl. „shot“ oder „8, 16 oder 35 mm“ als Kaliberformat des fotografischen Schusses) eine etymologische Grundlage, zum anderen entblößt er damit die grundsätzliche Beziehung zwischen dem fotografischen Subjekt und dem fotografischen Objekt. Roland Barthes sieht diese Beziehung über den Zusammenhang der Fotografie mit dem Theater vermittelt:
Die ursprüngliche Beziehung zwischen Theater und Totenkult ist bekannt: die ersten Schauspieler sonderten sich von der Gemeinschaft ab, indem sie die Rolle der Toten spielten... Die gleiche Beziehung finde ich nun in der Photographie wieder, auch wenn man sich bemüht in ihr etwas Lebendiges zu sehen..., so ist die Photographie... eine Art von „Lebendem Bild“: die bildliche Darstellung des reglosen, geschminkten Gesichtes, in der wir die Toten sehen.
(Barthes 1985: 13; Herv. im Original)
Die implizite Aggression, die im Sinne Susan Sontags jedem fotografischen Akt innewohnt, fordert somit stets ihr ontologisches Opfer ein: so wie die Schußwaffe das beschossene Objekt i.d.R. aus der Realität seines raumzeitlichen Kontextes herausreißt, d.h. tötet, reißt die fotografische Flinte das fotografische Objekt aus der Kontinuität und damit aus der Endgültigkeit seines raumzeitlichen Kontextes heraus, denn von diesem Augenblick an existiert ein wiederholbares, erinnerbares Abbild der Situation. Neben die genannte Sichtbarmachung des Unsichtbaren tritt also das Festhalten des Unhaltbaren.
Filme wie The Public Eye (Howard Franklin, 1992) bedienen sich genau dieser Analogie zwischen Schußwaffe und Fotoapparat: In der Restaurant-Sequenz von The Public Eye erhält der Protagonist, Bernzini, die Gelegenheit, eine Massenhinrichtung unter Gangstern zu fotografieren und damit eine politische Intrige aufzudecken. Als er von einem Gangster entdeckt und mit einer Schrotflinte bedroht wird, erwidert er diese Bedrohung mit seiner Kamera: hier entblößt sich tatsächlich eine Schuß-Gegenschuß-Situation.
Die Sichtbarmachung des Unsichtbaren und das Festhalten des Unhaltbaren werden in filmischen Texten aber nicht ausschließlich über das Motiv der Destruktion vermittelt: Fotografie kann die Wirklichkeit manipulieren, so in dem Film Under Fire (Roger Spottiswoode, 1983), in dem ein toter lateinamerikanischer Rebellenführer mittels eines Fotos wieder aufersteht. Fotografie kann die Wirklichkeit aber auch konstruieren, indem sie die Endgültigkeit der menschlichen Wahrnehmung hinterfragt und an ihre Stelle einen Kontrakt des Vertrauens stellt, wie beispielsweise in dem Film Proof (Jocelyn Moorhouse, 1991): der verbitterte und von Geburt an sehbehinderte Protagonist Martin fristet ein recht abgeschiedenes Dasein im australischen Melbourne. Seine einzigen Bezugspunkte sind sein Hund Bill, seine Haushälterin Celia, mit welcher ihn eine symbiotische Haßliebe verbindet und der Fotoapparat, den er im Alter von zehn Jahren von seiner schwerkranken Mutter geschenkt bekommen hat. Als Martin den Kellner Andy kennenlernt, entwickelt sich eine delikate Dreiecksbeziehung, in deren Mittelpunkt die Fotografie den Primärschlüssel zu Wissen, Wahrheit und Vertrauen darstellt.
Die vorliegende Arbeit will versuchen, das Phänomen der Konstruktion von Wirklichkeit durch Fotografie im Film zu untersuchen, indem sie es am Beispiel des Filmes Proof unter der besonderen Berücksichtigung von strukturellen Zusammenhängen analysiert. Dadurch sollen folgende Hypothesen auf ihre Verankerungen im filmischen Text hin überprüft werden:
- In Martins Welt ist der fotografische Apparat nicht lediglich eine Prothese für das „nutzlose Gewebe“ seiner Augen, sondern der fotografische Akt vielmehr ein Fetisch zum Ausgleich der existentiellen Unvollständigkeit, aus der sich Martins Minderwertigkeitsgefühle ableiten. Kapitel 2.1 interpretiert Martins Fotografie als ein Instrument zur ontologischen Vervollständigung und wagt einen Vergleich mit dem Fetischismusbegriff in der Ethnologie und in der Psychoanalyse.
- Martins Realität ist ein Indizienprozess in dubio contra reo, dem ein sehr privates und dennoch heteronomes Zeichensystem zu Grunde liegt. Kapitel 2.2 analysiert dieses System und identifiziert das fotografische Abbild als seine kleinste bedeutungskonstituierende Einheit.
- Der Film entwickelt seine Story nicht nur über den Zusammenhang von Wissen und Sehen, sondern insbesondere auch über die Beziehung zwischen Nicht-Wissen und Nicht-Sehen. In diesem Spannungsverhältnis entfaltet sich die Eifersucht als das maßgebliche Handlungsmotiv in der Figurenkonstellation von Martin, Andy und Celia. Kapitel 2.3 untersucht die Verknüpfung von empirischem und fotografischem Off im filmischen Text und ihre Auswirkungen auf die erschlossene Geschichte des Filmes.
Kapitel 3 der vorliegenden Arbeit wird die Ergebnisse der Analyse verdichten und sie in einer kurzen abschließenden Diskussion der Thematisierung von Fotografie und Realität im Film gegenüberstellen.
2 Der Garten der Wahrheit
[Andy]: Ist das so wichtig, die Wahrheit über einen Garten?
[Martin]: Ja – das war meine Welt.
Hinter dem recht minimalistisch anmutenden Erzählstil von Proof erschließt sich dem aufmerksamen Leser ein vielschichtiges Gefüge von Verweisen auf das mediale Lexikon der abendländischen Kultur, beispielsweise durch die Anordnung eines blinden Konzertbesuchers in dem Klangraum eines tauben Komponisten, wenn Celia Martin mit einem Foto zum Besuch von Beethovens Neunten „zwingt“. Die zentrale Position in dieser Mediagrafie nimmt aber das Motiv des Gartens ein, das im filmischen Text einerseits mit dem Blick aus dem Fenster (als Anspielung auf den biblischen Raum der Erkenntnis) verankert ist und andererseits mit dem Stadtpark (als Raum der Beweisaufnahme) den Film Blow Up (Michelangelo Antonioni, 1966) zitiert.
Schließlich sind es aber die Fotografien dieser beiden Räume, welche die narrative Dynamik des Filmes determinieren. Das Foto des Gartens aus Martins Vergangenheit schließt den Kreis von Exposition und Resolution und wird von ihm als das wichtigste Foto von allen in einem Safe aufbewahrt. Das Foto, das Martin im Park macht, um seinen Hund Bill aufzuspüren, initiiert die Komplikation, indem es Andy zur Lüge und Celia zum Geständnis veranlaßt.
Eine vollständige Analyse der filmischen Räume im Lichte der biblischen Erzählung vom Garten Eden (insbesondere unter Berücksichtigung des Baumes, hinter den sich Andy vor dem fotografischen Schuß Martins zu flüchten versucht) würde den Umfang der vorliegenden Arbeit zweifellos sprengen, ihre Relevanz entfaltet sich aber über jede der in Kapitel 1 aufgeworfenen Fragestellungen.
2.1 Fotografie als Fetisch
Der Begriff „Fetisch“ stammt aus dem Portugiesischen (feitiço: „Zauber“) bzw. dem Lateinischen (factitius: „künstlich erschaffen“) und bezeichnet ursprünglich jene magischen Gegenstände, welche die portugiesischen Reisenden in Zentralafrika als die Zauberobjekte der dort beheimateten Kulturen zu identifizieren glaubten. In der psychoanalytischen Tradition wird der Begriff auch für die Bezeichnung einer leidenschaftlichen Besetzung von Partialobjekten benutzt, die als Substitute für reale Personen oder partnerschaftliche Beziehungen dienen. Nach Freud entwickelt das männliche Kind eine fetischistische Neigung, wenn es bemerkt, daß seine Mutter keinen Penis hat und damit die grundsätzliche Möglichkeit der Kastration erkennt. Das Kind sucht einen Ersatz (bestimmte Materialen, Formen, Körperteile, aber auch spezifische Situationen) für den fehlenden Penis bzw. Phallus der Mutter und entzieht sich damit selbst der Bedrohung durch Kastration. Der Fetischist gleicht also mittels des Fetisches das Wissen über die potentielle Unvollständigkeit seiner eigenen Existenz aus.[1]
Der filmische Text von Proof bietet viele Hinweise an, die auf eine fetischistische Beziehung Martins zur Fotografie (sowohl im ethnologischen als auch im psychoanalytischen Sinne) schließen lassen. Die erste von insgesamt vier im Plot verankerten Rückblenden zeigt eine Entsprechung der Freudschen Kastrationsbedrohung in Martins Kindheit: Martin erforscht tastend das Gesicht und Dekolleté seiner schlafenden Mutter. Diese wacht erschrocken auf und mahnt ihn: „ Du sollst mich nicht berühren, wenn ich schlafe! Finger sind nicht dasselbe wie Augen – sie erschrecken.“ Martin darf sich also kein vollständiges Bild von seiner Mutter machen und damit manifestiert sich ein Kindheitstrauma, das die Dramatik der psychoanalytischen Theorie bei weitem übertrifft: die Brust der Mutter wird ein Signifikant für eine Wahrheit, deren Konzeptualisierung Martin vorenthalten wird. Das Verbot der Mutter reißt somit eine Kluft in Martins kognitive Repräsentation der Welt, denn er kann sie nicht visuell und er darf ihre vollständige Beschaffenheit nicht taktil erfahren. Aus dieser Episode entwickelt Martin ein fundamentales Mißtrauen gegenüber seiner Mutter. Die zweite Rückblende schildert die rituelle Beschreibung des Ausblicks aus dem Fenster zum Garten und Martins Überzeugung, daß die Mutter dem Cadre eine Unwahrheit, nämlich den Gärtner, hinzufügt.
Im isolierten Vergleich dieser beiden Sequenzen sieht sich Martin mit einer Verkürzung (in der ersten Rückblende) und einer Verlängerung (in der zweiten Rückblende), in beiden Fällen mit einer Unvollkommenheit der objektiven Realität konfrontiert, aus der er seine eigene Minderwertigkeit ableitet. In diesem kognitiven Vakuum wird der fotografische Akt – den Martin außerhalb des Plots zum ersten Mal in der Gartenfenster-Situation vollzieht – zu einem Instrument der ontologischen Vervollständigung und damit tatsächlich zu einem feitiço, denn absolute Objektivität „im Sinne eines gänzlich ungehinderten Erfassens beliebiger Objekte ist eine Utopie“ (Lem 1984: 79) und setzt zunächst die Auflösung des Subjekts voraus:
Fetische funktionieren wie intermediäre Wesenheiten, die dem Fetischisten erlauben, sich von der materiellen Realität aus Fleisch und Blut, von der anstrengenden und angsterregenden Welt der soziokulturellen Beziehungen zu lösen und eine gänzlich künstliche, nur phantasmatisch funktionierende Welt zu kreieren.
(Böhme 1998)
Martin findet im fotografischen Akt eine befreiende intermediäre Existenzform, die ihm erlaubt, das für ihn Unsichtbare sichtbar zu machen. Er sagt: „ Ich wollte die Kamera, sie sollte mir helfen zu sehen.“ Die Polysemie des Verbs „to see“[2], die in der deutschen Synchronisation leider verloren geht, konzeptualisiert die komplementäre Struktur von Sehen und Wissen. Diese Struktur wird in der Montage reproduziert, indem den vier Rückblenden in Martins Vergangenheit vier unterschiedliche Darstellungen des fotografischen Aktes in Martins Gegenwart gegenübergestellt werden.
Die Fotografie als Streben nach vollständiger Aneignung der Welt, aber auch als Loslösung von der „Realität aus Fleisch und Blut“ und der „anstrengenden Welt der Beziehungen“ wird besonders deutlich in der Sequenz, in der sich Martin und der von Gewissenbissen geplagte Andy im Park treffen. Martin glaubt, daß er inzwischen wohl den gesamten Park fotografiert habe und Andy macht ihn auf ein Blatt aufmerksam, das vor ihren Füßen liegt. Ohne zu zögern richtet Martin seinen Fotoapparat auf den Boden und macht ein Foto. Damit erschließt sich ihm das Phantasma einer neuen Erfahrung:
[Martin] Ich habe Dir vertraut – ich kann es!
[Andy] Kann sein, daß Du falsch liegst.
[Martin] Wieso? Da Liegt ein Blatt, oder?
[Andy] Ich trage ungern Verantwortung ... Ich bin nicht vertrauenswürdig. Das würdest Du auch sagen, wenn Du mich sehen könntest.
Martin antwortet darauf nicht, sondern bückt sich, um das Blatt, das er fotografiert hat (und damit auch sein Vertrauen zu Andy, das er auf dieses Blatt projeziert) gewissermaßen taktil zu verifizieren. Bemerkenswerterweise greift er dabei zunächst ins Leere (bzw. ins Gras) und muß sich, im Gegensatz zu dessen fotografischer Aneignung, erst an das Blatt herantasten.
Auch die eingangs erwähnte und von Jocelyn Moorhouse bis ins kleinste Detail in Szene gesetzte Parksequenz liest sich als die Möglichkeit eines „gänzlich ungehinderten Erfassens “ der Wirklichkeit durch ein Auflösen des Subjektes im fotografischen Akt: während Andy Martin beim Fotografieren eines Baumes im Park beobachtet, läuft Bill zunächst auf Andy zu, schließlich aber an ihm vorbei zu Celia, die auf einer Bank sitzt. Bills Wegstrecke bezeichnet somit eine Gerade zwischen den Punkten Martin und Celia, in deren Mittelpunkt Andy steht. Als Martin Bills Abwesenheit bemerkt, ruft er zunächst nach ihm, lokalisiert ihn aber schließlich dadurch, daß er den Park fotografisch Winkel für Winkel abtastet. Martins mechanisches Verhalten erinnert an die programmierte Hartnäckigkeit eines Roboters und die Kameraperspektive zeigt uns nun denjenigen Blick durch den Sucher des Fotoapparates, den Martin in seiner fleischlichen Realität nicht wahrnehmen kann, nämlich die Gerade, welche die Figurenkonstellation von Martin, Andy und Celia widerspiegelt und von welcher Andy durch einen Sprung aus dem Cadre zu entkommen versucht. In diesem Augenblick bricht Martin den fotografischen Akt ab, richtet aber seinen blinden Blick weiterhin an der Geraden aus, auf welcher Bill nun wieder zu ihm zurückgelaufen kommt und dadurch den Kreis der Beweisaufnahme schließt.
Diese äußerst komplexe Montage von Blickwinkeln gewährt uns durch die Gegenüberstellung mit Andys sehender Perspektive einen flüchtigen Einblick in die Zwischenwelt, in die Martin mittels seines Fetisches eintaucht. Obwohl Martin nicht weiß, was er fotografiert (denn dazu bedarf es erst Andys unwahrer Beschreibung dieses Fotos und schließlich Celias Geständnis, indem sie es an Bills Halsband befestigt), vermittelt die Montage den Eindruck, daß er sieht, was er fotografiert. Hier offenbart sich einmal mehr die Verankerung der komplementären Struktur von Sehen und Wissen im filmischen Text. Zur vollständigen Entfaltung dieser Struktur muß Martin aber erst auf ein äußerst heteronomes Zeichensystem zurückgreifen, um seine Welt zu verifizieren.
2.2 In dubio contra reo
Martin wird uns in der Exposition als ein sehr mißtrauischer und verbitterter Charakter vorgestellt, dessen ganzes Leben (zumindest bis zu dem Zwischenfall mit Andy und Celia) einem einzigen Indizienprozess gleicht. Mit diesem Prozeß verfolgt er sein Ideal einer objektiven Wahrheit. Der filmische Text bietet uns keine Hinweise auf Martins Vorstellung von Gerechtigkeit, sehr wohl aber einen Einblick in dessen Prozeßordnung, wenn er Andy bei einem Glas Wein erklärt:
Irgendwann werde ich Dir vielleicht ein altes Foto zeigen. Meine erste Aufnahme, ich war gerade zehn. Man kann es eigentlich nicht als Foto bezeichnen – nur ein Garten, den man durch das Fenster unseres Hauses sehen konnte. Aber für mich ist dieses Foto das Wichtigste von allen. Jeden Morgen und jeden Nachmittag beschrieb meine Mutter diesen Ausblick in den Garten. Ich sah die Jahreszeiten kommen und gehen durch ihre Augen. Und ich quälte sie mit Tausenden von Fragen, weil ich hoffte, sie irgendwann bei einer Lüge zu erwischen. Und mit diesem Foto könnte ich beweisen, daß sie gelogen hat.
Daraufhin fragt Andy: „Wieso glaubst Du, daß sie gelogen hat?“ und Martin antwortet: „Sie wollte mich bestrafen für meine Blindheit.“ Genaugenommen wähnt sich Martin also in einem existentiellen Revisionsverfahren, in dessen Zeugenstand die Fotografien als „Grenzposten zwischen innerlicher und äußerlicher Wirklichkeit“ (Messer 2003: 1) gerufen werden.
Dagegen wäre es unzureichend, Martins Fotografien lediglich in ihrer Eigenschaft als selbsterklärenden Schnitt durch Raum und Zeit, „als etwas aus dem Lebendigen Herausgeschnittenes“ (Dubois 1998) zu betrachten, denn sie entfalten ihre eigentliche signifikante Funktion für Martins Wahrheitssuche erst im Akt der verbalen Beschreibung durch einen sehenden Dritten bzw. im Akt der Beschriftung der Abzüge mit ebendieser Beschreibung. Als Martin Andy zum ersten Mal im Restaurant besucht, um sich von ihm seine Fotos beschreiben zu lassen, müssen beide zunächst eine gemeinsame Sprache finden, in welcher sie das Foto als Produkt eines subjektgelösten fetischistischen Aktes wieder zum „subjektgebundenen Weltbild“ (Messer 2003: 2) deklarieren können. Der folgende Dialog hat somit primär eine metakommunikative Bedeutung (Watzlawik 1996: 190) für die weitere Beziehung zwischen Martin und Andy, denn die beiden kommunizieren nicht nur über die in dem Bildausschnitt enthaltene Information, sondern insbesondere über die Regeln, denen ihre weitere Kommunikation unterliegen soll:
[Martin]: Beschreiben Sie mir die Bilder. Ganz unkompliziert, höchstens zehn Worte.
[Andy]: Tja, das Erste bin ich und die Katze... –
[Martin]: ...Die Katze ist ja wohl überall drauf. Ich will es einfacher für Sie machen: finden Sie fünf verschiedene Worte, die genau definieren, wie die Katze aussieht.
[Andy]: Tja, tot (lacht)... schlaff!
[Martin]: Schlaff? – Andy hält die schlaffe Katze im Warteraum des Tierarztes. Neun Wörter. Die Fotografie, bitte.
Bemerkenswerterweise wird der Informationsgrad dieser Deklaration und damit Martins konzeptuelle Vervollständigung der Situation im Warteraum des Tierarztes durch die endliche Fläche des australischen Fotostandards determiniert. Auffällig ist auch die Sorgfalt, mit der Martin bedacht ist, das Foto „richtigherum“ in seiner Hand zu halten, um es zu beschriften:
[Andy]: Was tust Du da?
[Martin]: Ich beschrifte jetzt.
[Andy]: Wozu?
[Martin]: Als Beweis.
[Andy]: Wofür?
[Martin]: Als Beweis dafür, daß das was ich fotografierte, existiert.
Als Andy sich die Bemerkung erlaubt, daß auf diesem Foto doch „ irgendetwas “ abgebildet sein könnte, beschreibt Martin ihm und dem Zuschauer die Warteraum-Sitation aus seiner Perspektive. Martins logische Schlußfolgerungen auf der Tonebene werden dabei durch ihre visuellen Entsprechungen auf der Bildebene begleitet. Mit dieser Parallelmontage werden Martins und Andys (als auch des Zuschauers) grundverschiedene Wahrnehmungswelten konfrontiert und dadurch zueinander in Beziehung gesetzt. Schließlich nimmt Martin das beschriftete Foto in die Hand und sagt: „ Doch das hier beweist, daß meine Sinne das fühlen, was Sie mit Ihren Augen sehen: die Wahrheit.“ Dabei bezieht er sich wohlgemerkt nicht lediglich auf die fotografische Verdichtung dessen, was er im auditiven, taktilen und olfaktorischen Modus wahrgenommen hat, sondern vielmehr auf Andys Beurteilung des Zustandes der Katze, den dieser im visuellen Modus wahrgenommen hat.
Damit wird die Fotografie in ihrer physischen Ausprägung als die kleinste bedeutungskonstituierende Einheit in einem Zeichensystem etabliert, welches mit dem semiotischen Dreieck in Abbildung 1 veranschaulicht werden kann:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Das semiotische Dreieck in Martins privaten Zeichensystem.
Die Beziehung zwischen Bildinhalt und Beschriftung entspricht sehr offensichtlich dem Symbolbegriff der strukturalistischen Tradition, denn durch die Beschriftung des Fotos sind Bezeichnendes (auf der Rückseite) und Bezeichnetes (auf der Vorderseite) tatsächlich physisch miteinander verknüpft. Interessanterweise eignet sich Martin den Signifikanten taktil an und projeziert seine Konzeptualisation wiederum auf das Signifikat, wodurch das einmal erworbene Zeichen eine in sich abgeschlossene Einheit im System darstellt.
Die Bedeutung des Fotos in Martins Zeichensystem gründet allerdings nur teilweise, nämlich in seiner Form („ganz unkompliziert, höchstens zehn Worte“) auf den Kommunikationsregeln zwischen Martin und Andy. Der Inhalt wird vielmehr durch das externe Wertesystem Andys determiniert, wie in den Sätzen (1) und (2) deutlich wird:
(1) „Alte Frau hält ein häßliches Mädchen an der Hand.“
(2) „Schwuchteln in weißen Jackets, die glauben, sie könnten Cricket spielen.“
Andys Bezeichnung der Frau als alt und des Mädchens als häßlich ist wie auch die Beschreibung der Katze als schlaff ausschließlich in seiner eigenen Abgrenzung der Begriffspaare jung/alt, schön/häßlich oder aktiv/passiv verankert. Damit entblößt sich die grundsätzliche Heteronymie von Martins Indizienprozess auf der Suche nach einer objektiven Wahrheit, denn Sprache unterliegt immer dem menschlichen Bewußtsein und ist per se Bestandteil einer konstruierten Realität. Indem sich Martin von Andy seine Fotografien beschreiben läßt, übernimmt er gleichzeitig auch dessen semantische Architektur. Daß sich Martin dieser Tatsache von Anfang an bewußt ist und aus ihr den Leitsatz ,Im Zweifel gegen den Angeklagten’ ableitet, lernen wir in einem Dialog zwischen ihm und seiner Mutter:
[Mutter]: Wieso sollte ich Dich anlügen?
[Martin]: Weil Du es kannst!
In Martins Zeichensystem muß also eine Kraft wirken, die einerseits in der Lage ist, die Willkür der Sprache auszugleichen und andererseits eine Kontiguität zwischen der fotografierten Welt und der Welt im fotografischen Off herstellen kann. Diese Kraft ist das Vertrauen, von dem Martin allerdings einen äußerst selektiven Gebrauch macht: er traut Andys Augen in der gleichen apriorischen Qualität wie er den Augen seiner Mutter und auch Celias mißtraut. Das Mißtrauen, das Martin gegenüber Celia hegt, ist eine unmittelbare Verlängerung des Mißtrauens, das er seiner Mutter entgegenbrachte, weil sie ihm die Erfahrung ihrer vollständigen Beschaffenheit vorenthalten hat. An deren Stelle hat Martin den fotografischen Akt gesetzt, aber auch dieser kann die Brust der Mutter nicht als das entziffern, was sie in erster Linie ist: ein pars pro toto für die weibliche Sexualität. Celia hat Martin in seiner Unkenntnis durchschaut, wenn sie ihn an ihrem dreißigsten Geburtstag aufzieht:
Es heißt doch immer, wenn man erst einmal dreißig ist, ist die Mädchenzeit vorbei. Man muß endlich begreifen, daß man eine Frau ist. – Aber davon verstehen Sie wohl nichts, Martin. Nichts vom Unterschied zwischen Frau und Mädchen, nicht wahr?
Diese Sequenz klärt uns auch über Celias sexuelle Hinneigung zu Martin auf, wenn sie ihn bezeichnenderweise darum bittet, ein Foto von ihr zu machen und seine Hand auf ihre Brust legt. Martin, der vorgibt, Celia zu verweigern, „was sie so gerne möchte“, schreckt vor dieser Offensive zurück und muß seine Angst vor dem Unbekannten mit einer harschen Gegenoffensive überspielen: „Erwarten Sie kein Präsent von mir, Celia!“ Möglicherweise liegt hier auch der Grund verborgen, warum Martin seinem Freund Andy so bedingungslos vertraut: er konzeptualisiert ihn als seinesgleichen, weil er seine eigene körperliche Beschaffenheit auf ihn projezieren kann. Damit würde das oben skizzierte semiotische Dreieck endgültig zu einem abgeschlossenen Viereck (wäre da nicht noch Celia).
Letztendlich erzählt Proof den Prozeß, durch den Martin lernt, daß je mehr er seinem Ideal eines bedingungslosen Vertrauens nacheifert, umso mehr sein Ideal einer vollständigen, objektiven Wahrheit aufgeben muß. Andys Beschreibung des wichtigsten Fotos von allen markiert die finale Lektion dieses Lernprozesses: „Ein Mann im Garten...die Sonne scheint.“ – „Ja“, stimmt Martin zu. Der Film schließt mit einer letzten Rückblende, in der wir den kleinen Martin vor dem Fenster zum Garten sitzen sehen. Das Fenster ist in ein grelles weißes Licht getaucht und der Wind rüttelt geräuschvoll an der Scheibe, bis Martin seine Hand auf die Fensterfläche legt: jetzt kann er das Zwitschern der Vögel hören und in den Garten der Wahrheit ist Frieden eingekehrt.
Doch bevor Martin dies gelingt, muß er zunächst einen Gefühlszustand kennenlernen, der die komplementäre Struktur von Sehen und Wissen auf die wohl schmerzhafteste Art und Weise vermittelt: die Eifersucht.
2.3 „Tun wir, als wären wir blind“
Bevor Andy und Celia sich zum ersten Mal in Wirklichkeit begegnen, lernen sie sich in den Fotografien Martins kennen. Dabei reproduziert der filmische Text mit der Darstellung ihrer jeweiligen Analysestrategien einerseits Roland Barthes elementare Unterscheidung von studium und punctum, darüber hinaus wird aber auch das Motiv der Eifersucht als maßgebliche Determinante in der Figurenkonstellation zwischen Martin, Andy und Celia etabliert.
Während einer Sitzung im Restaurant entdeckt Andy zufällig die Fotografie von Celia, die Martin (außerhalb des Plots) an deren dreißigsten Geburtstag gemacht hat. Martin nimmt zunächst das Foto erschrocken an sich, hält es unentschlossen in seinen Händen und schwankt – möglicherweise die Katastrophe vorausahnend – zwischen der Herausforderung, Andy ein sehr emotional besetztes Element seiner Welt preiszugeben und andererseits der Möglichkeit, seine Konzeptualisation von Celia durch Andys Augen auszudehnen. Schließlich gibt er das Foto an Andy zurück:
[Martin]: Gut, beschreib’ sie mir.
[Andy]: Nicht gerade umwerfend. Braune Haare, braune Augen – doch ganz okay.
[Martin]: Also keine Pennerin demnach?
[Andy]: (lacht) Nein, keine Pennerin. Dein Herzblatt?
[Martin]: Celia: Herzblatt? Celia hat kein Herz. Sie ist meine Haushälterin. Ich verabscheue diese Frau, ich hasse sie!
Doch Andy ist von ihrem Bild gefesselt, die Kamera nimmt seine Perspektive ein und fokussiert langsam aber bestimmt auf Celias rote Lippen im Mittelpunkt des Cadres. Celias Lippen stellen für Andy tatsächlich „das punctum einer Photografie“ dar, „jenes Zufällige an ihr, das [ihn] besticht (... aber auch verwundet, trifft)“ (Barthes 1986: 36).
Im Gegensatz dazu wühlt Celia geradezu sprichwörtlich und explorativ in Martins Welt, wenn sie heimlich in seinen Fotografien stöbert, um sich in ihrem Wissensdurst das Objekt ihrer Liebe in all seiner Ausdehnung in Raum und Zeit anzueignen.[3] Dabei entdeckt Celia ein unscharfes Foto von Andy, und sucht von nun an gezielt nach weiteren Spuren dieses Fremdkörpers in Martins Fenstern zur Welt. Sie projeziert diesen Körper in das fotografische Off, das ein Foto von einer linken Gesichtshälfte hinterlassen hat, indem sie dieses sukzessive mit Fotos von Körperteilen ausfüllt, von denen sie letztendlich aber nicht wirklich weiß, ob sie zu Andy gehören. Celia setzt ein Puzzle zusammen, das auf eine metonymische Art und Weise ihre „eifersuchtsverzerrte Wahrnehmung“ (Messer 2003: 2) spiegelt.
Eifersucht ist gewissermaßen negatives Vertrauen, denn sie dehnt nicht das Wissen auf diejenigen Bereiche unserer Welt aus, die einem empirischen Zugang vorenthalten bleiben, sondern untergräbt, gerade umgekehrt, die Sicherheit des Vertrauens, indem sie, aus Angst vor dem Nichtwissen und dem Verlust, Verdachtsmomente, Spuren, in das empirische Off projeziert.
Not seeing what one sees, seeing what one cannot see and what cannot present itself, that is the jealous operation. Jealousy always has to do with some trace, never with perception.
Jacques Derrida zit. in Kamuf (2000: 431)
Celias Eifersucht ist eine ständige Angst vor dem Verlust Martins, die sie dadurch abzuwehren versucht, daß sie sprichwörtlich Besitz von dem ergreift, was Martin liebt: seinen Hund Bill im Park, seinen Freund Andy im Bett, seine Welt in seinen Fotografien und schließlich ihn selbst in ihren eigenen Fotografien, mit denen sie sich in ihrer Wohnung umgibt. Als sich Andy und Celia schließlich zum ersten Mal in realiter begegnen, nähern sie sich über den gegenseitigen Vergleich von fotografischem Abbild und empirischer Realität an:
[Andy]: Sie müssen Celia sein... Ich habe ein Foto von Ihnen gesehen. In natura sehen Sie anders aus.
[Celia]: Sie meinen, fotografiert sehe ich besser aus als in Wirklichkeit?
[Andy]: Nein, Sie sehen hübsch aus – fotografiert und jetzt.
[Celia]: (geschmeichelt) Sie auch. Offensichtlich liebt uns die Kamera. Martin wohl sicher nicht – er kennt nicht einmal die Bedeutung dieses Wortes.
Martin gibt sich wirklich die allergrößte Mühe, den Eindruck zu erwecken, daß er Celia nicht lieben will, um sich vor ihrem Mitleid zu schützen. Doch spätestens als Celia versucht, ihn mit der Aufforderung „Du spielst mit mir – hör auf damit! Es ist Zeit für die Wahrheit!“ zu verführen, wird allen Beteiligten klar, daß er Celia nicht lieben kann. Der filmische Text kommentiert diese Auflösung mit einer weiteren Rückblende in Martins Vergangenheit. Als Martins Mutter ihm eröffnet, daß sie bald sterben werde, glaubt er bereits zu wissen, warum:
[Martin]: Du stirbst doch nur, damit Du für immer weggehen kannst von mir! Du schämst Dich wegen mir!
[Mutter]: Bitte, Martin. Ich wollte Dir doch nur die Wahrheit sagen.
[Martin]: Du sagst nicht die Wahrheit, Du sagst niemals die Wahrheit!
Interessanterweise hat aber Celia dadurch, daß sie das Beweisfoto aus dem Park einem unbeteiligten Betrachter, nämlich dem Tierarzt, zugespielt hat, Martin tatsächlich die Wahrheit gesagt. Damit legt sie die Spuren für Martins Eifersucht aus: Martin ist eifersüchtig auf Celia, weil sie mit Andy das verifizierende Element in seinem Zeichensystem zur Lüge verleitet hat, er ist aber auch eifersüchtig auf Andy, weil dieser Celia so erkennen kann, wie er selbst dazu nicht in der Lage ist. Celia hat Martin mit ihrem Verhalten die Augen geöffnet und wird dafür aus seiner Welt verbannt.
3 Fotografie und Realität im Film
Im Laufe der vorliegenden Arbeit haben wir uns allmählich an die Darstellung des Sichtbarmachens des Unsichtbaren und des Festhaltens des Unhaltbaren im Film herangetastet. Zu diesem Zweck stellte das ausgewählte Filmbeispiel Proof zugegebenermaßen ein eher ungewöhnliches Werk in der filmischen Thematisierung von Fotografie dar. Das scheinbare Paradox eines blinden Fotografen konnte gleichwohl mit der Untersuchung der in Kapitel 1 aufgeworfenen Fragestellungen hinreichend entschlüsselt werden, auch wenn die Analyse in Anbetracht der ausgeprägten Vielschichtigkeit des Films keinen Anpruch auf Vollständigkeit erheben kann. So blieben beispielsweise ein Vergleich zwischen Martins und Celias Fotografie oder die Frage, ob es sich bei Proof letztendlich um eine Komödie oder ein Drama handelt, weitestgehend unberücksichtigt. Hingegen konnte der filmische Leitgedanke der Konstruktion von Wirklichkeit durch Fotografie und die komplementäre Struktur von Sehen und Wissen klar herausgestellt werden.
Martins Fotografie wurde als ein Instrument der ontologischen Vervollständigung erschlossen, mit dem er in einer entscheidenen Phase seiner kognitiven, aber auch sexuellen Entwicklung das Vakuum ausgefüllt hat, welches das Verbot der Mutter, ihre vollständige Beschaffenheit zu begreifen, hinterließ. Damit wird für Martin der fotografische Akt zu einem Fetisch, der ihm erlaubt, ein intermediäres Fenster zur Welt zu öffnen, durch das er seine Vorstellung von der Welt zu beweisen versucht. Martin konstruiert seine Realität aus fotografischen Blindschüssen, welche die Gegenstandswelt in ihrer Vollständigkeit sprichwörtlich niederstrecken. Dazu bedient er sich eines sehr privaten Zeichensystems, in dem das fotografische Abbild die kleinste bedeutungskonstituierende Einheit darstellt und das aufgrund seiner Abhängigkeit von der sprachlichen Beurteilung durch einen sehenden Dritten eine grundsätzliche Heteronymie entblößt. Die Arbitrarität der Sprache überwindet Martin mit einem bedingungslosen und selektiven Vertrauen, das letztendlich jedoch den Zielkonflikt mit seinem Ideal einer absoluten, objektiven Wirklichkeit entfesselt. Martin und insbesondere Celia finden in der Fotografie Realitätsspuren, mit denen sie ihre Ängste in das fotografische und empirische Off projezieren und welche letzten Endes die Auflösung ihrer antagonistischen Beziehung ermöglichen.
Um Proof in die Thematisierung von Fotografie und Realität im Film einzuordnen, bietet sich der Film Memento (Christopher Nolan, 2000) trotz seiner grundverschiedenen narrativen Struktur als geeignete Referenz an. Auch in diesem Film stellt die Fotografie ein Medium zur Konstruktion von Realität dar, sie dient dem Protagonisten Leonard als Prothese für das eigene gestörte Kurzeitgedächntis und erhält durch die Notwendigkeit einer Beschriftung, „ohne die alle photografische Konstruktion im Ungefähren stecken bleiben muß“ (Benjamin 1966: 93) einen ähnlichen Zeichencharakter wie die Fotos in Martins Indizienprozess. Während die Fotos in Proof allerdings als Erkenntnismedium funktionieren, dienen sie in Memento als Wiedererkennungsmittel, sie zeigen Leonard seinen vermeintlichen Besitz und die vermeintlichen Meilensteine auf der Suche nach dem Mörder seiner Frau an. Dadurch werden diese Fotos immer wieder herangezogen, um Leonards vermeintliche Identität zu verifizieren, dem Zuschauer offenbart sich allerdings die Willkür, die Leonard walten läßt, je mehr der Film voran- bzw. die kausale Verknüpfung der Erzählung zurückschreitet: im Gegensatz zu Martin hat Leonard die Fähigkeit, seine Realität bewußt zu manipulieren und sich so paradoxerweise jeglicher Verantwortung zu entziehen. Während die Fotografie in der zentralen Parksequenz von Proof das Unsichtbare sichtbar macht, verschleiert sie in Memento das Sichtbare: in der Anfangssequenz sehen wir die Gegenüberstellung eines sich langsam zersetzenden Fotos einer Leiche, das schließlich als graues Fotopapier einer Sofortbildkamera einverleibt wird mit dem tödlichen Projektil, das aus dem Kopf des Opfers zurück in den Lauf der Pistole gesogen wird.
To photograph is to appropriate the thing photographed. It means putting oneself into a certain relation to the world that feels like knowledge – and therefore, like power.
Susan Sontag (2002: 4)
Fotografie im Film thematisiert stets die Strategien ebendieser Machtansprüche, mit denen der Fotograf seine bestimmte Beziehung zur Wirklichkeit zu behaupten versucht, um sie sich schließlich Untertan zu machen.
4 Bibliographie
Barthes, Roland. 1986. Die helle Kammer. Bemerkungen zur Photographie. 2., durchgesehene Aufl. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
Benjamin, Walter. 1966. Kleine Geschichte der Fotografie. In: Angelus Novus.Gesammelte Schriften II. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
Böhme, Hartmut. 1998. Eine Reise in das Innere der Körper und darüber hinaus. In: Magazyn Szutki, Nr. 16. S. 89-102. URL: http://www.culture.hu-berlin.de/hb/volltexte/texte/Alicja_deutsch.html ; Abruf am 10.03.2004, 18:15h.
Dubois, Philippe. 1998. Der fotografische Akt: Versuch über ein theoretisches Dispositiv. Hrsg. und mit einem Vorw. von Herta Wolf. In: Schriftenreihe zur Geschichte und Theorie der Fotografie; Bd. 1. Dresden: Verlag der Kunst.
Ebert, Roger. 1992. Review of Proof. In: Chicago Sun-Times 15 May 1992. URL: http://www.suntimes.com/ebert/ebert_reviews/1992/05/756483.html; Abruf am 14.03.2004, 16:20h.
Giles, Dennis. 1984. Conditions of Pleasure in Horror Cinema. In: Planks of Reason. Hrsg. v. Barry K. Grant. Metuchen, New York: The Scarecrow Press. S. 38 – 52.
Kamuf, Peggy. 2000. Jealousy Wants Proof. In: REC 59/5. S. 429 – 445. URL: http://www.b92.net/casopis_rec/59.5/pdf/429-445.pdf ; Abruf am 16.03.2004, 08:20h.
Lem, Stanislaw. 1984. Also sprach Golem. Frankfurt am Main: Insel Verlag.
Messer, Yvonne. 2003. Blind geschossene Fotos als wahrscheinlichster Wirklichkeitstraum. Protokoll der Seminarsitzung „Fotografen im Kino“ vom 18. Dezember 2003. Philipps-Universität Marburg. URL: http://online-media.uni-marburg.de/medien/bewegte-kamera/fotografen/main.htm; Abruf am 14.03.2004, 16:15h.
photokina 1974 bilderschauen. Katalog der Weltmesse der Photografie 1974. Hrsg.: Messe- und Ausstellungs-Ges.m.b.H. Köln.
Sontag, Susan. 2002. On Photography. London: Penguin.
Watzlawik, Paul. 1996. Wie wirklich ist die Wirklichkeit? München: Piper.
[...]
[1] Dennis Giles (1984: 45f) erläutert den Zusammenhang zwischen Fetischismus und filmischen Texten.
[2] Das englische Verb „to see“ bedeutet neben „sehen“ auch „einsehen, verstehen, erleben“.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in „Der fotografische Schuß“?
Der Text analysiert die Beziehung zwischen Fotografie, Realität und Konstruktion im Film, insbesondere anhand des Films "Proof". Er untersucht, wie Fotografie zur Manipulation und Konstruktion von Wirklichkeit eingesetzt wird, und wie sie das Verhältnis zwischen Sehen und Wissen beeinflusst.
Welche Hypothesen werden in der Analyse untersucht?
Folgende Hypothesen werden auf ihre Verankerung im filmischen Text hin überprüft:
- Der fotografische Apparat ist mehr als nur eine Prothese für Martins Augen, sondern ein Fetisch zum Ausgleich existentieller Unvollständigkeit.
- Martins Realität ist ein Indizienprozess in dubio contra reo, dem ein privates Zeichensystem zugrunde liegt.
- Der Film entwickelt seine Story über die Beziehung zwischen Wissen und Sehen, aber auch zwischen Nicht-Wissen und Nicht-Sehen, wobei Eifersucht ein maßgebliches Handlungsmotiv ist.
Was ist die fotografische Flinte?
Die "fusil photographique" (fotografische Flinte) wurde 1882 von Etienne Jules Marey entworfen. Sie war eine Apparatur, die 12 Bilder pro Sekunde bei einer Belichtungszeit von 1/720 Sekunde fixieren konnte und damit nahe an die Leistung einer modernen Filmkamera herankam. Sie wird als etymologische Grundlage für die Semantik der Fotografie gesehen.
Welche Rolle spielt der Garten der Wahrheit im Film "Proof"?
Das Motiv des Gartens nimmt eine zentrale Position im Film ein und verweist auf das mediale Lexikon der abendländischen Kultur. Es wird mit dem Blick aus dem Fenster (als Anspielung auf den biblischen Raum der Erkenntnis) und mit dem Stadtpark (als Raum der Beweisaufnahme) in Verbindung gebracht. Fotografien dieser Räume determinieren die narrative Dynamik des Films.
Was bedeutet Fetisch im Kontext des Films "Proof"?
Der Begriff Fetisch wird sowohl im ethnologischen als auch im psychoanalytischen Sinne verwendet. Martins Beziehung zur Fotografie wird als fetischistisch interpretiert, da der fotografische Akt als Instrument zur ontologischen Vervollständigung dient und damit ein feitiço darstellt. Er gleicht die Unvollständigkeit seiner Existenz aus.
Wie funktioniert Martins Zeichensystem zur Wahrheitsfindung?
Martins Zeichensystem basiert auf der verbalen Beschreibung von Fotografien durch einen sehenden Dritten und der Beschriftung der Abzüge mit ebendieser Beschreibung. Das fotografische Abbild ist die kleinste bedeutungskonstituierende Einheit in diesem System. Es ist heteronom, da es von der sprachlichen Beurteilung durch andere Personen abhängt.
Welche Rolle spielt die Eifersucht in der Figurenkonstellation von Martin, Andy und Celia?
Eifersucht wird als maßgebliche Determinante in der Beziehung zwischen Martin, Andy und Celia etabliert. Celias Eifersucht ist eine ständige Angst vor dem Verlust Martins, die sie dadurch abzuwehren versucht, daß sie Besitz von dem ergreift, was Martin liebt.
Welchen Bezug hat der Film "Memento" zu "Proof" im Kontext der Filmanalyse?
Sowohl in "Proof" als auch in "Memento" stellt die Fotografie ein Medium zur Konstruktion von Realität dar. Während die Fotos in "Proof" als Erkenntnismedium fungieren, dienen sie in "Memento" als Wiedererkennungsmittel für das gestörte Kurzzeitgedächtnis des Protagonisten.
Was ist die Essenz der Filmanalyse bezüglich Fotografie und Realität?
Fotografie im Film thematisiert stets die Strategien von Machtansprüchen, mit denen der Fotograf seine bestimmte Beziehung zur Wirklichkeit zu behaupten versucht, um sie sich schließlich Untertan zu machen.
- Quote paper
- M.A. Daniel Daimler (Author), 2004, Das ontologische Opfer - Fotografie und Realität im Film, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108626