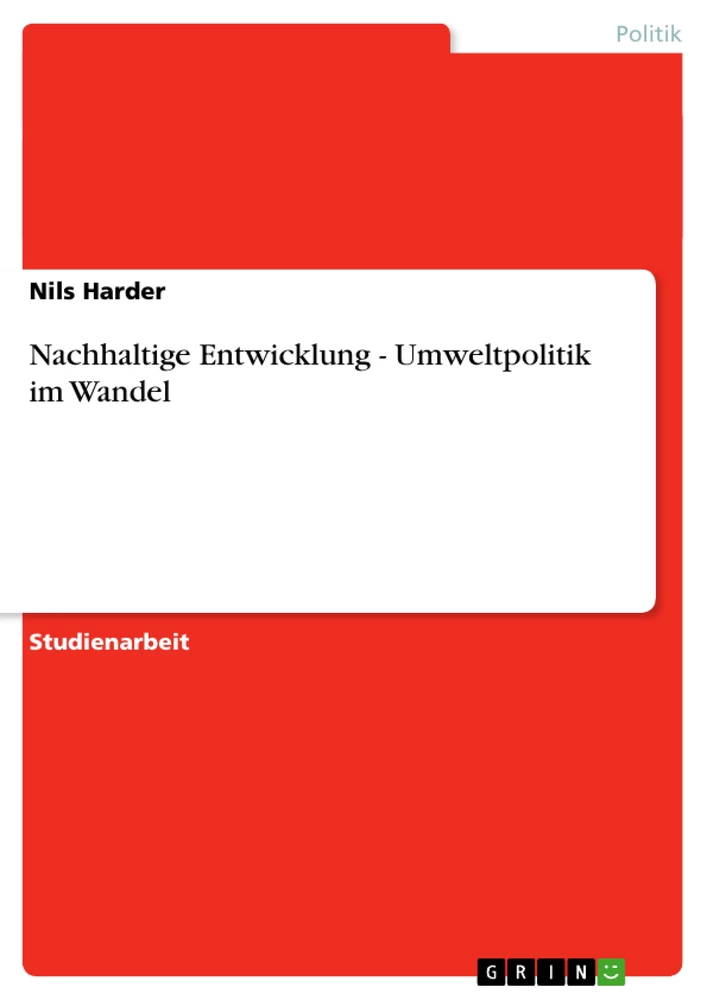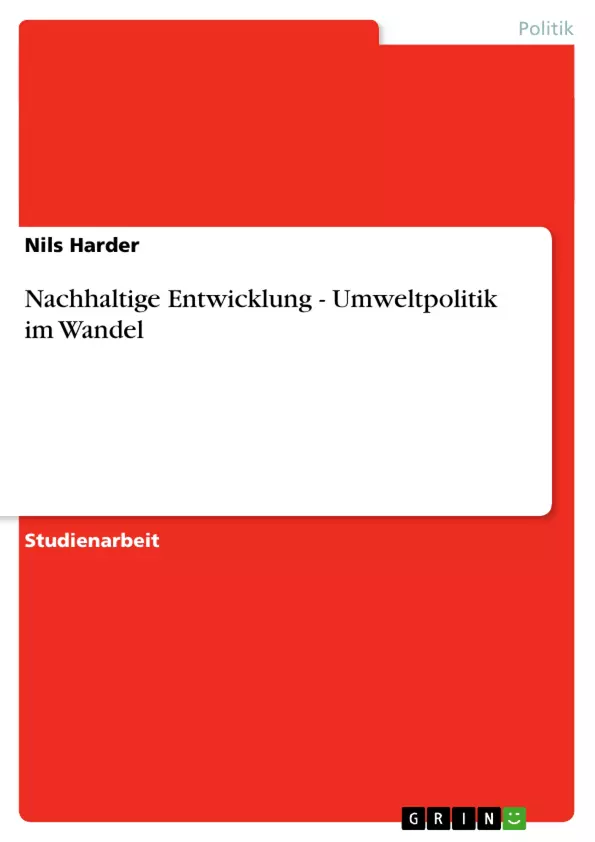Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Analyse
1. Wandel im Titel der Konferenzen
2. Das Recht auf die eigenen Ressourcen
3. Variierende Akteurstypen
4. Wachsende Berücksichtigung von Minderheiten
5. Die Bewertung von Unterdrückung und Krieg
Ausleitung
Einleitung
Die weltweite Umweltschutzzusammenarbeit hat in den letzten drei Dekaden vielfältige Veränderungen durchlebt. Von einer ehemals hauptsächlich staatlich geprägten Anstrengung zur Zeit des Kalten Krieges wandelte sie sich mehr und mehr zum Instrument kleinerer Akteure, die aktiv den durch die mäßigen Erfolge der Nationalstaaten entstandenen Freiraum deutlich erweiterten und ausfüllten. Gerade einmal vier funktionsfähige Umweltschutzregimes sind in den zwanzig Jahren zwischen der ersten Weltumweltkonferenz in Stockholm 1972, die zur Gründung des Umweltprogramms der Vereinten Nationen geführt hat, und der Folgekonferenz 1992 in Rio in Kraft getreten. Dies sind das Washingtoner Artenschutzabkommen (CITES1), das Baseler „Sondermüll-Übereinkommen“2, das Wiener Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht3 und das Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung4. In diesem Zeitraum hat gleichzeitig eine große Anzahl nichtstaatlicher Akteure versucht, Erfolge wie diese auch auf anderen Bereichen zu wiederholen oder bestehende Verträge zu verbessern - beziehungsweise deren Einhaltung zu überwachen. Vor allem regional konnten die netzwerkartig agierenden Vereine wirksam werden. Dadurch hat sich eine Praxis nachhaltigerer Politik ergeben, die von der Vielfalt des Themenkomplexes mehr und mehr profitiert.
Um diese Entwicklung nachzuvollziehen, werden in dieser Arbeit die Abschlusserklärungen der drei größten Weltumweltkonferenzen untersucht. Die erste Konferenz fand 1972 in Stockholm statt, die United Nations Conference on the Human Environment. 5 Zwanzig Jahre später wurde in Rio de Janeiro die United Nations Conference on Environment and Development 6 abgehalten. Die jüngste Konferenz war 2002 in Johannesburg der World Summit on Sustainable Development.7
Die Abschlusserklärungen der drei Konferenzen sind selten im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Betrachtung, da sie rechtlich unverbindliche Dokumente sind, die zumeist Absichtserklärungen beinhalten und grobe Ziele vordefinieren. Die Implementierungspläne und völkerrechtlichen Verträge, die ebenfalls im Rahmen der Konferenzen entstehen können, ernten verständlicherweise den Großteil der Aufmerksamkeit. Sie sollen bewusst außen vor
gelassen werden, um gerade die rechtlich unverbindlichen und damit mutmaßlich freieren und von Stimmungen beeinflussbareren Dokumente nach Hinweisen abzusuchen. Eine entscheidende Einbeziehung von neuen Akteuren sollte sich in den Erklärungen wiederfinden lassen. Denn die relative Freiheit der Form dieser Erklärungen erlaubt es ihnen wahrscheinlich, flexibler auf neue Einflüsse zu reagieren und sie entsprechend auszudrücken. Bei einer veränderten Mentalität im Bereich der Umweltschutzarbeit wird sich dies in der Sprache der Deklarationen ausdrücken, und auch ein gestiegener Einfluss neuer Akteure müsste sich in Wortwahl und Aufbau wiederfinden lassen. Ebenfalls sollte sich ein verändertes Verständnis einzelner Aspekte aufzeigen lassen, beispielsweise die Erkenntnis über den Zusammenhang von Armut und Umweltzerstörung oder die Notwendigkeit, die Bevölkerung an der Ausarbeitung und Ausführung von Plänen zur Entwicklungshilfe und zum Umweltschutz einzubeziehen. Gleichfalls werden auch unveränderte Sichtweisen aufzeigbar sein, und gerade an ihnen werden die Feinheiten des Fortschritts in der Analyse der weltweiten Umwelt- und Entwicklungsprobleme deutlich werden.
In den einzelnen Abschnitten dieser Analyse wird in chronologischer Reihenfolge die Entwicklung der drei Konferenzen aufgezeigt, zunächst die Stockholmer Konferenz, von ihr weitergehend - oft wortwörtlich in der Mitte stehend - die Rio-Konferenz, und zuletzt steht exemplarisch für die heutige Herangehensweise an das Problemfeld der nachhaltigen Entwicklung die Weltversammlung in Johannesburg.
Analyse
1. Wandel im Titel der Konferenzen
Der Titel der Konferenzen stellt einen guten Überblick über die Entwicklung der Begriffsdefinitionen dar. 1972 ist die Conference on the Human Environment. Die Umwelt ist im Mittelpunkt der Betrachtung, Interdependenzen sind nicht zu erkennen. Es gibt geradlinige Probleme, für die simple, technisch machbare Lösungen propagiert werden. In Rio ist bereits von der Conference on Environment and Development die Rede. Die Verknüpfung zwischen Armut und Umweltzerstörung ist hergestellt. Auch die Lösungsvorschläge werden differenzierter, die Komplexität der Probleme wie der Lösungsmöglichkeiten erfordert eine genauere (auch theoretische) Auseinandersetzung mit dem Thema. 2002 in Johannesburg ist
diese Entwicklung zu einem vorläufigen Ende gekommen mit der Einbeziehung des Begriffs der Nachhaltigkeit, beim World Summit on Sustainable Development. Die Nachhaltigkeit stellt aber nicht einfach die logische Verknüpfung von Entwicklungshilfe und Umweltschutz dar, sondern beinhaltet eine ganzheitlichere Herangehensweise, indem sie die zukünftig mögliche Nutzung von Naturgütern sicherstellen soll, so dass zukünftige Generationen mindestens dieselben und ebensoviele Ressourcen zur Verfügung haben wie die aktuelle.
2. Das Recht auf die eigenen Ressourcen
Der großen Sorge der unabhängigen Nationalstaaten, dass Umweltgesetzgebung sie in ihrer Souveränität oder ihrem Wirtschaftswachstum einschränken könnte, wurde mit einem eigenen Prinzip in der Abschlusserklärung von Stockholm (und Rio) Rechnung getragen. Der entsprechende Passus lautet 1972: „Principle 21
States have, in accordance with the charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other states or of areas beyond the limits of national jurisdiction.“ 8
Das bei der Stockholmer Konferenz verwendete Prinzip taucht um einen einzigen Begriff ergänzt zwanzig Jahre später als Prinzip 2 wieder auf. In der Rio-Deklaration heißt es: „States have [...] the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies [...].“ 9 Die Verknüpfung von Umwelt- und Entwicklungspolitik trägt dem gewandelten Verständnis von Nachhaltigkeit Rechnung, das vor allem durch den Brundtland-Report von 1987 geprägt wurde. Der Report stellte vor allem die erste allgemeine Definition von Nachhaltigkeit vor. Nachaltige Wirtschaftsweise sollte die Bedürfnisse der gegenwärtigen Generation befriedigen können, ohne die Wirtschaftsfähigkeiten zukünftiger Generationen zu gefährden.10 Unterentwicklung und Umweltzerstörung sind interdependent und können nicht mehr getrennt voneinander betrachtet werden, ein Verständnis, das sich vorher schon angedeutet, aber so noch nicht durchgesetzt hatte. Dies ist ein erster Hinweis auf die Durchlässigkeit der Abschlusserklärungen für theoretische wie praktische Veränderungen von Entwicklungs- und Umweltschutzpolitik.
[...]
1 www.cites.org
2 BGBl. 1994 II S. 2704.
3 BGBl. 1988 II S. 902.
4 BGBl. 1982 II S. 374.
5 http://www.unep.org/Documents/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503, nachfolgend „1972“.
6 http://www.unep.org/Documents/Default.asp?DocumentID=78&ArticleID=1163, nachfolgend „1992“.
7 http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POI_PD.htm, nachfolgend „2002“.
8 1972, Prinzip 21.
9 1992, Prinzip 2.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Textes?
Dieser Text analysiert die Entwicklung der weltweiten Umweltschutzzusammenarbeit anhand der Abschlusserklärungen der drei größten Weltumweltkonferenzen: Stockholm (1972), Rio de Janeiro (1992) und Johannesburg (2002). Es wird untersucht, wie sich die Akteure, Themen und das Verständnis von Nachhaltigkeit im Laufe der Zeit verändert haben.
Welche Konferenzen werden in dem Text analysiert?
Die analysierten Konferenzen sind:
- Die United Nations Conference on the Human Environment in Stockholm (1972)
- Die United Nations Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro (1992)
- Der World Summit on Sustainable Development in Johannesburg (2002)
Warum werden gerade die Abschlusserklärungen analysiert?
Obwohl die Abschlusserklärungen rechtlich unverbindlich sind, ermöglichen sie eine freiere und von Stimmungen beeinflussbarere Darstellung der Entwicklung im Bereich des Umweltschutzes. Sie geben Aufschluss über veränderte Mentalitäten, den Einfluss neuer Akteure und ein verändertes Verständnis von Themen wie Armut und Umweltzerstörung.
Wie hat sich der Fokus der Konferenzen im Laufe der Zeit verändert?
Der Fokus hat sich von einer reinen Betrachtung der Umwelt (Stockholm) über die Verknüpfung von Umwelt und Entwicklung (Rio) hin zu einem ganzheitlichen Verständnis von nachhaltiger Entwicklung (Johannesburg) entwickelt.
Was bedeutet das "Recht auf die eigenen Ressourcen" im Kontext der Konferenzen?
Das Prinzip des "Rechts auf die eigenen Ressourcen" (Principle 21 in Stockholm, Principle 2 in Rio) räumt Staaten das souveräne Recht ein, ihre eigenen Ressourcen im Rahmen ihrer Umwelt- und Entwicklungspolitik zu nutzen. Gleichzeitig tragen sie die Verantwortung, sicherzustellen, dass ihre Aktivitäten die Umwelt anderer Staaten nicht schädigen.
Welche Rolle spielt der Brundtland-Report in der Entwicklung des Nachhaltigkeitsbegriffs?
Der Brundtland-Report von 1987 lieferte die erste allgemeine Definition von Nachhaltigkeit, indem er feststellte, dass nachhaltige Wirtschaftsweise die Bedürfnisse der gegenwärtigen Generation befriedigen sollte, ohne die Wirtschaftsfähigkeiten zukünftiger Generationen zu gefährden. Er betonte die Interdependenz von Unterentwicklung und Umweltzerstörung.
- Arbeit zitieren
- Nils Harder (Autor:in), 2003, Nachhaltige Entwicklung - Umweltpolitik im Wandel, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108629