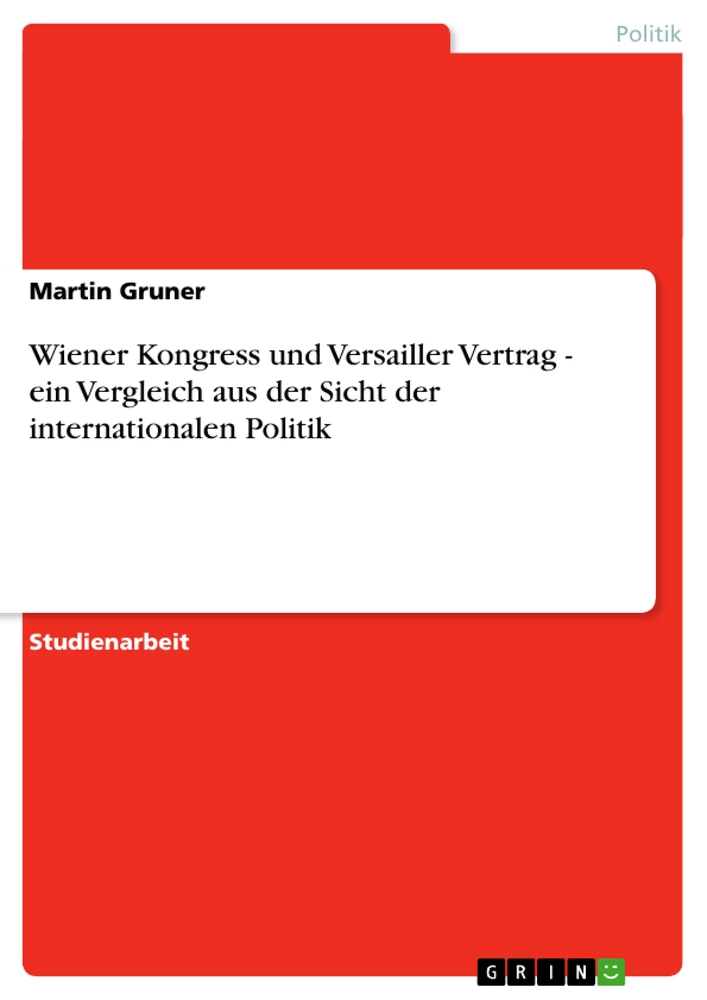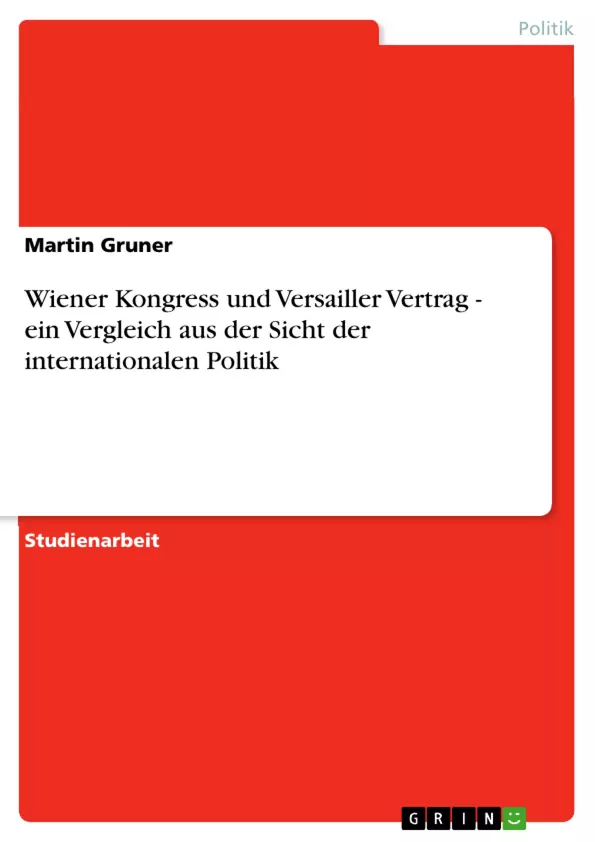Nach der politischen Theorie nach, stellen sowohl die Schlussakte von Wien (1814/15), als auch der Versailler Vertrag (1918) Sicherheitsordnungen dar, um den Frieden nach einem Krieg in Europa wieder herzustellen.
Diese Studie zieht einen Vergleich zwischen Wiener Kongress und dem Versailler Vertrag aus dem Blickwinkel der Internationalen Politik. Besonders die Sicherheitspolitik steht hierbei im Mittelpunkt: Mit den Kriterien "Krise" , "Rolle" und "Intervention", die sich wie ein roter Faden durch die Analyse ziehen, werden die beiden Verträge miteinander verglichen. Konkret heißt dass, es werden die Ursachen der beiden Konflikte, die Handlungsspielräume der Akteure und deren Krisenmanagement untersucht. Natürlich darf hierbei die Nachhaltigkeit der diplomatischen Vereinbarungen nicht fehlen.
Als Einstieg in die vergleichende internationale Politikwissenschaft ist diese Arbeit sehr zu empfehlen.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Historischer Abriss
Vergleich der Indikatoren
Die Krise
Die Rolle
Die Intervention
Wiener Kongress und Versailler Vertrag unter genauerer Betrachtung
Der Wiener Kongress 1814/15
Der Versailler Vertrag 1918
Fazit
Literaturangaben
Einleitung
Mehr und mehr wird die internationale Politik zur Sicherheitspolitik. Durch Macht- gleichgewicht, Machtkontrolle oder Machtausübung entstehen Systeme der Internatio- nalen Sicherheit. Durch ein Wechselspiel zwischen Krieg und Frieden lösen sie sich fortwährend ab1.
Das „Klassische Gleichgewichtssystem“ nach dem Westfälischen Frieden wurde durch die französische Revolution und die darauffolgenden napoleonischen Kriege vom „eu- ropäischen Konzert“ der Großmächte auf dem Kongress in Wien abgelöst. Ein theoreti- sches Gleichgewicht sollte Europa in der Waage halten und so den errungenen Frieden sichern. Mit dem Zusammenbruch dieses „Konzertes“ weitete sich die Sicherheitspoli- tik erstmals auch über die Grenzen Europas hinaus aus. Bei den Verhandlungen über den Versailler Vertrag war nun die Idee der kollektiven Sicherheit mittels Machtkontrolle im Zentrum der Überlegungen.
Marius Schneider verfolgt dieses Wechselspiel weiter über die Konferenz von Jalta, dem Ende des kalten Krieges, bis hin zur neuen Rolle der Nato der Gegenwart. Im Rahmen dieser Seminararbeit können und sollen nur die Sicherheitsordnungen von Wien und Versailles zur näheren Untersuchung herangezogen werden. An Hand von Schneiders Vorüberlegungen werden besonders die Unterschiede der Sicherheitssyste- me herausgearbeitet. Bei diesen Betrachtungen rücken vor allem Schneiders Definitio- nen der Begriffe „Krise“, „Rolle“ und „Intervention“ in den Blickpunkt.
Historischer Abriss
Sowohl die Wiener Schlussakte, als auch der Versailler Vertrag sind aus politischer Sicht völkerrechtliche Verträge zur Beendigung zwischenstaatlicher, kriegerischer Aus- einandersetzungen und damit der Grundstein für eine Neuordnung Europas. Die Bereit- schaft, ein System des Friedens und der Stabilität zu etablieren, eint die Beteiligten über die Jahrhundertgrenze hinweg.
Das Zustandekommen der Verträge ist jedoch in ihrer Art konträr. Während Frankreich als Kriegsaggressor –und verlierer schon bald wieder ein gewichtiges Mitbestimmungs- recht während der Verhandlungen in Wien hatte, wurde Deutschland der Versailler Ver- trag als Oktroy unterschriftsreif vorgelegt. Dass dieses Verfahren selbst bei einigen Sie- germächten auf Ablehnung stieß, zeigt sich durch die Nichtratifizierung und den Ab- schluss eines separaten Friedens zwischen den USA, sowie weiteren Nationen mit dem Deutschen Reich in den Folgejahren bis 1921. Im Verlauf der Analyse innerhalb dieser
Seminararbeit stehen aber nicht die Artikel zur Diskussion, die die Bestimmungen und Auflagen für das Deutsche Reich betreffen, sondern nur der erste Teil des Vertrages zur Satzung des neugeschaffenen Völkerbundes.
Vergleich der Indikatoren
Um untersuchen zu können, wie aus der Umsetzung bestimmter Sicherheitskonzeptio- nen sich diese weiterentwickeln oder verändern2, führt Schneider sog. Indikatoren ein. Diese Indikatoren (von Schneider auch „Brückenkonzepte“3 genannt) sind willkürlich gewählt und zweifelsohne erweiterbar. Wichtig erscheint die Tatsache, dass erst die wechselseitigen Beziehungen der Indikatoren den Charakter einer Sicherheitsordnung beschreiben können.4
Die drei zu behandelnden Indikatoren werden kurz erläutert und begrifflich eingegrenzt, bevor die zwei zu untersuchenden Sicherheitssysteme an Hand dieser genauer betrachtet werden.
Die Krise
Jede politische Ordnung, und somit auch die hier zu erläuternden Sicherheitsordnungen, obliegt definierten Regeln und Rollenverteilungen. Sobald eine Regelverletzung auftritt, kann man von einer „Krise“ sprechen. Es liegt an dem System selbst, wie es die Krise meistert. An Hand der Maßnahmen, die die Akteure innerhalb der politischen Ordnung ergreifen, lassen sich gute Rückschlüsse auf die Ordnung selbst führen.
Wie im Folgenden gleich gezeigt wird, ist die Ansicht der Akteure, ob nun ein Krisen- fall vorliegt oder nicht, selten eindeutig. Auf jeden Fall erzeugt die Krise beiden Akteu- ren einen Handlungsbedarf, der allzu oft nur durch die Entscheidung zwischen „Krieg und Frieden“ gelöst werden kann.5 Diesem Handlungsbedarf schließt sich die Untersu- chung des Zustandes der Ordnung nach der Krise an. Hat sich das System reproduzieren können oder war es nicht krisensicher und konnte nicht im bestehenden Rahmen wei- tergeführt werden? Die Beantwortung dieser Frage ist ein guter Indikator für die Stabili- tät der politischen Ordnung.
Die Rolle
Der Rollenbegriff beschäftigt sich mit dem Verhältnis der Akteure zu– und untereinan- der. Im Bereich der internationalen Politik sind diese Überlegungen allgegenwärtig.
Z.B. wird nach der „Rolle“ der EU im Nahostkonflikt gefragt oder die „Rolle“ der USA innerhalb von Europa untersucht. Betrachtet man die Überlegungen genauer, zeigt sich, dass die „Rolle“ eigentlich eine Frage der „Integration eines Akteurs in der Gesamtord- nung“6 ist. Über das aktuelle Verhalten eines Akteurs innerhalb des Rollenkonzeptes lassen sich leicht Rückschlüsse über die Wertestruktur der Sicherheitsordnung ziehen. Die Untersuchung zeigt aber auch die Unterschiedlichkeit der Akteure – und auch ihre Gemeinsamkeiten. An den Rollenerwartungen zeigt sich, ob das System harmonisch ist.
Die Intervention
Dieser Indikator ist eine tatsächliche politische Handlung an Hand deren das Ordnungs- system untersucht werden kann. Marius Schneider sieht die Intervention als wichtigen Indikator, weil „die Durchführung einer Intervention die Frage der legitimen Gewalt- anwendung entscheidet; sie entscheidet zudem darüber, wer (Ordnungsstruktur) in wes- sen Namen (Wertestruktur) diesen Akt ausführen darf“7. Zu beachten ist, dass die Inter- vention stets die Grenze der „Souveränität“ überschreitet. Natürlich darf die Interventi- on nicht rein als militärische Intervention gesehen werden, sondern sie umfasst auch ökonomische Maßnahmen (beispielsweise Handelsblockaden) und politischen Druck von außen. Die Untersuchung der Intervention wird mit hinzugezogen, da sich durch ei- ne Änderung der Interventionspraxis Rückschlüsse auf eine Veränderung des Ord- nungsprinzips einer Sicherheitsordnung ziehen lassen. Auch die Begründungen für eine Intervention lassen gut die Unterschiede der Sicherheitsordnungen aufzeigen.
Wiener Kongress und Versailler Vertrag unter genaue- rer Betrachtung
Wie zu Beginn des vorangegangenen Abschnittes schon betont wurde liegt die Aussa-
gekraft der Indikatoren in ihrer Gesamtheit. Erst alle drei Begriffe gemeinsam erlauben Einschätzungen und Vergleiche über die Sicherheitsordnungen ziehen zu können. Im folgenden soll nun untersucht werden, in wie weit sich die „Brückenkonzepte“ bei zwei konkreten Sicherheitsordnungen anwenden lassen und wo sie sich unterscheiden.
Die zu untersuchenden Ordnungen repräsentieren einen „politischen Konsens, wie eine Sicherheitsordnung für Europa gestaltet sein könnte“8. Sowohl Wien als auch Versailles sind Momente der Einheit, die jedoch nicht all zu lange währten. Ein Schwerpunkt der Analyse wird genau diese Frage sein: Warum konnten sich diese mühsam ausgehandel- ten Sicherheitsordnungen nicht reproduzieren?
Der Wiener Kongress 1814/15
Das Schlagwort des Kongresses ist genauer betrachtet ein Paradox: Mit der Idee der
„Restauration“ wird Europa komplett neu gestaltet und unter den damaligen Großmäch- ten eine Friedensordnung verankert, die sich historisch dem Westfälischen Frieden und dem Frieden von Utrecht anschließt. Charakteristisch für diese neue Ordnung ist das Bewusstsein aller Akteure für ein gemeinsames europäisches Interesse.9 Doch wie kam es zum Bruch dieses Konsens?
Mit der Unterzeichnung der Wiener Schlussakte sollten mehrere Probleme vertraglich gelöst sein: Die Allianz der Großmächte hat sich neu konstituiert, das Problem der terri- torialen Neuordnung scheint gelöst und die Fragen bezüglich Wiedererschaffung bzw. Wiedereinsetzung politischer Akteure sind vermeintlich beantwortet. Dies alles ist um- klammert vom Prinzip des „Gleichgewichts der Mächte“. Doch so stabil diese neue Ordnung auch scheint, Veränderungen innerhalb des Systems kann sie nicht bewältigen und ist durch ihre rückwärtsgewandte Status-quo-Denkweise zum Scheitern verurteilt.
Besonders deutlich wird dies, wenn der Indikator „Krise“ näher betrachtet wird: Zu Be- ginn ist das „Gleichgewicht der Macht“ noch gleich zu setzten mit der Ausgewogenheit der Territoriengröße bzw. mit den Einwohnerzahlen eines Staates10. Schon bei der säch- sisch-polnischen Krise zeigt sich, dass dieses auf purer Rechnerei basierende System nicht fortgeführt werden kann. Das Fundament eines Gleichgewichts ist demnach politi- sche Macht und Einfluss und nicht die Quadratkilometerfläche der einzelnen Staaten.
[...]
1 Woyke (2000), S.196
2 Schneider (2003), S.106
3 Schneider (2003), S.106
4 Schneider (2000), S.146
5 Schneider (2003), S.130
6 Schneider (2003), S.134
7 Schneider (2003), S.138
8 Schneider (2003), S.149
9 Vgl. Kissinger (1991), S.180-186
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptfokus des Textes?
Der Text analysiert Sicherheitsordnungen in Europa, insbesondere den Wiener Kongress 1814/15 und den Versailler Vertrag von 1918, im Hinblick auf Krisen, Rollen und Interventionen.
Welche Indikatoren werden zur Analyse der Sicherheitsordnungen verwendet?
Der Text verwendet drei Hauptindikatoren: Krise, Rolle und Intervention. Diese Indikatoren dienen dazu, die Eigenschaften und Unterschiede der Sicherheitsordnungen zu vergleichen.
Was wird unter dem Indikator "Krise" verstanden?
Eine "Krise" wird als Regelverletzung innerhalb einer politischen Ordnung definiert. Die Art und Weise, wie das System eine Krise bewältigt, gibt Aufschluss über seine Stabilität und Beschaffenheit.
Wie wird der Begriff "Rolle" im Text verwendet?
Der Begriff "Rolle" bezieht sich auf das Verhältnis der Akteure zueinander und zur Gesamtordnung. Es geht darum, wie ein Akteur in die Gesamtordnung integriert ist und welche Erwartungen an seine Rolle gestellt werden.
Was bedeutet "Intervention" im Kontext des Textes?
Die "Intervention" wird als eine politische Handlung verstanden, die die Souveränität eines Staates überschreitet. Dies kann militärische, ökonomische oder politische Maßnahmen umfassen. Die Art und Weise, wie eine Intervention durchgeführt und begründet wird, zeigt die Prinzipien einer Sicherheitsordnung auf.
Inwiefern unterscheiden sich Wiener Kongress und Versailler Vertrag?
Während Frankreich beim Wiener Kongress trotz seiner Rolle als Kriegsaggressor wieder ein Mitbestimmungsrecht hatte, wurde Deutschland der Versailler Vertrag als Oktroy vorgelegt. Der Wiener Kongress basierte auf dem Prinzip des Gleichgewichts der Mächte, während der Versailler Vertrag die Idee der kollektiven Sicherheit durch den Völkerbund verfolgte.
Was waren die Schwächen des Wiener Kongresses?
Der Wiener Kongress konnte Veränderungen innerhalb des Systems nicht bewältigen und war durch seine rückwärtsgewandte Status-quo-Denkweise zum Scheitern verurteilt.
- Quote paper
- Martin Gruner (Author), 2004, Wiener Kongress und Versailler Vertrag - ein Vergleich aus der Sicht der internationalen Politik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108655