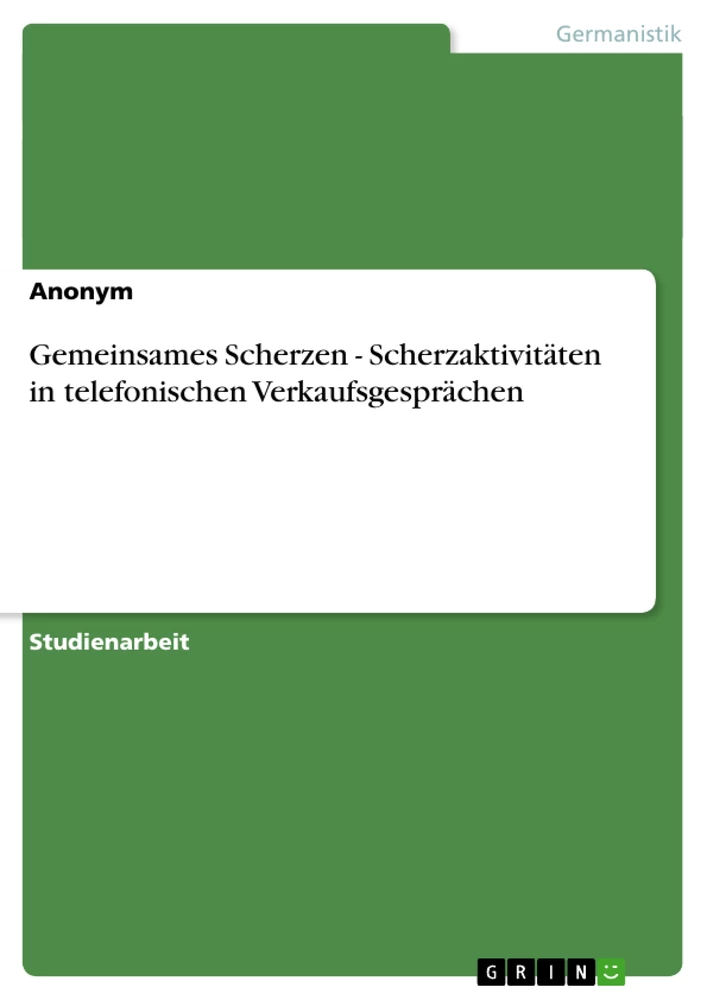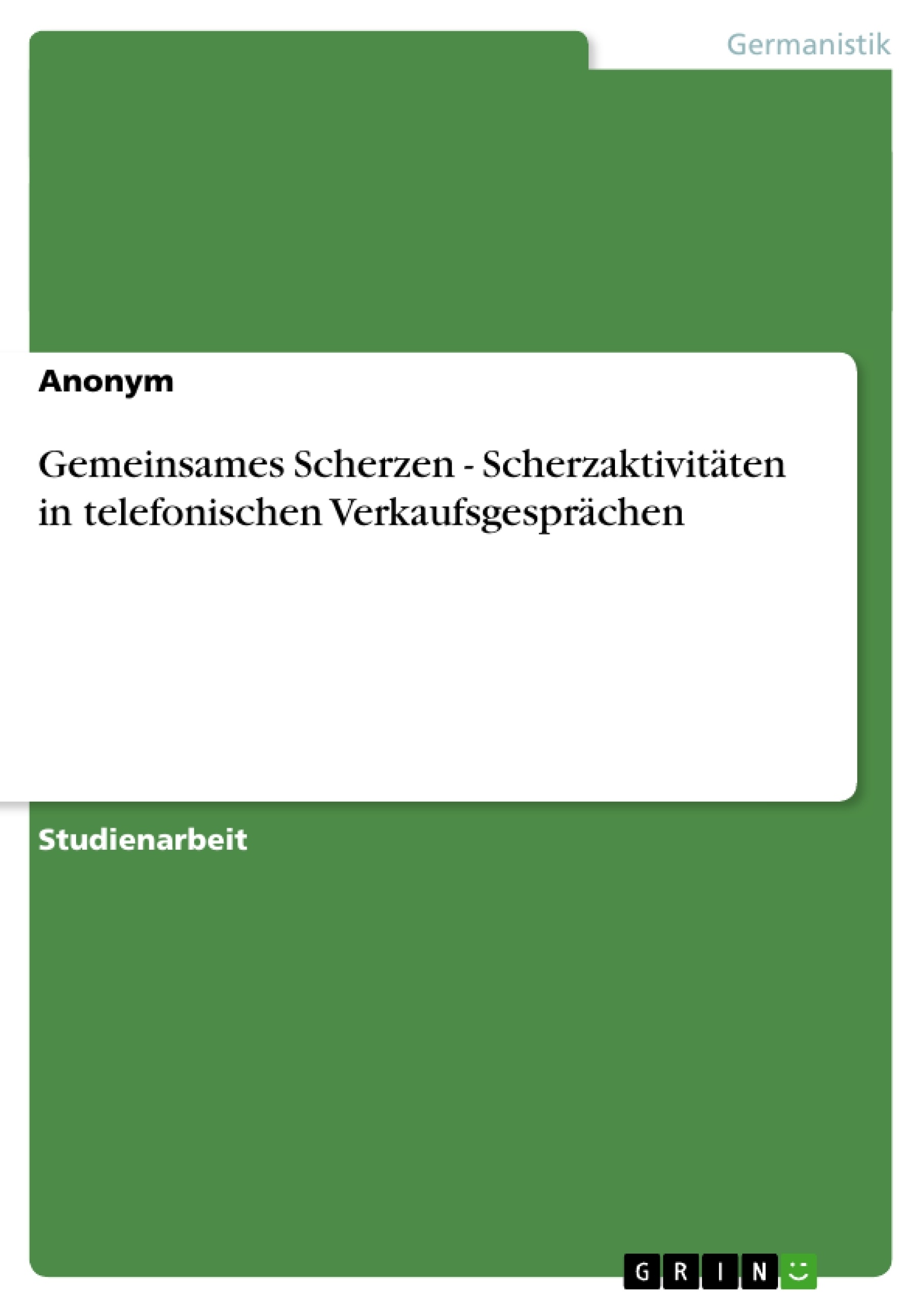Inhalt:
1. Gemeinsames Scherzen: Thema, Ziele
2. Grundlagen des Gemeinsames Scherzens im Alltag
2.1. Witziges, Humor, Komik und Lachen
2.2. Scherzaktivitäten
2.2.1. Scherz light!
2.2.2. „Humor ist wenn man trotzdem lacht“ – Vom Necken und Frotzeln
3. Gemeinsames Scherzen in der Wirtschaft
3.1. Scherz als Konfliktlöser – Joking Relationship
3.2. Der Scherz als Machtinstrument
3.3. Der Scherz als Beziehungsknüpfer
4. Einzelfallanalyse
5. Schluss
6. Anmerkungen zur Transkription
7. Literaturangaben
1. Gemeinsames Scherzen: Thema, Ziele
Seit etwa 20 Jahren steht die humoristische Alltagskommunikation nun als Forschungsobjekt im Blickfeld der Sprach- und Gesprächsanalyse. (vgl. Kotthoff, 2002, 1.)1 Vor dieser Zeit wurde Lachen als reflexartige Reaktion auf ein externes Ereignis gesehen. Durch einen äußeren Einfluss wird also Lachen ausgelöst. Damit wurde ihm keine angemessene und eine sehr einseitige Bedeutung gegeben. Das „Komisch-Machen“ eines Ereignisses, also die selbständige humorvolle Gestaltung einer Situation wurde ihm damit völlig abgesprochen. Menschen nutzen aber gerade im Alltag oftmals diesen initiativ-kreativen Faktor von Scherz- und Witzformen, um Interaktionen zu gestalten. So werden zum Beispiel Beziehungen durch das alltägliche gemeinsame Scherzen definiert, Normen werden signalisiert, Identitäten kommuniziert und Verbindendes gegenseitig aufgezeigt. (vgl. Kotthoff, 1996, 7/8)
Gerade in der Wirtschaft, in meiner Arbeit am Beispiel des telefonischen Verkaufsgespräches dargestellt, sind diese Eigenschaften von Scherzkommunikation wichtig. Meine Arbeit beschäftigt sich erst kurz mit den Grundlagen von gemeinsamen Scherzen, behandelt die Eigenarten des Alltagshumors und beschäftigt sich mit den Unterschieden zwischen Witzigem, Humor, Komik und Lachen. Danach werde ich aus Platzgründen nur beispielhaft auf Aktivitätstypen des gemeinsamen Scherzens eingehen. Hier habe ich einmal eine Gruppe von eher leichten Scherzaktivitäten und als zweiten Punkt eine Gruppe von Scherzaktivitäten „mit Biss“ zusammengefasst. Im Anschluss möchte ich mich dem Scherz in der Wirtschaft widmen und hier drei Eigenschaften des Scherzes aufzeigen. Erst wird hier der Scherz als Konfliktlöser bei krisenreichen Situationen am Beispiel der Joking Relationship dargestellt., danach beschreibe ich kurz, wie der Scherz als Machtinstrument eingesetzt werden kann und wende mich dann dem Scherz als wirtschaftlichen Beziehungsknüpfer zu. Den Schluss meiner Arbeit bildet eine Einzelfallanalyse eines telefonischen Verkaufsgespräches. Dort werde ich die beziehungsgebende Rolle des Scherzens bei wirtschaftlichen Interessen aufzeigen und kurz erläutern.
2. Grundlagen des Gemeinsamen Scherzens im Alltag
Gemeinsames Scherzen in der Wirtschaft, wozu ich auch meine spätere Beispielanalyse des telefonischen Verkaufsgesprächs gewählt habe, wird dem Bereich des gemeinsamen Scherzens im Alltag untergeordnet. Um die Eigenschaften des gemeinsamen Scherzens in der Wirtschaft zu erläutern möchte ich deshalb im folgenden Teil zunächst die Grundlagen des Alttagsscherzens darstellen.
Alltagshumor weist einige Besonderheiten auf. So baut im Alltagshumor der Scherz auf gemeinsamem Wissen auf. Dies führt natürlich unweigerlich zu einer Gruppenbildung. Einmal die Gruppe der Personen, die den Scherz verstehen können (In-Group), weil sie das gleiche Vorwissen haben und die Gruppe der Personen, die hier keinen Witz erkennen, weil ihnen das dazu erforderliche Wissen fehlt (Out-Group). An späterer Stelle meiner Ausführungen wird die Bedeutung dieses Unterschieds im Bezug auf die Berufswelt klar. Die Komik im Alltagshumor liegt oft nur auf zwei oder drei Ebenen, meist Sprechstil, Rahmenbruch oder Anspielung, aber auch Worte und Mimik spielen hier eine Rolle. (vgl. Kotthoff, 2002, 1./1.2.)
Die Scherzkommunikation grenzt Komik, Humor und den Witz voneinander ab. Was darunter verstanden wird und welche Rolle dem Lachen zugesprochen wird, möchte ich im nächsten Abschnitt kurz darstellen. Im Anschluss möchte ich auf den Bereich „Scherzaktivitäten“ eingehen und hier einige Aktivitätstypen von gemeinsamem Scherzen vorstellen, hier einmal in lockerer Scherzform (Wortspiel, witzige Bemerkungen und Anekdoten) und jene die eine etwas verschärfte Scherzform aufweisen (Necken, Frotzeln).
2.1. Witziges, Humor, Komik und Lachen
Von den verschiedenen Facetten des gemeinsamen Scherzens ist der Witz in Ethnologie, Psychologie, Psychoanalyse, Sprach und Literaturwissenschaft am besten erforscht. Dies mag daher kommen, dass der Witz kontextfrei in Schriftform jedem am einfachsten zugänglich gemacht werden kann. Man muss hier nicht mehr viel erklären. Im alltäglichen Scherzen hat der Witz allerdings gegenüber anderen Scherzarten eine kleinere Rolle. Wichtig bei Witzigkeit ist, dass sie mit einer Pointe arbeitet. So gibt es einen kurzen Rätselmoment, in dem sich auf einen Schlag ein Sinn ergibt, der nicht erwartet wurde. Dieser plötzliche Wechsel, auch Switch genannt, wird über ein mehrdeutiges Element vermittelt. (vgl. Kotthoff, 2002, 1.1.) Der Humor ist nun weiter gefasst. Er kann über Witziges hinausreichen und somit in den Bereich der Komik stoßen. Hier ist aber zu beachten, dass man komisch, im Gegensatz zum Humor, sehr wohl auch unbeabsichtigt sein kann. Die Komik benötigt auch keine Pointe. Sie legt Assoziationen nahe. So wird beispielsweise imitiert und hierbei übertrieben (Parodie, Karikatur). Ein Beispiel hierfür ist es, wenn man im Freundeskreis einen Bekannten nachmacht, um sich über ihn lustig zu machen oder ihn spielerisch aufs Korn zu nehmen. Hierbei werden oft Stimme und Mimik verändert, um die Imitation möglichst echt wirken zu lassen. Bei den Scherzelementen Komik und Witziges muss noch angemerkt werden, dass es im reellen Sprachgebrauch zu einer Vermischung von Witzigem und Komischem kommt. (vgl. Kotthoff, 1996, 9 und Kotthoff, 2002, 1.1.)
Das Lachen wird als erwartete und bevorzugte Reaktion auf Witziges oder Komisches gesehen. Allerdings geht es noch weit darüber hinaus. Oftmals wird es auch dazu eingesetzt, etwas komisch zu machen. Hier kann es zum Beispiel dazu eingesetzt werden, um dem Gegenüber zu signalisieren, dass er eine mündliche Äußerung nicht so ernst nehmen soll. Auch nach Erzählungen mit problematischem Inhalt wird Lachen oft dazu genutzt, das eben benannte Problem etwas abzumildern, um ihm die Schärfe zu nehmen. Aber auch Kritik oder resolutes Auftreten wird durch Lachen abgeschwächt. Lachen schafft Sympathie und lockert die Atmosphäre. Man lacht aber auch aus reiner Freundlichkeit. So zum Beispiel, wenn man einen Scherz nicht verstanden hat, aber sein Gegenüber nicht kränken will. Dieses eingestreute Lachen kann von dem Gegenüber nun angenommen werden (d.h. er lacht mit) oder eben abgelehnt werden. (vgl. Kotthoff, 2002, 1.1. und Werner, 1983, 226 ff)
2.2. Scherzaktivitäten
Um zu ersehen, in welchen verschiedenen Formen sich das gemeinsame Scherzen abspielt, kann man es in verschiedene Aktivitätstypen einteilen, von denen ich hier aber nur einige näher vorstellen möchte. Hierbei ist noch anzumerken, dass die meisten Scherzaktivitäten als Mischungen aus den einzelnen Aktivitätstypen auftauchen. Die einzelnen Aktivitätstypen lassen sich nach Helga Kotthoff (2002, 1.2.) anhand der folgenden Dimensionen einteilen:
1. das kommunikative Manöver, welches die Teilnehmenden durchführen, indem sie etwas Witziges produzieren (Wortspiel, Gedankenwitz, Anspielung, Aussprache, Grimasse...); also das, was gesagt wird;
2. die Zielscheibe des Scherzes (ob vorhanden oder nicht und welcher Art); also auf wen oder was sich der Scherz bezieht;
3. das Thema der Scherzaktivität; also worum es sich im Scherz handelt;
4. mögliche Motive der Humoristen; also warum der Scherz gemacht wurde;
5. die Art der Teilnahme am Gespräch im Hinblick auf die Struktur der Rede-rechtsverteilung; also was wird wie, wann, wie lange, etc. gesagt;
6. die Zusammensetzung der Gruppe; also wer ist an dem Scherz beteiligt.
Eine Unterscheidung der einzelnen Aktivitätstypen lässt sich anhand der Schärfe des Scherzes machen. So gibt es Scherze, die eher locker sind (was ich hier als „leichte“ Aktivitätstypen bezeichne) und Scherze, die einen Gewissen harten Kern in sich tragen. Aus beiden Gruppen erläutere ich nun Beispiele.
2.2.1. Scherz light!
Bei den leichten Aktivitätstypen ist zunächst das Wortspiel zu nennen. Beim Wortspiel kommt es meist zu der Nutzung von Mehrdeutigkeiten oder zum Wörtlichnehmen von eigentlich metaphorischen Elementen. (vgl. Kotthoff, 2002, 1.2.1.) Hier beispielsweise, wenn in der Fahrschule der Schüler dem Lehrer zu dicht an den Straßenrand gerät, der Lehrer darauf hin seinen Arm aus dem Fenster streckt und sagt: „Besser Arm dran, als Arm ab“. Hier wird nun der Phrase „Arm dran sein“ für „Nicht gut gehen“ eine neue Bedeutung zugewiesen. Im Denken erfolgt durch die Ergänzung „als Arm ab“ nun ein Bedeutungswechsel und das mehrdeutige Element „Arm dran“ wird hier wörtlich genommen, so dass der Schüler weiß, er hat mehr Abstand zu den parkenden Autos am Straßenrand zu halten.
Als zweiten Punkt möchte ich die witzige Bemerkungen erläutern, deren Eigenschaft es ist, durch eine Pointe einen völlig neuen Sinn herzustellen. Zwei Elemente aus dem Kontext werden miteinander verbunden. (vgl. Kotthoff, 2002, 1.2.1.) So zum Beispiel, wenn im Zoo ein überfälliges Küken noch nicht geschlüpft ist und der überbemutternde Pfleger seinem Chef berichtet: „Das Küken will einfach nicht schlüpfen“. Der Chef entgegnet: „Setzen Sie sich einfach mal drauf. Dann will es vielleicht.“ Das eigentliche Thema wird durch eine Pointe des Chefs umgeleitet und eine witzige Bemerkung entsteht durch die Verknüpfung des Eis und der mütterlichen Führsorge des Pflegers.
Nun möchte ich mich den Anekdoten widmen. Hierbei wird Selbsterlebtes in humoristischer Art verpackt und entsprechend vorgetragen. (vgl. Kotthoff, 2002, 1.2.1.) Beispiele hierfür findet man oft im reellen Leben. Lustige Geschichten, die man selbst erlebt hat, werden hier oftmals mit anderen kommuniziert.
2.2.2. „Humor ist wenn man trotzdem lacht“ – Vom Necken und Frotzeln
Scherzaktivitäten, bei denen der Scherz in größeren Maße personalisiert wird, machen auch einen wichtigen Teil in gemeinsamen Scherzen aus. Eine Form dieser Art von Humor ist das Necken. Hierbei werden kleine Fehler des bescherzten auf leichte Art und Weise in einen Scherz verpackt. Neckereien sind keinesfalls so hart wie Frotzeleien, mit denen ich mich gleich noch näher beschäftige, allerdings beinhalten sie kleine Spitzen, die aber meist liebevoll gemeint sind. Im Flirt werden Neckereien zum Beispiel auch dazu benutzt, sich näher zu kommen und eine Beziehung aufzubauen.
Frotzeleien sind nun eine härtere Form. Mit Frotzeleien provoziert man sein Gegenüber auch. Dies geschieht mit Ironie, Übertreibung und provokanten Fiktionalisierungen. Die Reaktion auf Frotzeleien kann demnach entweder als ernsthafte Verteidigung erfolgen oder mit einem Scherz erwidert werden. Das Frotzeln hat aber auch gerade das Vermögen, den Umgang einer Gruppe miteinander klarer zu machen, was gerade auch im wirtschaftlichen Scherz von Bedeutung sein kann. So frotzelt man nur miteinander, wenn man sich gut kennt, also eine engere Beziehung miteinander hat. Damit setzt man eine Grenze zwischen In-group und Out-group. Ein hohes Wissen ist hier erforderlich, um mit seinem Gegenüber zu Frotzeln. Somit kann auch geprüft werden, wie es um eine Beziehung steht, das heißt wie weit eine Beziehung reicht und welche Art diese hat. Außerdem ist Frotzeln eine Möglichkeit, sich auf scherzhafter Basis etwas zu sagen, was ernsthaft gesagt nicht tragbar wäre. Hier kann man Handlungsnormen und Werte nennen, über die in ernsthafter Form nicht mehr öffentlich diskutiert werden kann. (vgl. Kotthoff, 2002, 1.2.2. und Günthner, 1996, 81 ff)
3. Gemeinsames Scherzen in der Wirtschaft
In den vorgegangenen Teilen meiner Arbeit, habe ich die Grundlagen des gemeinsamen Scherzens kurz dargestellt. Dem gemeinsamen Scherzen in der Wirtschaft und damit auch dem Scherzen bei Verkaufsgesprächen, kommt allerdings eine besondere Rolle zu, die ich nun im nächsten Teil erläutern und deren Gemeinsamkeiten und Schwerpunkte ich im Bezug auf den Alltagsscherz hier darstellen will.
3.1. Scherz als Konfliktlöser – Joking Relationship
Der Scherz kann gerade bei ernsten Problemen sehr mildernd wirken. Das bedeutet nicht, dass das Problem damit nicht diskutiert wird oder unangetastet bleibt. Es wird vielmehr in einer eher lockeren Art einem Personenkreis deutlich gemacht. Das heißt, dass ernste Probleme, die man normal nicht öffentlich zu äußern vermag, durch den Scherz doch mitgeteilt werden können. (vgl. Kotthoff, 2002, 1.2. und Schütte, 1996, 194)
Um den Scherz als Konfliktlöser näher zu erläutern, möchte ich auf das Konzept der Scherzbeziehung („Joking Relationship“) eingehen. Zum Verständnis soll als Beispiel der Umgang mit dem Scherz in Naturvölkern dienen. Der Scherz hat hier unter anderem auch eine bereinigende Wirkung. Dinge, die durch die hierarchische Struktur der Großfamilie nicht kommuniziert werden können, werden durch „Phasen eines rituellen wechselseitigen Spotts zugelassen“. (zit. Schütte, 1996, 193) So werden Ungereimtheiten angesprochen und die Struktur und der Stand der Familienmitglieder nicht verletzt. Die Scherzbeziehung ist nun also als Beziehung zwischen zwei Personen zu sehen, die das konventionelle Recht haben, über ihr Gegenüber Spott zu betreiben. Dies kann noch weiter gehen, indem dieses Spotten sogar die Pflicht einer Person ist, um die Harmonie in der Gruppe zu stabilisieren. Hier ist allerdings wichtig, dass die bespottete Person dies nicht als verletzend oder beleidigend ansehen darf. Betrachtet man sich in diesem Zusammenhang nun die Wirtschaft, so wird einem klar, dass es auch hier zu solchen Scherzbeziehungen kommt. In krisenlastigen Situationen wird hier durch den Scherz das professionelle Arbeiten gesichert und die kollegiale Beziehung zwischen den einzelnen Personen bleibt gewahrt. Die Harmonie im Arbeitsbetrieb wird hier also auch durch den Scherz gesichert. Die Krise wird entlastet und die Probleme werden dennoch beachtet. Es ist auch nicht fern, dass die Joking Relationship in der Wirtschaft bewusst zu diesem Zwecke eingesetzt wird. Auch das Wechselspiel zwischen dem Frotzeln der Scherzbeziehung und einer ernsthaften Unterhaltung ist hier eine problementlastende Strategie. (vgl. Schütte, 1996, 193-195)
Die Scherzbeziehung kann nun also wirtschaftlich gesehen einiges leisten. Sie erleichtert das berufliche Handeln, indem sie Spannungen, Krisen und Feindseligkeiten zwischen den einzelnen Agierenden vermeidet. Gleichzeitig signalisiert sie aber Kommunikationsbereitschaft und vermeidet so ein Verhärten der wirtschaftlichen Fronten. (vgl. Schütte, 1996, 216)
3.2. Der Scherz als Machtinstrument
Lachen und Scherzen kann in der Wirtschaft zu Steuerungszwecken eingesetzt werden. Hier kann es zum Beispiel bei der Durchsetzung in Gesprächen eine Rolle spielen. Der in der Hierarchie höher stehende Gesprächteilnehmer kann Lachen und Scherzen hier bewusst systematisch gebrauchen, um seinen Standpunkt durchzusetzen. Es beeinflusst den Verlauf und das Ergebnis eines Gesprächs somit ungemein und kann in der Wirtschaft sehr nützlich sein. (vgl. Thimm/Augenstein, 1996, 221/225)
Der Scherz dient aber auch als Bestätigung der Hierarchiestufe und somit als Bestätigung der eigenen Macht. So kann man feststellen, dass in der Wirtschaft meist zu Lasten einer in der Hierarchie niedriger stehenden Person gescherzt wird. Personen, die in der Hierarchie dagegen einen kleinen Standpunkt haben, scherzen meist über ihren eigenen Stand und der Scherz in Richtung einer höheren Hierarchiestufe wird in seinem Scherzwert nicht im gleichen Maße anerkannt. Allerdings kann man mit Hilfe des Scherzes nicht nur die Hierarchiestruktur anerkennen sondern sie auch unterwandern. Der Scherz hat das Vermögen für kurze Zeit die Machtverhältnisse zu verändern. (vgl. Kotthoff, 2002, 2.2.)
3.3. Der Scherz als Beziehungsknüpfer
Dem Scherz als Berziehungsknüpfer kommt gerade in der Wirtschaft eine besondere Rolle zu, wie ich an meinem späteren Analysebeispiel auch noch deutlicher zeigen werde. Hier möchte ich nun zunächst auf das Bilden von In- und Out-Groups eingehen. In der vorangegangener Einführung über gemeinsames Scherzen habe ich schon darauf hingewiesen, dass der Alltagsscherz nur mit gemeinsamem Wissen verstanden wird. Diese Eigenschaft spricht ihm im beruflichen Umfeld eine bedeutende Rolle zu. Durch gemeinsames Scherzen und dem Bilden von In-Groups grenzen sich hier Berufgruppen, aber auch einzelne Teilbereiche in einem Betrieb voneinander ab. (vgl. Schütte, 1996, 216) Diese Bildung einer In-Group kann natürlich auch zu wirtschaftlichen Zwecken eingesetzt werden. So wird der Scherz hier dazu eingesetzt, um eine Beziehung bei Verkaufsgesprächen und Ähnlichem zwischen Kunden und Verkäufer aufzubauen und diese dann zum Abschluss eines Handels zu nutzen. Gemeinsames Lachen führt hier zur Beziehungsschaffung, minimiert die Fremdheit zwischen Käufer und Verkäufer und schafft eine positive Kaufstimmung auf Seiten des Käufers. (vgl. B rünner, 2000, 122 ff) Aber auch bei der Beziehungsbildung zwischen Kollegen ist der Scherz ein wichtiges Mittel. Dadurch, dass über eine Person im gleichen beruflichen Umfeld gescherzt wird, kann diese Person als Kollege gesehen werden. Dieser muss jenen Scherz natürlich, wie bei eben erwähnter Joking Relationship gesehen, nicht als Beleidigung sehen. Mit diesem Akt des gemeinsamen Scherzens und der positiven Reaktion des Bescherzten ist eine kollegiale Bindung entstanden und der Bescherzte wird als Kollege anerkannt. (vgl. Schütte, 1996, 216) Nun muss hier allerdings auch gesagt sein, das solche Frotzelaktivitäten in ironischer Form und verschärft betrieben im Arbeitsumfeld auch als sehr negativ interpretiert und sogar juristisch verfolgt werden können. Dieses ironische, zu weit gehende Frotzeln wird dann als Mobbing bezeichnet. (vgl. Hartung, 1996, 111)
Der Scherz hat also in der Wirtschaft auch die Aufgabe, sich einer Gruppe zugehörig zu zeigen und sich somit von anderen abzugrenzen, Beziehungen zu schaffen und diese auch wirtschaftlich einzusetzen oder auch Bindungen und Kollegialität herzustellen. Im nun anschließenden Teil, der Einzelfallanalyse, will ich auf die beziehungsschaffenden Eigenschaften der Scherzkommunikation am Beispiel eines telefonischen Verkaufsgespräches eingehen.
4. Einzelfallanalyse
Bei folgendem Beispiel handelt es sich um ein telefonisches Verkaufsgespräch. Ich analysiere es hier auf Formen von Scherzaktivitäten, die zu einer Beziehungsbildung und schließlich zu einem Handel zwischen Verkäufer und Käufer führen. Die besondere Situation dieses Verkaufgespräches ist es, dass hier der Verkäufer nicht explizit als solcher zu erkennen ist. Der Verkäufer, Thorsten, arbeitet im Callcenter des Weltbildverlages und bekommt hier für seine Tätigkeit ein Fixgehalt und eine Provision pro Verkauf. Er ist also sehr an einem Handel mit dem Käuferin, Gerlinde, interessiert. Dieses ökonomische Interesse auf Seiten des Verkäufers wird nun durch die Tarnung eines Servicegespräches der Kundenbetreuung verschleiert. Zu erwähnen ist hierbei noch, dass Thorsten auf einem Bildschirm alle Kundendaten einsehen und bearbeiten kann und dass das Verkaufsgespräch ohne Telefonleitfaden geführt wird, man aber trotzdem davon ausgehen kann, dass Thorsten einen „inneren Faden“ im Sinn hat. Gerlinde gilt als zufriedene Kundin des Weltbildverlages und soll zu weiteren Einkäufen animiert werden. Das Verkaufsgespräch fand am Dienstag, den 12. November 2002, um 19 Uhr statt und dauerte 3,26 Minuten.
In meiner ersten Sequenz führt er nun eine Befragung durch, um seine Bildschirmdaten abzugleichen und gleichzeitig eine Beziehung aufzubauen. Im Vorfeld hat sich Thorsten bereits vorgestellt und darauf hingewiesen, dass Gerlinde „persönlich“ erreicht werden sollte. Hier arbeitete er schon mit Wiederholungen des Kundennamens und Wörtern wie „Kundenbetreuung“ an einer Grundbeziehung und stellt somit sicher, dass Gerlinde den Eindruck gewinnt, dass sie dem Weltbildverlag sehr wichtig ist.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Thorsten hält hier noch vollkommen seine Tarnung als Kundenbetreuer aufrecht, in dem er in Zeile 01-02 nachfragt, ob Gerlinde mit ihrer erhaltenen Lieferung des Weltbildverlages zufrieden war. Die Beziehung zwischen Beiden ist für seine eigene Intention, den Verkauf eines Buches noch nicht weit genug fortgeschritten. Durch das nachfragende „ja?“ bringt er Gerlinde weiterhin dazu, mehr von sich und ihrer Meinung preiszugeben, damit er sie als Person besser einschätzen kann. Gerlindes „jo ich hoffe halt das=s so bleibt(.)ne? HE“ (Zeile 06) stellt hier nun den Beginn des Beziehungswandels dar. Die ehemals fremde Beziehung wird durch den lachähnlichen Partikel „HE“ schon etwas aufgelockert. Sie signalisiert damit die Bereitschaft, eine engere Beziehung einzugehen. Sogleich hakt Thorsten nach, indem er feststellt „die Bücher haben ihnen gefallen“ (Zeile 07). Die positive Aussage wird damit noch mal aufgegriffen und konkretisiert. Wieder nutzt Thorsten sein fragendes „ja?“ (Zeile 09), um Gerlinde zum Weiterreden zu bewegen und die bisher bestehende Beziehung zu bestätigen. Mit Gerlindes „ja=ja“ in Zeile 10 setzt sie hier nun zunächst eine Grenze, bekommt aber durch Thorstens zögerndes „und ä=ä“ in Zeile 11 das Gefühl, sich weiter öffnen zu müssen. Indem sie sagt „unn was ma=nit gefalle=hat hab ich weitergeschenkt=is ke Problem HE HE“ (Zeile 12/13) macht sie vor allem mit dem problemreduzierenden lachähnlichen Partikeln „HE HE“ deutlich, dass sie an der positiven Beziehungsschaffung zu Thorsten festhalten will. Sie nimmt aber gleichzeitig auch alle eventuelle Kritik von Thorsten und dem Weltbildverlag. Durch die scherzhafte Abmilderung ihres Nichtgefallens und der darin befindlichen Kritik, ist es in der Tat „ke Problem“ selbst wenn Gerlinde die Bücher nicht zusagen sollten. Sie fordert Thorsten geradezu auf, das eben Gesagte nicht so ernst zu nehmen. Thorsten nutzt sogleich die Situation, indem er fast lobend und freudig sagt: „‘achso=das tun sie auch öfter fü:r bekannte=verwandte als geschenk [...]“ (Zeile 14/15/17). Gerlinde antwortet mit leichtem Lachen (Zeile 16) und zeigt somit ihre Freude über die positive Aufnahme ihres Verschenkens. Durch diese Passage macht Thorsten aber auch deutlich, dass keinerlei Kritik am Weltbildverlag und den Buchsendungen zu finden sei. Dies nicht zuletzt durch Thorstens Äußerung, die nicht etwa die Kritik in Gerlindes Aussage betont, sondern die gute Idee, Sachen die ihr nicht gefallen weiterzuschenken. Gefestigt wird diese positive Empfindung dann durch Gerlindes „j`a:= natürlich(.)ja. HE“. Wieder fällt der lachähnliche Partikel „HE“ auf, mit dem Gerlinde ihre positive Haltung zum Ausdruck bringt. Sie signalisiert dadurch aber auch, dass die Beziehung der Beiden nun schon fortgeschritten ist. Nun kann Thorsten seine Befragung auch ganz offen und direkt fortführen, indem er sachlich die Adresse auf ihre Richtigkeit überprüft.
Hier konnte man nun also sehen, wie durch Scherzkommunikation, in dieser Sequenz vor allem durch lachähnliche Partikel, Bereitschaft zum Schaffen einer Beziehung signalisiert wurde, aber auch immer wieder das Fortschreiten der Beziehung und schließlich die Beziehung selbst bestätigt und gefestigt wurde. Gerade mit seinem forschenden „ja?“ hat Thorsten immer wieder den Stand der Beziehungsgestaltung abgefragt und Gerlinde hat mit ihren lachähnlichen Partikeln signalisiert, dass sie dazu eine positive Einstellung hat.
In der nächsten Sequenz wird nun ein offener Scherz zum Thema. Hier wird deutlich, wie die Beziehung von Gerlinde und Thorsten schon fortgeschritten ist und so für das ökonomische Interesse auf der Seite von Thorsten genutzt werden kann. Er befragt sie hier nach dem Buch, das Gerlinde zuletzt beim Weltbildverlag bestellt hatte:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Thorsten stellt hier fest, dass das letzte Buch von Gerlinde „Die Menopause“ hieß (Zeile 01/02). Da diese letzte Regelblutung der Frau kein gern thematisiertes Objekt ist, entsteht hier erst der Scherzcharakter. Durch Thorstens Frage „war das für sie? oder haben=se das auch verschenkt?“ wird deutlich, wie eng die Beziehung fortgeschritten ist, denn bei einer zu fremden Frau wäre diese Frage als eher heikel anzusehen. Das auf Gerlindes Bestätigung folgende fast schon geneckte „ja?“ von Thorsten lässt Gerlinde nun nicht viele Möglichkeiten offen. Sie kann entweder die Beziehung weiter bestätigen oder blockieren. Sie entschließt sich, sich weiter auf die Beziehung einzulassen und antwortet mit einem Scherz: „oder was wolln=se jetz hörn HE HE HE“ (Zeile 06) Durch ihr anschließendes Lachen markiert sie diesen noch mal explizit und Thorsten signalisiert mit seinem Lacheinsatz, dass er den Scherz verstanden hat. Durch ihr gemeinsames Wissen und ihre vorher schon geleistete Beziehungsarbeit bilden sie nun eine In-Group, einen durch den Scherz aneinander gebundenen Gemeinschaft. Durch die nun folgende Verknüpfung von weiterem Verkaufsgespräch und scherzhafter Anspielung wird diese auch durch Scherzkommunikation geschaffene Beziehung dazu genutzt, die Verkaufsinteressen von Thorsten umzusetzen. Er streut nun seine ökonomische Frage „sie interessieren sich aber auch für (.) gesundheitsbücher=oder?“ ein und verknüpft diese im nächsten Satz mit der Wiederholung des Scherzes: „auch wennHEs nIchHEgerade die menopause isHE(t)“(Zeile 17). Wiederum mit lachähnlichen Partikeln wird der Scherzcharakter dieser Aussage deutlich gemacht. Er kommt also durch den Scherz nun seinem Ziel, einem weiteren Buchverkauf, näher. Thorsten bestätigte später selbst, dass er in solchen Gesprächen den Scherz gerne weiter nutzt, um den Redefluss in Gang zu halten und den Käufer dadurch zum Kauf zu bewegen. Es wurde also in der Sequenz deutlich, wie das Schaffen von In-Groups und Beziehungen, die auf Scherzkommunikation beruhen, für wirtschaftliche Zwecke genutzt werden können.
Im weiteren Gesprächverlauf wird nun kurz über das zu erwerbende Produkt informiert und Gerlinde sagt schließlich den Kauf zu. Ab diesem Zeitpunkt ist die Beziehung nun unwichtig für Thorsten geworden, er versucht, das Gespräch schnellstmöglichst zu beenden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gerlinde hat sich für den Kauf des Produkts entschieden. Gleich im Anschluss leitet Thorsten die Beendigung des Gesprächs ein: „und nOch eine fra:ge- frau:-=äh=fleiner“ (Zeile 03/04). Schon mit dem Zusatz, dass es nur noch eine Frage gibt, stellt er klar, dass er das Gespräch gerne beenden möchte. Gerlinde stimmt einem zukünftigen Verkaufsgespräch zu (Zeile 08/10). Thorstens nachfragendes „ja?“ (Zeile 11) animiert Gerlinde zum Wiederaufgreifen ihres Scherzes: „ja=gErn wenn=sie mich nit unbedingt nach der menopause (´fro:gde)“ (Zeile 12/13) Sie hält also weiterhin an der durch Scherzkommunikation geschaffenen Beziehung fest. Wie der Konvention entsprechend setzt Thorsten mit Lachen ein, wodurch auch Gerlinde sich in ihrem Scherz bestätigt fühlt und mitlacht (Zeile 14/15). Thorsten streut hier noch eine Bemerkung ein, die aber auch zum Gesprächsende hinführt (Zeile 16/17). Danach reduziert er sein Lachen und signalisiert hier wieder das Ende des Gesprächs (Zeile 19). Auf Gerlindes „okay“ (Zeile 20) wählt er sogleich eine Floskel um dem Gespräch ein Ende zu setzen. Gerlinde gewinnt somit das Gefühl, das Gespräch selbst beendet zu haben, was gerade für die weiterhin positive Einstellung zu Thorsten und dem Weltbildverlag für ein späteres Verkaufsgespräch wichtig sein könnte.
Hier wird also durch den Scherz und die Reaktion darauf zum Gesprächs-ende gefunden. Durch die lockere Verabschiedung, die mit Lachen und lachähnlichen Partikeln durchsetzt ist, wurden die negativen Aspekte eines solchen eigentlich abrupten Abbruchs völlig in den Hintergrund gedrängt. Gerlinde fühlt sich nicht nur als Kundin sondern auch als Mensch wichtig für den Weltbildverlag. Auf zukünftigen Verkaufsgesprächen wird sie wohl weiterhin offen reagieren.
5. Schluss
Gemeinsames Scherzen im Alltag hat viele Facetten. So reicht es von einfachen lachähnlichen Partikeln über inszenierte witzigen Äußerungen bis hin zur spontanen Komik. Lustig kann etwas Unerwartetes, ein unvorhersehbares Ereignis oder eine entsprechende Reaktion aber auch etwas explizit komisch Gemachtes sein. Dabei lassen sich mehrere Aktivitätstypen feststellen. Hier reicht die Palette von leichten Typen wie Wortspiele, witzige Bemerkungen oder Anekdoten bis zu bissigem Humor, zu dem das Necken und Frotzeln zählt. Der Scherzcharakter lässt sich aber nur mit gemeinsamem Wissen erkennen. Man lacht nur über das, was man durch Vorwissen als lustig einstufen kann. Dadurch schafft gemeinsames Scherzen Beziehungen, es bildet In-Groups und grenzt somit auch andere Personen ohne jenes gemeinsame Wissen als Out-Group ab. Der Scherz schafft also Nähe und Zugehörigkeit und wird hier in der Wirtschaft auch beispielhaft dazu eingesetzt. Einmal um Kollegialität und eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen, aber auch um ökonomische Interessen im Kunde-Verkäuferverhältnis durchzusetzen. Aber auch als Konfliktlöser ist er wichtig, um Krisen und Probleme möglichst für alle Beteiligten gesichtswahrend zu bewältigen und dennoch ausreichend kommuniziert zu haben. Hier hat die Joking Relationship einen hohen Stellenwert. Mit dem Scherz lässt sich aber auch Macht bestätigen und neu verteilen, bestehende Hierarchien werden bestätigt oder unterwandert. Mit Scherzen kann man unter anderem auf der Beziehungsebene steuernd wirken.
In meiner Analyse konnte man sehen, wie die beziehungsknüpfenden Eigenschaften des gemeinsamen Scherzens in der Wirtschaft angewandt werden. Im Beispiel des telefonischen Verkaufsgesprächs wurde durch Scherzkommunikation der Fortschritt der Beziehung durch lachähnliche Partikel bestätigt und Nähe hergestellt. Die Fremdheit der Agierenden wurde Schritt für Schritt abgebaut. Durch gemeinsames Scherzen bilden Verkäufer und Käuferin eine In-Group und haben dadurch eine Beziehung geschaffen, auf der der Verkäufer seinerseits seine ökonomischen Interessen, hier der Verkauf eines Buches, in die Tat umsetzen kann. Gleichzeitig werden krisenreiche Momente, wie eine schnelle Gesprächsbeendigung, durch Scherzkommunikation entlastet und der Käuferin eine weiterhin positive Stimmung in Bezug auf das Wirtschaftsunternehmen mitgegeben.
Die Nutzung des Scherzes zur Beziehungsschaffung und weiteren Gestaltung hat in der Wirtschaft (und hier speziell im telefonischen Verkaufsgespräch) also auch eine wichtige Position. Scherzen bindet aneinander in einer positiven Art, die gerade für die Ökonomie von großer Wichtigkeit ist.
6. Anmerkungen zur Transkription
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
7. Literaturangaben
- Brünner, Gisela (2000): Wirtschaftskommunikation: Linguistische Analyse ihrer mündlichen Form. Tübingen.
- Günthner, Susanne (1996): Zwischen Scherz und Schmerz – Frotzelaktivitäten in Alltagssituationen. In: Kotthoff, Helga (Hrsg.) (1996): Scherzkommunikation. Beiträge aus der empirischen Gesprächsforschung. Opladen. 81-108.
- Hartung, Martin (1996):Ironische Äußerungen in privater Scherzkommunikation. In: Kotthoff, Helga (Hrsg.) (1996): Scherzkommunikation. Beiträge aus der empirischen Gesprächsforschung. Opladen. 109-142.
- Kotthoff, Helga (2002): Lachkultur heute: Humor in Gesprächen. http://home.ph-freiburg.de/kotthoff/texte/Lachkulturen%20 heuteMainz2001.pdf. Zuletzt besucht: 15. März 2003
- Kotthoff, Helga (1996): Vorwort. In: Kotthoff, Helga (Hrsg.) (1996): Scherzkommunikation. Beiträge aus der empirischen Gesprächsforschung. Opladen. 7-19.
- Schütte, Wilfried (1996): “Die schäbige Geeje auf dem edlen Bratschenkasten”: Scherzbeziehungen und soziale Welten – ein Konzept zwischen Anthropologie und Konversationsanalyse. In: Kotthoff, Helga (Hrsg.) (1996): Scherzkommunikation. Beiträge aus der empirischen Gesprächsforschung. Opladen. 193- 220.
- Thimm, Caja und Augenstein, Susanne (1996): Lachen und Scherzen in einer Aushandlungssituation oder: Zwei Männer vereinbaren einen Termin. In: Kotthoff, Helga (Hrsg.) (1996): Scherzkommunikation. Beiträge aus der empirischen Gesprächsforschung. Opladen. 221-252.
- Werner, Fritjof (1983): Lachähnliche Partikeln in Redebeiträgen. In: Weydt, Harald (Hrsg.) (1983): Partikeln und Interaktion. Tübingen. 226-241.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Arbeit zum gemeinsamen Scherzen?
Diese Arbeit untersucht die humoristische Alltagskommunikation, insbesondere das gemeinsame Scherzen, als Forschungsobjekt der Sprach- und Gesprächsanalyse. Es werden die Funktionen des Scherzens im Alltag, wie die Definition von Beziehungen, Signalisation von Normen, Kommunikation von Identitäten und Aufzeigen von Verbindendem, betrachtet.
Welche Ziele verfolgt diese Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Grundlagen des gemeinsamen Scherzens im Alltag zu erläutern, die Unterschiede zwischen Witzigem, Humor, Komik und Lachen zu untersuchen und verschiedene Aktivitätstypen des gemeinsamen Scherzens (leichte und solche "mit Biss") vorzustellen. Außerdem soll die Bedeutung des Scherzes in der Wirtschaft, insbesondere als Konfliktlöser (Joking Relationship), Machtinstrument und Beziehungsknüpfer, aufgezeigt werden. Eine Einzelfallanalyse eines telefonischen Verkaufsgesprächs dient der Veranschaulichung der beziehungsgebenden Rolle des Scherzens bei wirtschaftlichen Interessen.
Welche Hauptinhalte werden in dieser Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Hauptinhalte:
- Grundlagen des gemeinsamen Scherzens im Alltag: Unterscheidung zwischen Witz, Humor, Komik und Lachen.
- Verschiedene Scherzaktivitäten: Leichte Scherzformen (Wortspiele, witzige Bemerkungen, Anekdoten) und solche mit stärkerem Bezug zur Person (Necken, Frotzeln).
- Der Scherz in der Wirtschaft: Seine Rolle als Konfliktlöser (Joking Relationship), Machtinstrument und Beziehungsknüpfer.
- Einzelfallanalyse: Untersuchung der beziehungsstiftenden Funktion des Scherzens in einem telefonischen Verkaufsgespräch.
Was versteht man unter "Joking Relationship" im Kontext dieser Arbeit?
Die "Joking Relationship" (Scherzbeziehung) wird als eine Beziehung zwischen zwei Personen beschrieben, die das Recht haben, ihr Gegenüber auf scherzhafte Weise zu verspotten. In manchen Fällen ist dies sogar eine Pflicht, um die Harmonie innerhalb einer Gruppe zu stabilisieren. In der Wirtschaft kann die Scherzbeziehung dazu dienen, Spannungen und Konflikte in krisenreichen Situationen zu mindern und die kollegiale Beziehung zwischen den Beteiligten aufrechtzuerhalten.
Wie wird der Scherz als Machtinstrument in der Wirtschaft eingesetzt?
Der Scherz kann von hierarchisch höher gestellten Personen eingesetzt werden, um ihren Standpunkt durchzusetzen und den Gesprächsverlauf zu beeinflussen. Er dient auch als Bestätigung der Hierarchiestufe und der eigenen Macht, indem oft zu Lasten von Personen gescherzt wird, die in der Hierarchie niedriger stehen. Gleichzeitig kann der Scherz aber auch dazu dienen, die bestehende Hierarchie zu unterwandern und Machtverhältnisse für kurze Zeit zu verändern.
Welche Rolle spielt der Scherz als Beziehungsknüpfer in der Wirtschaft?
Der Scherz dient dazu, In- und Out-Groups zu bilden, indem gemeinsames Wissen und Humor geteilt werden. Dies kann in der Wirtschaft genutzt werden, um Beziehungen zwischen Kunden und Verkäufern aufzubauen und den Verkauf zu fördern. Auch bei der Beziehungsbildung zwischen Kollegen spielt der Scherz eine wichtige Rolle, da er Kollegialität herstellen und die Zugehörigkeit zu einer Gruppe signalisieren kann.
Welche Aktivitätstypen des Scherzes werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen "leichten" Scherzaktivitäten wie Wortspielen, witzigen Bemerkungen und Anekdoten, und solchen mit einem stärkeren Bezug zur Person (Necken, Frotzeln). Diese Aktivitätstypen lassen sich anhand verschiedener Dimensionen einteilen, wie z.B. das kommunikative Manöver, die Zielscheibe des Scherzes, das Thema, die Motive der Humoristen, die Art der Teilnahme am Gespräch und die Zusammensetzung der Gruppe.
Was wird in der Einzelfallanalyse untersucht?
In der Einzelfallanalyse wird ein telefonisches Verkaufsgespräch untersucht, um die Formen von Scherzaktivitäten zu analysieren, die zu einer Beziehungsbildung und schließlich zu einem Handel zwischen Verkäufer und Käufer führen. Es wird insbesondere darauf eingegangen, wie Scherzkommunikation dazu genutzt wird, den Fortschritt der Beziehung zu bestätigen, Nähe herzustellen und ökonomische Interessen durchzusetzen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass gemeinsames Scherzen im Alltag viele Facetten hat und verschiedene Funktionen erfüllt, darunter die Definition von Beziehungen, Signalisation von Normen, Kommunikation von Identitäten und Aufzeigen von Verbindendem. In der Wirtschaft wird der Scherz zur Beziehungsschaffung, Konfliktlösung, Machtausübung und zur Förderung ökonomischer Interessen eingesetzt. Scherzen bindet auf positive Weise aneinander und ist somit von großer Bedeutung für die Wirtschaft.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2003, Gemeinsames Scherzen - Scherzaktivitäten in telefonischen Verkaufsgesprächen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108656