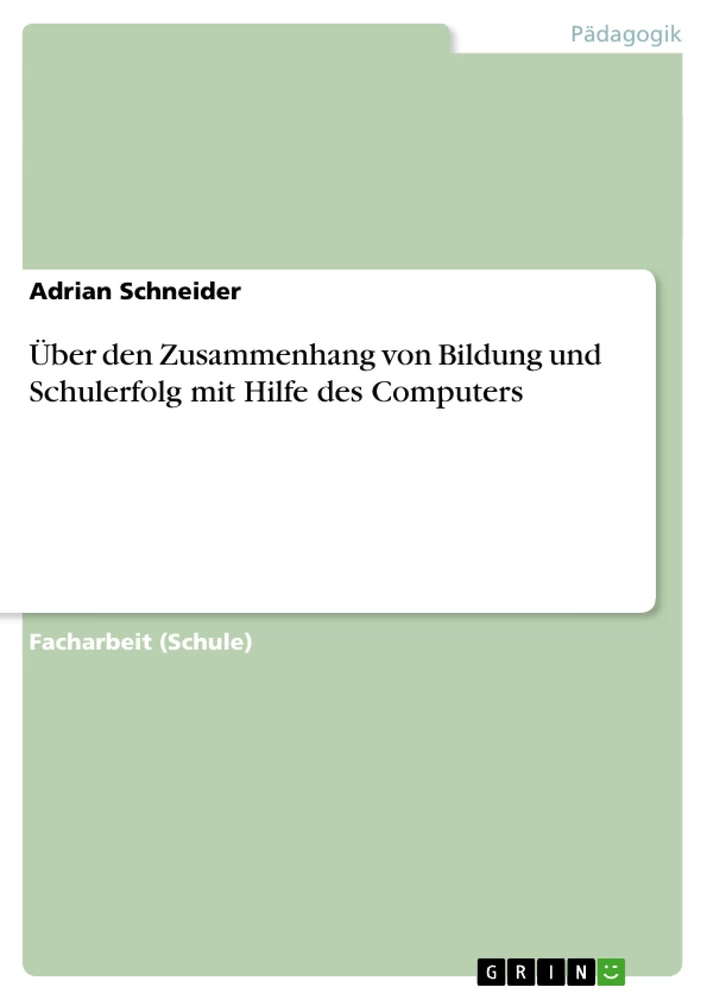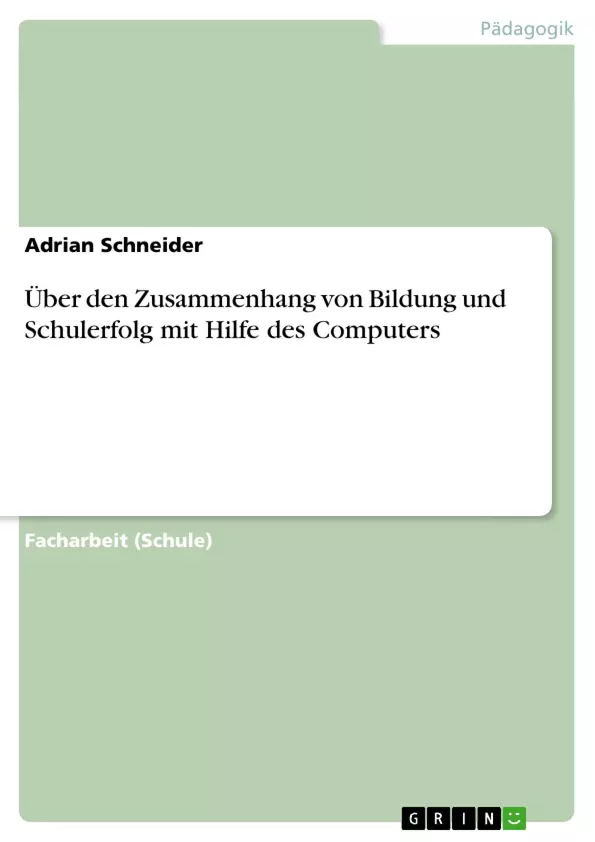Inhalt
1. Einleitung
2. Begriffsdefinitionen
2.1 „Computer“
2.2 „Bildung“
2.3 „Schulerfolg“
2.4 Zusammenhänge 3/
3. Statistik
3.1 IT Ausstattung der Schulen in Deutschland
4. Konzepte
4.1 Bewahrpädagogische Ansätze
4.2 Kritische Ansätze
4.3 Kompetenzorientierte Ansätze
4.4 Kindzentrierte Ansätze
5. Lernen mit dem Computer
5.1 Lerntypen
5.2 Lernmethoden
5.3 Software-Lösungen
6. Kritik
6.1 Gefahren
6.2 Kosten und Effizienz
6.3 Die Sinnfrage
7. Versuch eines Fazits
1. Einleitung
Jährlich werden viele Millionen Euro in die Anschaffung und Instandhaltung großer Computernetze in Schulen und Universitäten investiert. „Medienkompetenz“ ist ein vielgebrauchtes Wort in den Schlagzeilen, und der Computer scheint das Wundermittel zum schnellen und unkomplizierten Lernen für Kinder und Jugendliche zu sein.
Das Internet wird als riesige Informationsquelle hoch gelobt.
Da stellt sich die Frage, ob diese Annahmen wirklich der Realität entsprechen und ob sich diese riesigen Investitionen auszahlen. Was genau bringt der Computer im Hinblick auf Bildung und Schulerfolg der Kinder? Diese Frage soll in den folgenden Abschnitten pädagogisch untersucht werden.
2. Begriffsdefinitionen
2.1 Computer
(engl. to compute: „(be-)rechnen“ aus lat computare: „(zusammen-)rechnen“): Universell einsetzbares elektronisches Gerät zur automatischen Verarbeitung von Daten (nach bestimmten Programmen bzw. Programmablaufplänen)1
2.2 Bildung
ist das geistige Verknüpfen und in Relationsetzen von Faktizitäten durch Logik, Erfahrungen, Dialektik etc.
2.3 Schulerfolg:
Allgemein wird Schulerfolg als das Erreichen „guter Noten“ bzw. das Erreichen des Klassenziels, welches durch Richtlinien und Lehrpläne vorgeschrieben ist, definiert.
2.4 Zusammenhänge
Der Computer ist laut Definition ein Gerät, das lediglich Daten, also kleinste Informationseinheiten verarbeiten kann. Nun hat ein Datum an sich keinerlei Wert, wenn aus ihm nicht eine Information gebildet wird. Viele Daten können also eine Information bilden. Eine Information wird als Nachricht oder Auskunft definiert1 . Der Computer kann also lediglich Daten, ggf. auch Informationen liefern. Nur müssen aus den einzelnen Informationen Faktizitäten gebildet werden. Eine Faktizität (ein Fakt) besteht aus
einzelnen, gebündelten Informationen. Nun bringt der Computer aber lediglich Informationen, die jedes Subjekt, das mit dem Computer arbeitet, jedoch noch selektieren und durch den Vergleich mit weiteren Informationen (die auch der Computer
liefern kann) überprüfen muss. Durch diese Selektierung und Bündelung von
Informationen entstehen Faktizitäten.
Bildung bedeutet nun, dass diese Faktizitäten in Relation gesetzt und verknüpft werden. Diese Fähigkeit ist für einen Rechner allerdings unmöglich.
Was bedeuten diese Feststellungen für den Schulerfolg?
Wie oben erläutert, ist die Aufgabe des Lernenden, ihm gegebene Informationen zu Faktizitäten zu bündeln. In der Schule werden einem Schüler eben diese Informationen und unter Umständen auch Faktizitäten gegeben. Auch wenn ein Schüler Lernmethoden gelehrt bekommt, liegt es nach wie vor an seinem Vermögen, diese für sich selbst umzusetzen – also die Informationen und Faktizitäten so zu verarbeiten, dass er sie nutzen kann. Daraus folgt, dass, unabhängig davon wie der Schüler die Informationen übermittelt bekommt, es am Subjekt selbst liegt, diese zu seinem Nutzen und Verständnis zu verarbeiten.
So bleibt noch die Frage, welchen Vorteil der Computer beim Vermitteln von Informationen gegenüber anderen Lehrmitteln oder auch Lehrpersonen haben kann.
3. Statistik
3.1 IT Ausstattung der Schulen Deutschland
Im März 2001 ließ das Bundesministerium für Forschung und Bildung eine Statistik mit dem Titel
„ IT Ausstattung der allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen in Deutschland “2 anfertigen. Dabei wurden 25.393 Schulen in der gesamten Bundesrepublik berücksichtigt. Es wurden Grundschulen, Sekundarstufen I und II, allgemeinbildende Schulen und berufsbildende Schulen nach deren IT Ausstattung befragt. Die Ergebnisse sagen aus, dass zu diesem Zeitpunkt
„nur“ ca. 75% aller Grundschulen, allerdings nahezu jede allgemeinbildende Schule und berufsbildende Schule mit Computern ausgestattet war.2
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Des weiteren stellte sich heraus, dass bei der Benutzung der Geräte an den allgemein - bildenden Schulen am häufigsten Vokabel- und Grammatiktrainer, sowie Nachschlagewerke, und an den berufsbildenden Schulen Programme mit Werkzeugcharakter und Software zum Erstellen von Multimedia-Anwendungen genutzt werden.
Um diese Studie auf diese Untersuchung zu beziehen, ist festzuhalten, dass ein Großteil aller Schulen Computer benutzen. Dabei wird versucht, den Schülern das Lernen zu vereinfachen (Vokabeltrainer, etc.). Der Computer dient hier also als Werkzeug, um dem Lernenden Fakten zu vermitteln, nicht, ihn zu bilden.
4. Konzepte
Für die Arbeit mit Kindern im Umgang mit Medien sind umfangreiche Konzepte notwendig. Alle Konzepte zentrieren sich auf gemeinsames „Medienerleben“, und die Aufarbeitung der Erfahrungen der Kinder spielt eine große Rolle bei der Medienerziehung.
Die wichtigsten Ansätze sollen hier erläutert werden.
4.1 Bewahrpädagogische Ansätze
„Kinder sollen vor den negativen Einflüssen der Medien bewahrt werden. Daher sollten der Kindergarten und die Grundschule frei von elektronischen Medien wie Fernsehen, Video oder Computer gehalten werden.“3
Beim Bewahrpädagogischen Konzept wird von folgenden Grundannahmen ausgegangen:
- Medien haben direkten Einfluss auf den Rezipienten
- Medien können für Kinder und Heranwachsende ein großes Gefahrenpotential in Form von Sucht, Verführung und Manipulation bergen.
- Kinder und Jugendliche verfügen weder über die nötige kognitive, moralische noch die soziale Kompetenz, um Medienerfahrung richtig verarbeiten und einordnen zu können.
- Kinder sind der Reizüberflutung der „Massenmedien“ schutzlos ausgeliefert. Daraus ergeben sich grundsätzliche Ziele für das Bewahrpädagogische Konzept:
Kinder und Jugendliche müssen vor den Medien bewahrt und geschützt werden, und schädlichem Umgang mit Medien muss vorgebeugt werden.
Es muss ein Heranführen der Kinder an pädagogisch sinnvolle Medien(-produkte) erfolgen.
In der Praxis bedeutet dies eine globale Gesetzgebung zum Schutz der Kinder vor Medien, die negativen Einfluss auf die Entwicklung von Kindern haben können.
Jüngere Kinder sollen gänzlich von elektronischen Medien ferngehalten werden und der Medienkonsum von Heranwachsenden muss streng kontrolliert werden.
In der Alltagsgestaltung müssen alternative Beschäftigungs- und Lernmethoden bereitgestellt sein. Der Computer spielt hier also eine völlig untergeordnete Rolle in der Medienerziehung von Kindern und Jugendlichen und Medien werden generell nur eingesetzt, um Kindern die Gefahren und Risiken eben dieser Medien deutlich zu machen.
4.2 Kritische Ansätze
„Um Kindern zur nötigen Skepsis gegenüber dem vielfältigen Medienangebot zu verhelfen und sie gegen die Manipulationsabsichten der Medienmacher immun zu machen, sollen sie anhand von Beispielen über diese Sachverhalte aufgeklärt werden.“4
Das Kritische Konzept der Medienerziehung beruht auf der Grundannahme, dass Medien in einer kapitalistischen Gesellschaft eine „herrschafts- und damit gesellschaftsstabilisierende Funktion“4 haben. Daraus ergeben sich die Ziele, den Rezipienten zu einem kritischen Mediennutzer und –konsumenten zu erziehen, ihm die für die kritische Analyse nötigen technischen Kenntnisse zu vermitteln und ihn zu befähigen, die Medienkritik als Teil einer Gesellschaftskritik betrachten zu können.
Dazu gehört auch die Fähigkeit, Einfluss auf die medienrelevanten Institutionen nehmen zu können und die selbstkritische Betrachtung des eigenen Medienkonsums.
Praktisch bedeutet dies ein gemeinsames „Kennenlernen“ mit dem Kind und einer vertrauten Bezugsperson, Kritisieren und Analysieren von verschiedenen Medien und eine mit der Kritik verbundenen „Gegenöffentlichkeit durch handelnden Umgang mit Medien“4 , als dem Eingreifen ins „Mediengeschehen“. Hier wird dem Kind der Umgang z.B. mit dem Computer unter Berücksichtigung seiner wichtigen gesellschaftliche Rolle nahe gebracht. Dabei geht es nicht darum, dass der Computer den Rezipienten informieren oder gar bilden soll, sondern dass sich der Rezipient über den Computer und die Möglichkeiten, die ihm mit dessen Hilfe eröffnet werden können informieren soll.
[...]
1 „Computer“, in: Meyers Taschen Lexikon (Weltbild Sonderausgabe), Bd.2, Augsburg 1999, S.632
2 Bundesministerium f. Forschung u. Bildung „IT Ausstattung der allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen in Deutschland“, auf: http://www.bmbf.de/pub/it-ausstattung_der_schulen.pdf , 26.02.2001, 16:14
3 teachSam Medienpädagogik, „Konzepte zur Medienerziehung“ auf: http://www.teachsam.de/medien/medienpaed/medienpaed_erz_3_1.htm, 01.03.2002, 14:05
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die Titel, Inhaltsverzeichnis, Ziele, Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es dient dazu, eine pädagogische Untersuchung über die Auswirkungen des Computers auf Bildung und Schulerfolg von Kindern anzustellen.
Was sind die Hauptthemen, die in der Einleitung angesprochen werden?
Die Einleitung behandelt die hohen Investitionen in Computernetze an Schulen und Universitäten, die Bedeutung von "Medienkompetenz" und die Annahme, dass der Computer ein Wundermittel für schnelles und unkompliziertes Lernen ist. Es wird die Frage aufgeworfen, ob diese Annahmen der Realität entsprechen und ob sich die Investitionen im Hinblick auf Bildung und Schulerfolg auszahlen.
Welche Begriffsdefinitionen werden im Dokument erläutert?
Das Dokument definiert die Begriffe "Computer", "Bildung" und "Schulerfolg" und untersucht deren Zusammenhänge. Die Definitionen basieren auf verschiedenen Quellen und verdeutlichen, wie diese Begriffe im Kontext des Themas zu verstehen sind.
Wie wird der Begriff "Computer" definiert?
Der Computer wird als ein universell einsetzbares elektronisches Gerät zur automatischen Verarbeitung von Daten nach bestimmten Programmen definiert. Es wird auf die etymologische Herkunft des Wortes aus dem Englischen ("to compute") und Lateinischen ("computare") hingewiesen.
Wie wird "Bildung" definiert?
Bildung wird als das geistige Verknüpfen und in Relationsetzen von Faktizitäten durch Logik, Erfahrungen, Dialektik etc. definiert.
Wie wird "Schulerfolg" definiert?
Schulerfolg wird allgemein als das Erreichen "guter Noten" bzw. das Erreichen des Klassenziels, welches durch Richtlinien und Lehrpläne vorgeschrieben ist, definiert.
Welchen Vorteil kann der Computer beim Vermitteln von Informationen haben?
Das Dokument fragt, welchen Vorteil der Computer beim Vermitteln von Informationen gegenüber anderen Lehrmitteln oder auch Lehrpersonen haben kann.
Welche Statistik wird im Dokument angeführt?
Das Dokument zitiert die Statistik "IT Ausstattung der allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen in Deutschland" aus dem Jahr 2001 des Bundesministeriums für Forschung und Bildung. Diese Statistik untersucht die IT-Ausstattung von Schulen in Deutschland und die Art und Weise, wie Computer in verschiedenen Schultypen eingesetzt werden.
Welche Konzepte für den Umgang mit Medien werden erläutert?
Das Dokument erläutert verschiedene Konzepte für die Arbeit mit Kindern im Umgang mit Medien, darunter bewahrpädagogische und kritische Ansätze.
Was sind die wesentlichen Merkmale des bewahrpädagogischen Ansatzes?
Der bewahrpädagogische Ansatz zielt darauf ab, Kinder vor den negativen Einflüssen der Medien zu schützen, indem elektronische Medien in Kindergarten und Grundschule vermieden werden. Es wird davon ausgegangen, dass Medien ein Gefahrenpotential für Kinder darstellen und dass Kinder nicht über die nötige Kompetenz verfügen, Medienerfahrungen richtig zu verarbeiten.
Was sind die Grundannahmen des kritischen Ansatzes?
Der kritische Ansatz beruht auf der Grundannahme, dass Medien in einer kapitalistischen Gesellschaft eine "herrschafts- und damit gesellschaftsstabilisierende Funktion" haben. Das Ziel ist es, Rezipienten zu kritischen Mediennutzern und -konsumenten zu erziehen und ihnen die nötigen Kenntnisse für die kritische Analyse zu vermitteln.
- Quote paper
- Adrian Schneider (Author), 2002, Über den Zusammenhang von Bildung und Schulerfolg mit Hilfe des Computers, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108676