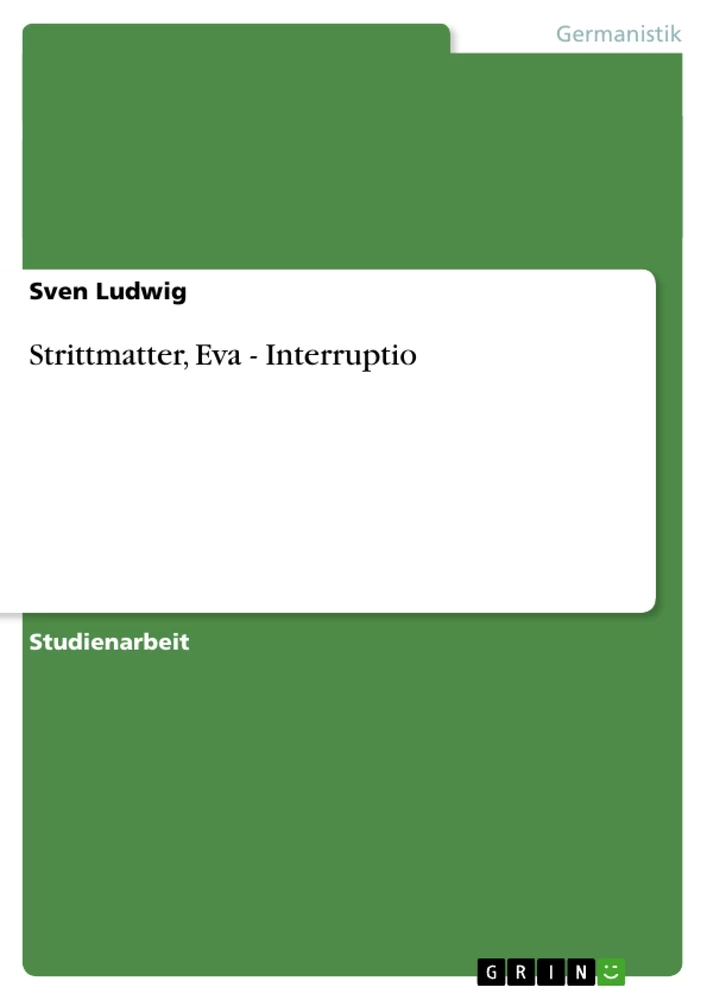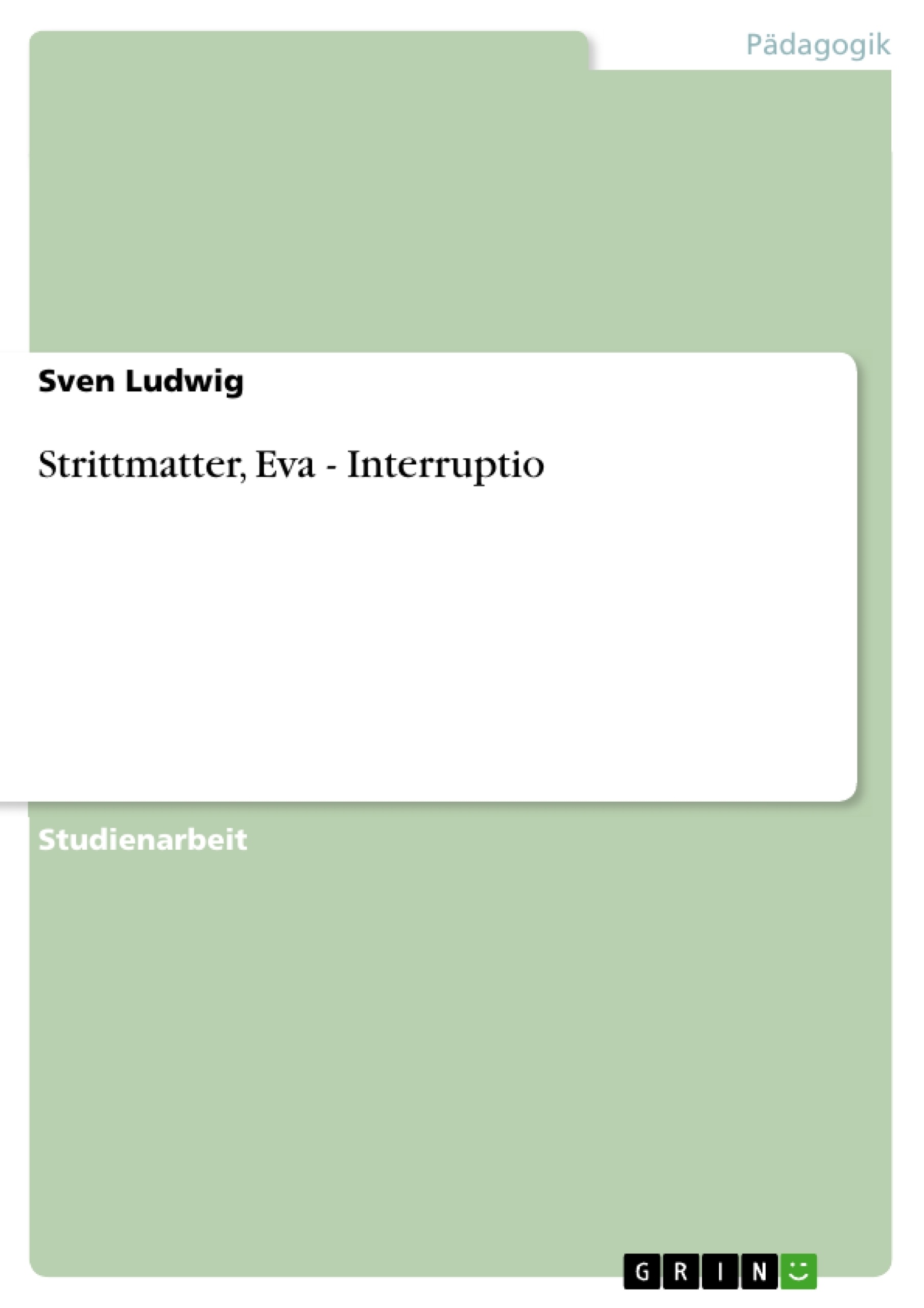Laut Statistischem Bundesamt gab es im vergangenen Jahr rund 124000 Abtreibungen. Die Dunkelziffer ist jedoch bei weitem höher. Wie kommt es dazu, dass so viele Jugendliche ungewollt schwanger werden und diese mit ärztlicher Hilfe abbrechen müssen? Wo man doch meinen müsste, dass in Deutschland schon im Grundschulalter mit der Aufklärung begonnen wird.
Das Gedicht Interruptio (lat. künstlicher Schwangerschaftsabbruch) von Eva Strittmacher schildert die Gefühle einer Frau nach einer ungewollten Schwangerschaft und deren Abbruch. Das Werk besteht aus lediglich einer Strophe mit vierzig Zeilen, welche sich in drei Abschnitte unterteilen lässt und im emotionalen Stil geschrieben ist. Jede Zeile beginnt mit einem großen Buchstaben. Die Dichterin lässt jedoch nicht jede Zeile mit einem Punkt enden, sondern benutzt zusätzlich Komma und Doppelpunkt, um die einzelnen Zeilen in ihrer Aussage zu bekräftigen.
Der erste Abschnitt beginnt mit der ersten Zeile und endet in Zeile acht. In diesem Abschnitt beschreibt das lyrische Ich Trauer und Vorwürfe gegenüber sich selbst. Diese Kritik wird durch die Personifikation Dämonen pfeifen im Wind und flüstern im Regen und speien mir ins Gesicht
unterstrichen. Dadurch wird dem Leser verdeutlicht, dass das lyrische Ich mit großen Vorwürfen in Bezug auf die Abtreibung zu kämpfen hat. In Zeile 7 und 8 Und mag auch Gott mir verzeihen.
(Zeile 7) Ich verzeihe mir nicht.
(Zeile 8) stellt die Dichterin einen Bezug zu Gott her und vergleicht ihre Auffassung der Vergebung mit der Gottes. Laut Evangelium vergibt Gott einer Seele die Sünden wenn diese aufrichtig bereut werden und aus diesen Lehre gezogen wurde. In Zeile 8 wird zum Ausdruck gebracht, dass die Sünde nach eigenem Empfinden zu groß war, um sich diese zu vergeben. Demzufolge steht das Menschenleben ganz oben und sollte unantastbar bleiben und geschützt werden.
Im zweiten Abschnitt, neunte bis sechzehnte Zeile, wird beschrieben, wie die Frau Muttergefühle für das ungeborene Kind entwickelt. Es wird mit einer Anapher eingeleitet, in welcher der Hilferuf des ungeborenen Kindes an die Mutter und das ignorante Verhalten des lyrischen Ichs zur Sprache gebracht wird.
Eine Vision von Haar
(Zeile 14). Durch den vorher gesetzten Doppelpunkt wird der Leser darauf hingewiesen, dass die Dichterin auf diese Aussage besonders Wert legt. In diesen als wichtig unterlegten Zeilen wird deutlich, dass die Frau, die durch die Schwangerschaft bedingte Veränderungen an ihrem Körper wahrnimmt, versucht zu verdrängen. Die geistige Bindung zwischen dem ungeborenem Kind und der werdenden Mutter wird mit jedem Tag der Schwangerschaft stärker. In Zeile 15 wird dargestellt, dass der Embryo mit seinen Gedanken in den Kopf der Frau eindringt und sich auf diese Weise bemerkbar macht.
Der dritte Abschnitt erstreckt sich von der 17. Zeile bis zur 40. Zeile. Dieser beginnt gleich mit einer Wiederholung Ich hätte es sehen können
(Zeile 17), Hätt ich es sehen gewollt.
(Zeile 18). Somit werden eindrücklich die Reue und die enormen Vorwürfe des lyrischen Ichs betont. Der Kerngedanke dieser Wiederholung zeigt, dass sich das lyrische Ich über das Leben und den Tod Gedanken macht und die Ansicht vertritt, dass jedes Lebewesen ein Recht auf das eigene Leben hat und dies unantastbar sein sollte.
Tatsache ist, dass die Symptome der Schwangerschaft aufgetreten sind, welche sich aber auch bei anderen Krankheiten
verzeichnen lassen. Daher ist es ein leichtes, den so offensichtlichen Wechsel des Wohlbefindens zu unterdrücken und die Ursachen bei beispielsweise einem Virus zu suchen.
In den Zeilen 20 bis 24 werden die Gefühle und Gedanken der schwangeren Frau an eine Zukunft mit einem Kind festgehalten. Ich aber habe gegrollt Über die Tage und Jahre, die es mir nehmen wird, und um meine grauen Haare, Die Kindheit.
Durch diese Aussage kann man darauf schließen, dass die Frau zum Zeitpunkt der Schwangerschaft stark von diesem Gedanken abgeneigt war. Dieses Verhalten lässt sich mit dem Alter und der Vorstellung an eine Zukunft ohne große Verantwortung begründen.
Sicher spiegelt sich die erhoffte Zukunft in der eines jeden Teenagers
wieder, welche vom Bild an die allwöchentlich wiederkehrende Party
am Wochenende und der täglichen Ausklangzeit nach einem anstrengenden Arbeitsalltag erfüllt war.
Diese erhoffte Zukunftsvision steht natürlich im starken Konflikt mit dem realen Alltag, indem ein Kind fester Bestandteil ist. Das lyrische Ich ist sich selbst darüber im Klaren, dass es nicht einfach ist, eine gute Mutter zu sein. Spätes in der Nacht Aufstehen, Wickeln und ständige Aufsichtspflicht in den jungen Jahren des Kindes zehren an Körper und Seele, wenn die Zeit zum Abschalten und Relaxen
fehlt.
In den folgenden Zeilen wird die gescheiterte Verarbeitungsphase des lyrischen Ichs dargestellt. Um dem Leser die ausweglose Situation nahe zu bringen, benutzt Eva Strittmacher den Neologismus wahnwitzverwirrt
. Mit dessen Hilfe sie verdeutlicht, dass die Frau von dem Gedanke, dass sie ein Menschenleben auf dem Gewissen hat, langsam in den ausweglosen Irrsinn getrieben wird.
Sie hofft den Schmerz besser durch das Aufschreiben ihrer Gefühle und Gedanken verarbeiten zu können. Jedoch verurteilt der vorangegangene Neologismus diesen verrückten
Versuch, die Trauer auf diese Art zu überwinden, zum Scheitern.
Ab der Zeile 27 bis hin zu Zeile 32 erkennt das lyrische Ich, dass Niemandem die sinnlose Selbstverzweiflung hilft und nichts an der Tatsache ändern wird, dass sie einen Fehler begangen hat. Die Erinnerung an diese Untugend lässt sich zwar kurzfristig in Vergessenheit drängen, aber langfristig gesehen wird es Momente geben, in denen sie ihrer traurigen Erinnerung von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht und sich unweigerlich ihrer Vergangenheit stellen muss.
Die drei nachfolgenden Zeilen stellen wiederholend die getroffene Entscheidung in Frage.
Weil sie egoistisch handelte und für sie die eigenen Annehmlichkeiten des Lebens im Vordergrund standen, wird sie von diesem Vorwurf weiter bis an ihr Lebensende verfolgt werden (Zeile 38). Das lyrische Ich ging durch viele Etappen der Trauer. Was für den Leser durch die Anapher in Zeile 37 und 38 verdeutlicht wird.
In den letzten zwei Zeilen stellt die Autorin einen mit Hilfe des Oxymoron unsühnbare Sünde
direkten Vergleich zwischen Mensch und Tier auf. Dadurch wird dem Leser gezeigt, dass ein Mensch ein Gewissen besitzt und aus seinen Fehlern lernen kann. Im Gegensatz zu einem Hund, der einmal ein Kind gebissen hat und somit dazu neigt, dies zu wiederholen.
Die Hintergründe, durch die sich Frauen zu einer Abtreibung bewegen lassen, sind sehr unterschiedlich und manchmal auch fragwürdig. Nach den deutschen Gesetzen darf jede Frau ihren Unfall
beseitigen lassen, ohne dass jemand nach den Ursachen fragt. Wir sollten uns Gedanken über Kontrollen machen, die einer Abtreibung unter Berücksichtigung von sozialen Aspekten zustimmen oder ablehnen. Die hohen Raten der Vergewaltigungen in Deutschland lassen auf den Gedanken schließen, dass jedes Jahr eine enorme Anzahl von Frauen aufgrund solcher Verbrechen schwanger wird. Völlig verständlich ist es, wenn Sie solch ein Kind nicht bekommen möchten und als Ausweg die Abtreibung wählen. Weil es den Gedanke an jenen Moment, welcher durch bedrängende Todesangst und völliger Hilflosigkeit erfüllt ist, verkörpert. Verursacht durch das böswillige und menschenverachtende Handeln eines Mannes, von deren Sorte es zu viele auf der Welt gibt.