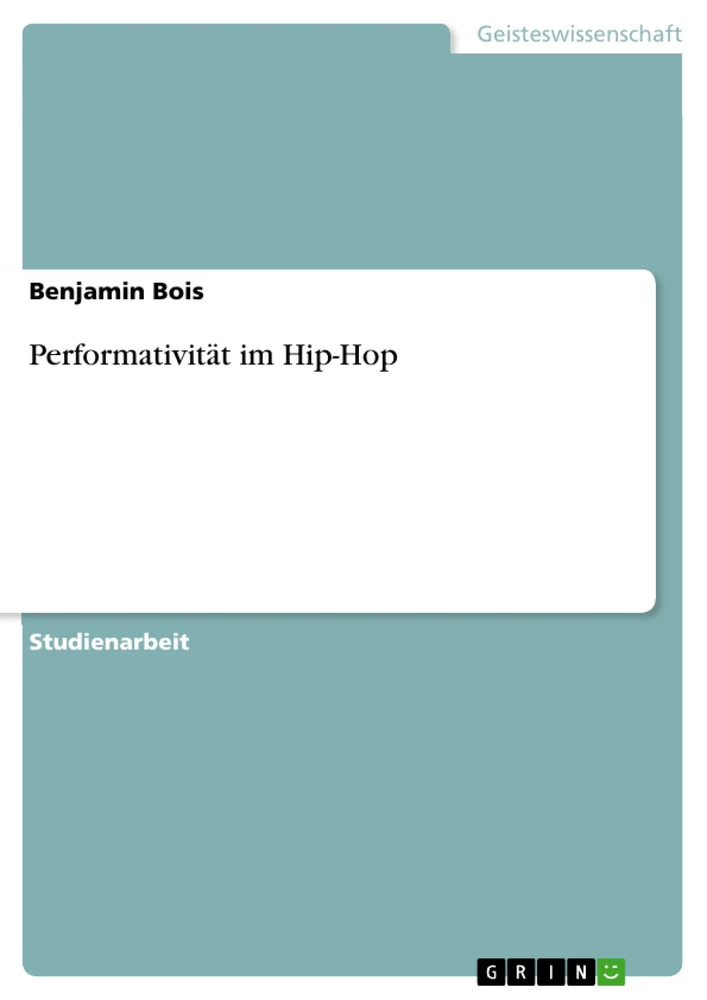Das Ziel dieser wissenschaftlichen Arbeit liegt in der Analyse der kulturellen Konsolidierung der globalen HipHop-Kultur im lokalen Kontext unter Anwendung der Habitus-Feld-Theorie von Pierre Bourdieu und der Performativitätstheorie von Judith Butler. HipHop entstand in den 1970er Jahren als Subkultur in der New Yorker Bronx und durchlief seitdem zahlreiche Entwicklungen in Technik und Ausdrucksformen. In den 1980er Jahren etablierte sich HipHop weltweit mit den USA als kulturellem Zentrum.
Die Arbeit untersucht, wie HipHop eine hybride Kulturform wurde, die lokale Realitäten mit globalen Symbolen und Ausdrucksformen verwebte. Dabei geht es nicht um eine bloße Kopie, sondern um eine De- und Rekontextualisierung von Symbolen mit neuen Prämissen. Dieser Prozess der Realitätsbildung wird als ständiger Verhandlungsprozess betrachtet, der Produktivität und Neudefinition ermöglicht.
Durch die Verbindung von Bourdieus Habitus-Feld-Theorie und Butlers Performativitätstheorie werden theoretische Werkzeuge angeboten, um die lokalen Verortungen und Aushandlungen der HipHop-Kultur zu verstehen. Die Arbeit integriert auch praktische Erkenntnisse aus Feldforschung und Interviews, um die Vielfalt und Komplexität der HipHop-Szene und ihre Bedeutung für lokale Gemeinschaften und Identitätsbildung zu veranschaulichen.
Inhalt: Seite
Einleitung
I Die Habitus-Feld-Theorie Pierre Bourdieus in Bezug auf das Feld HipHop
I.1 Habitus als Produkt und Produzent von Sozialität
I.2 Das Kapital im Feld
I.3 Handeln und Habitus
I.4 Feld-Habitus im Feld HipHop
II Performativität nach Judith Butler, ergänzend zur Feld-Habitus-Theorie
II.1 Vom idealistischen Sprechakt zum illegitimen Sprecher
II.2 Der gelungene performative Akt
III Zu zweit unter Wölfen – ein Erfahrungsbericht
III.1 Schlussbemerkung
Literaturverzeichnis
Anhang I
Interview mit MC Antrax und DJ Elude
Anhang II
HipHop-Glossar
Einleitung:
Bei HipHop handelte es sich zunächst um eine Subkultur, die, in den 1970er Jahren in der New Yorker Bronx entstand. Schon in der frühen Phase der Entstehung der Musik (Rap) durchlief sie viele Entwicklungen in Technik und Ausdrucksformen. So wurde im Laufe der Jahre die Technik des Scratchings (siehe Glossar), durch die des Sampling ersetzt, wodurch sich völlig neue Spielarten des Rap ergaben. Als sich HipHop in den 1980er Jahren weltweit etablierte, entwickelte sich eine globale Szene mit den USA als kulturellem Zentrum. Erst in den späten 1980er und Anfang der 90er Jahre konzentrierten sich mehr und mehr Anhänger des bis dato afroamerikanisch geprägten HipHop auch auf die eigene Sprache, was in vielen Fällen mit einer großen Resonanz einherging. Die Bühne für HipHop wurde größer, da die Musik nun die Schichten des Mittelstands verließ und nun auch denen als Ausdrucksform diente, die den englischsprachigen Rap nicht verstehen konnten. Diese Möglichkeit zur Integration von und gleichzeitig Annäherung an andere Musik-, Ausdrucks- und Darbietungsformen macht HipHop zu einer durchweg hybriden Kulturform. Es handelt sich hierbei eben nicht um eine bloße Kopie global gültiger, (also szenespezifisch legitimer) Symbole auf lokaler Ebene, sondern um eine De- und Rekontextualisierung von Symbolen mit neuen Prämissen. Man kann diese Form der ‚Realitätsbildung’ als einen Prozess des Aushandelns verstehen, der sich ständig wiederholt, durch den Umstand, dies in immer anderen Kontexten zu tun, ebenso aber Gleiches neu definiert und somit produktiv wirkt.
Die lebensweltliche Konsolidierung der globalen HipHop-Kultur im Lokalen soll in dieser Arbeit anhand der Habitus-Feld-Theorie Bourdieus und der Performativitätstheorie Butlers erläutert werden, wobei Butlers Theorie in diesem Kontext als Erweiterung zu der Bourdieus verstanden werden soll. Da es sich bei der Veranstaltung, in der diese Arbeit entsteht, um eine Übung mit einem praktischen Schwerpunkt auf Feldforschung handelt, soll nicht nur der Praxis des HipHop besonderes Augenmerk geschenkt, sondern dieses auch mit Auszügen aus verschiedenen Interviews, die im Rahmen des Feldforschungsteils dieser Arbeit auf verschiedenen Veranstaltungen geführt wurden, unterfüttert werden.
I Die Habitus-Feld-Theorie Pierre Bourdieus in Bezug auf das Feld HipHop
I.1 Habitus als Produkt und Produzent von Sozialität
Für die Soziologie Bourdieus ist das Denken in Beziehungen grundlegend. Die Schemata, nach denen er die Welt zu analysieren versucht, basieren auf komplexen Netzwerken, die Bourdieu als Felder bezeichnet. Die Habitus-Feld-Theorie, die im Folgenden vorgestellt werden soll, ist ein Konzept, das für die Erklärung der Entstehung sozialer Felder herangezogen wird. Man kann es als Alternativkonzept zu zwei gängigen, konträren Denkschemata verstehen: Dem idealistischen Ansatz zufolge würde Handeln als wesentlich durch das Bewusstsein des Akteurs bestimmt aufgefasst, der deterministische Ansatz hingegen erklärt das Handeln als Produkt der individuellen Sozialisation. Mit der Habitus-Feld-Theorie bemüht Bourdieu sich um eine weniger polarisierte Darstellung und zeichnet ein grundsätzlich reziprokes Verhältnis zwischen Akteur und seiner sozialen und lebensweltlichen Umgebung, dem Feld.
Im Feldbegriff konstituieren sich feldimmanente ‚Spielregeln’, die von den Akteuren erlernt und, im Laufe ihrer Sozialisation, verleiblicht werden. Der Habitus gewährleistet dabei die Präsenz früherer Erfahrungen. Er ist ein System dauerhafter Dispositionen, in dem Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata zusammenwirken. Der Habitus ist dem Akteur nicht reflexiv zugänglich, aber aufgrund der spezifischen, individuellen Historie der Habitusformen kann der Akteur in Distanz zu den feldspezifischen Normen treten und auf diese verändernd wirken.[1]
Das geschieht beispielsweise, indem Einflüsse anderer Musikstile- und Richtungen in den des HipHop eingebunden werden und so, auf der Basis des Alten, dem Normenkodex Entsprechenden, Neues geschaffen wird, wie es bei der Entstehung des Crossover, einer Mischung aus HipHop und Hardrock, bzw. Heavy Metal, geschehen ist. Das geschah in den späten 1980er Jahren durch Gruppen wie Beastie Boys und Run D.M.C., die eher am Rap orientiert waren, aber Gitarrensamples in die Beats einbauten, oder beispielsweise Rage against the machine zu Anfang der 1990er Jahre, deren Musik durch verzerrte Gitarrenriffs dominiert ist, und somit eher dem Genre Hard Rock, als dem Rap zugeordnet wird.
Das heißt, der Habitus ist zugleich Produkt und ebenso Produzent von Sozialität. Er fungiert als eine Art ‚inkorporierten Orientierungssinns’, der den AkteurInnen hilft, sich in der sozialen Welt zurechtzufinden. Er stellt den Sinnhintergrund für die Ausführung sozialer Praktiken und Praxis dar, kategorisiert und strukturiert diese und ist somit zuständig für die spezifischen Wahrnehmungs-, Verhaltens- und Kategorisierungsmuster, wie z.B. ästhetische Wertungen und emotionale Äußerungen.
„In der Beziehung Feld-Habitus ist der (popkulturelle) Habitus der Ort der Reproduktion des Glaubens an die Wirklichkeit, an den Wahrheitsgehalt und die Richtigkeit des Normen- und Wertegefüges.“[2]
Habitus als Gesamtheit eines Verhaltensmusters meint bei Bourdieu die klassenspezifisch erworbene unbewusste aber genaue Angepasstheit der Verhaltensweisen der Handelnden an das jeweilige soziale Umfeld. Dabei kann der Körper als der materialisierte Habitus betrachtet werden. Auch die „leibliche Hexis“, d.h. die Körperhaltung- und Bewegung, die Art zu sprechen und die ‚Choreografie’ bestimmter motorischer Körperfunktionen sind durch den Habitus bedingt: Der Habitus präge die menschliche Existenz, so Bourdieu, auf so fundamentale Weise, dass er bis in die „entwicklungspsychologische Schicht der motorischen Schemata reiche“.[3] So ist auffällig, dass, analog zur Musik, im HipHop-Milieu, abgesehen vom Breakdance, eher die wippenden, träge anmutenden Bewegungen zu beobachten sind, während bspw. bei Rave-veranstaltungen impulsive, flache Bewegungen überwiegen. Diese Beobachtungen sind nicht allein auf den Tanz beschränkt, sondern lassen sich auch in der Gangart, bzw. für den Großteil der motorischen Bewegungsabläufe registrieren.
I.2 Das Kapital im Feld
Die oben bereits angeführte individuelle Historie des Habitus gründet sich auf dem Zugang oder dem Verfügen über ideelle und materielle Ressourcen, die von Bourdieu in vier Kapitalsorten unterschieden werden: in ökonomisches, soziales, kulturelles und symbolisches Kapital. Im Feld HipHop könnte man folgende Zuordnung vornehmen: Ökonomisches Kapital ist gängigerweise mit Geld gleichzusetzen, aber auch bspw. rare Schallplatten können als solches betrachtet werden. Als soziales Kapital würde man Kontakte zu mit der Szene verbundenen Personen, bzw. die eigenen Vernetzungen mit dem lokalen Feld, bezeichnen, während kulturelles Kapital das feldspezifische Wissen meint, das nötig ist um Zugang zu finden und zu einem möglichst hohen Maß an symbolischen Kapital zu kommen, das verschiedene Formen von Prestige oder Ehre beinhaltet. Die Verfügbarkeit, bzw. der Zugang zu diesen vier Kapitalsorten ist grundlegend für den sozialen Status des Akteurs. Dabei ist es nicht ausreichend über ein einzelnes Kapital in großem Maße zu verfügen. Denn, auch wenn augenscheinlich Geld im HipHop eine gewichtige Rolle spielt, ist dies hauptsächlich auf globaler Ebene der Fall. Durch Musikkonzerne, die den Großteil des Marktes HipHop kontrollieren, dominiert global das ökonomische Kapital. Lokal treten allerdings das soziale und das kulturelle Kapital in den Vordergrund. Dazu genügt es nicht spezielle Magazine, oder global orientierte Musiksender, wie MTV und Viva zu rezipieren. Skills, also besondere Fähigkeiten in einer der vier Aktionskategorien des HipHop, oder szenespezifisches Wissen können nur über direkte Kontakte und in Abstimmung mit der lokalen Szene erworben werden. Soziale Kontakte und der Zugang zu Netzwerken sind also ein zentrales Kapital in der lokal sehr stark ausdifferenzierten HipHop-Szene. Nur über diese kann man zu symbolischem Kapital kommen.
Die Gesetzmäßigkeiten symbolischer Ökonomien, wie Respekt, Street Credibility und Fame, nach denen HipHop sich intern konstituiert, sind nicht explizit formuliert und fixiert, sondern werden von den Akteurinnen als „Illusio“ akzeptiert. Das heißt, feldimmanente Spielregeln werden als richtig und die Konstruiertheit des Feldes als real anerkannt und im Laufe der feldspezifischen Sozialisation verleiblicht. „Der Körper wiederum ist der Ort, an dem diese feldimmanenten Spielregeln materialisiert und zur sozialen Praxis werden, indem sie performativ wirksam werden.“[4]
I.3 Handeln und Habitus
Das Handeln der Akteure innerhalb der Feld-Habitus-Theorie ist nach nicht objektivierbaren Kriterien strukturiert und davon geleitet. Zur Erklärung dieses Umstandes bringt Bourdieu den Begriff des Sens pratique ein. Der Sens pratique (der praktische Sinn) ist ein aktiver Teil der Logik des Feldes. Er aktualisiert das verleiblichte Wissen (Illusio) und aktiviert die situationsadäquaten Handlungen, wie Sprachcodes und Begrüßungsformeln. Er stellt sich her, da kulturelle Praktiken den feldspezifischen Spielregeln entsprechen, die wiederum im Feld produziert, bzw. durch dieses erst hervorgebracht werden. Der Sens pratique beschreibt also situationsadäquates Handeln im Sinne der feldspezifischen Normen und im Rahmen des Habitus. Somit wird deutlich, dass ein Sens pratique sich stets auf ein bestimmtes Feld mit dessen Normenkodex beziehen muss.
Handeln ist jedoch nicht deterministisch zu verstehen. Die Einschreibung von Normativen als real in den Körper im Zuge der Habitualisierung geschieht über Angleichung; über mimetische Annäherung an den Körper. Im Rahmen der Habitus- und später Performativitätstheorien macht dies jedoch nur Sinn, wenn es sich nicht um eine blinde Kopie handelt, sondern vielmehr um eine theatrale Herstellung des Fremden im Eigenen, oder wie Viktor Zuckerkandl, der in den 1950er Jahren als Vordenker eines konstruktivistischen Mimesiskonzeptes hervortrat, es ausdrückt: „ein Neuentstehen-Lassen im neuen Medium“.[5] Dabei ist diese Art der Aneignung ein leiblicher Prozess der nicht passiert, sondern vollzogen wird. Symbole, die global beispielsweise in den Medien vorhanden sind, werden nicht bloß imitiert, sondern mit dem Habitus abgeglichen, bzw. durch diesen beeinflusst, und bedeuten daher auch keinen Verlust von Authentizität.[6]
Im HipHop verstärkt sich diese These nochmals dadurch, dass das reine Kopieren von Texten, Beats oder Stilen durchweg negativ sanktioniert ist. Es ist verbunden mit einem Verlust an Credibility und Respekt – symbolischem Kapital also. Im Hinblick auf nicht legitimierte, nicht als authentisch anerkannte Akteure wird Authentizität oftmals aber auch von einer anderen Perspektive betrachtet. Demnach erleidet die Musik einen Authentizitätsverlust, dadurch, dass Leute sie darbieten, die nicht auf das idealisierte Bild des Rappers zutreffen. Das heißt, die nicht über ausreichend kulturelles, bzw. symbolisches Kapital verfügen.
„Mimetische Identifikation meint also nicht nur Konventionalisierung im Sinne der Reproduktion eines Normengefüges, sondern beschreibt den performativen Akt der Neukontextualisierung und Aktualisierung.“[7]
Mit Hilfe von Pierre Bourdieus Feld-Habitus-Theorie lässt sich schlussfolgernd demnach erklären, wie szene- bzw. feldspezifische Normengefüge Wirklichkeit werden: Globale Symbole werden nicht nur lokal verankert, sondern als real geglaubt und verleiblicht, sie werden habitualisiert. Bourdieu begreift die Bildung sozialer Räume im Wesentlichen als einen Aushandlungs- und Durchsetzungsprozess; als eine „Ökonomie der symbolischen Güter“[8]. Dabei geht es um das „Monopol auf legitime Benennung als Durchsetzung einer Sicht der sozialen Welt“[9] (des Feldes). In diesem performativen Prozess des Gelingens und Scheiterns ermöglicht sich auch subversive Praxis im bereits bestehenden Normenkodex, beispielsweise durch das ‚Erfinden’ eines neuen Styles zu rappen oder zu tanzen. Dies geschieht also im Bemühen um feldspezifische Aushandlung und Aneignung globaler Symbole und Images im eigenen Kontext und nicht im Widerstand gegen diese, wie es immer noch häufig unterstellt wird.[10] Allerdings kann das immer nur in Einklang mit dem ‚makroindividuellen’ Habitus, also auch im Rahmen des feldspezifischen Normenkodex passieren.
I.4 Feld-Habitus im Feld HipHop
Um diese Thesen in einem praktischen Kontext zu beleuchten und einige Kernaussagen nochmals abschließend zu betrachten, werde ich nun versuchen, diese skizzierend auf das Feld HipHop zu übertragen. Danach sollen die Konzeptionen Bourdieus durch einige Aspekte einer Theorie des Performativen im Sinne Judith Butlers modifiziert und erweitert werden.
Im HipHop reicht, im Gegensatz zu anderen (pop-)musikalischen Metiers, zur Anhäufung symbolischen Kapitals die reine Körperstilisierung und –inszenierung nicht aus.[11] Grundvoraussetzung dafür ist der Zugang zu zwei, der von Bourdieu benannten Kapitalsorten: dem sozialen und dem kulturellen Kapital. Wer keine Kontakte zu Informationsquellen besitzt, wo der nächste Jam stattfindet oder wo szenetypische Treffpunkte sind, wird Schwierigkeiten haben, Zugang zu finden. Wer nicht weiß, was die gängige Auffassung von Realness beinhaltet, und welche musikalische Präferenzen lokal dominieren, kann sich nicht szeneadäquat, also legitim verhalten. Da HipHop sich nicht als eskapistische Freizeitkultur versteht, sondern von den Teilnehmern, und davon kann man eben aus den folgenden Gründen sprechen, als eine bindende Wertegemeinschaft verstanden wird, in der soziale Positionen durchaus flexibel sind, kommt der aktiven Teilnahme an der Community eine besonders große Rolle zu. Der aktive Aspekt des Normenkodex des HipHop bewirkt, dass real nur diejenigen sein können, die sich aktiv und erfolgreich (d.h. legitim) in den Teilfeldern des HipHop betätigen. Durch feldspezifische Normen, d.h. gewisse Werte, die allgemein anerkannt sind, wie dem Umstand, dass biten allgemein verpönt ist und zu Disrespekt, zumindest aber Respektverlust führt, und Individualität, sowie Kreativität und Originalität positiv besetzt sind, ist HipHop alles andere als statisch und reaktionär. Durch die permanente Interaktion zwischen lokaler und globaler Szene ist diese Kultur im Gegenteil durchweg hybride und durchläuft zudem, durch die ständigen De- und Neukontextualisierung im Zuge der spezifischen Habitualisierung auf lokaler Ebene, immer wieder Modifizierungs- und Aktualisierungsprozesse.
II Performativität nach Judith Butler, ergänzend zur Feld-Habitus-Theorie
„Wir tun ja nichts anderes als so zu tun, als seien wir die Person, die wir darstellen.“Performance" lässt sich nicht wirklich ins Deutsche übertragen, denn "to perform" heißt mehr als "spielen" und weniger als "sein".“[12]
II.1 Vom idealistischen Sprechakt zum illegitimen Sprecher
Judith Butlers Theorie gründet sich auf das sprechakttheoretische Modell John Austins. In seinem 1979 erschienen Werk Zur Theorie der Sprechakte, oder, wie es im Original diesbezüglich treffender betitelt ist, to do things with words, führt er die Idee der performativen Äußerung ein. Das Konzept ist also Sprechakttheoretisch begründet, später jedoch auch kulturtheoretisch umgedeutet worden. In den von Judith Butler aufgebrachten Queer-Theorien bezieht sich Performativität eigentlich auf Geschlechterrollen, die sie nicht biologisch-evolutionistisch starr festgelegt sieht, sondern als sozial konstruiert erkennt. Für den Anlass dieser Arbeit möchte ich den Aspekt des Geschlechtes hier zunächst ausklammern und den Focus auf Identitäten im Allgemeinen legen.
Nach Austin führt die performative Äußerung das, was sie benennt, eigentlich herbei und begründet es im Akt des Sprechens.[13] Demnach ist ein performativer Akt eine sprachliche Äußerung, die bei ihrem Aussprechen zugleich einen Handlungsvollzug bedeutet. Dieser Ansatz ist von verschiedenen Theoretikern der französischen Schule des Poststrukturalismus aufgegriffen und ausdifferenziert, bzw. modifiziert worden. Judith Butler orientiert sich dabei an Jacques Derrida, der die These vertritt, Sprechakte seien immer schon durch einen Diskurs kodiert und somit eine Wiederholung, ein Zitat des bereits Bestehenden. Dabei schließt sich die Annahme Austins aus, der als Voraussetzung für den performativen Akt grundsätzlich ein handelndes Subjekt sieht.[14]
Auch Butler will den performativen Akt „als die ständig wiederholende und zitierende Praxis, durch die der Diskurs die Wirkungen erzeugt, die er benennt“[15] verstanden wissen. Denn ein Symbol bedarf der Wiederholung, um sich als Zeichen zu etablieren. Das geschieht jedoch nicht individuell determiniert, sondern eben durch den Diskurs vorgeprägt Damit macht es seinen Kontext wiederum unabschließbar. „Demzufolge verfehlt eine Lesart von ‚Performativität’ als willentliche und willkürliche Wahl den Punkt, dass die Geschichtlichkeit des Diskurses und insbesondere die Geschichtlichkeit der Normen […] die Macht des Diskurses ausmachen, das zu inszenieren, was er benennt.“[16]
Butlers zentrale Kritik an Bourdieus im ersten Teil der Arbeit erläuterter Konstruktion richtet sich gegen deren Konventionalität: Er habe die Bedeutung des performativen Aktes für die Bestätigung eines tradierten Normenkodex formuliert, nicht aber für dessen Veränderung. Butler möchte die Performativität von Identitäten in den Vordergrund rücken, um deren Veränderbarkeit denkbar zu machen.[17] Nach Bourdieu ist die bestehende soziale Position erheblich für das Gelingen, also die Legitimierung des Sprechaktes, oder der Handlung – sie ist Ausdruck von Macht. Allein ein legitimierter Sprecher wäre in der Lage einen erfolgreichen performativen Akt zu vollziehen und somit feldspezifische Veränderungen zu bewirken.[18] Den Status eines legitimierten Sprechers hat derjenige inne, der „[…] ermächtigt ist, im Namen der dergestalt in ihm und durch ihn konstituierten Gruppe zu sprechen und zu handeln“[19]. Die Teilnehmer müssen von der Legitimität seiner Position überzeugt sein, damit seine Sprechakte (performativ) wirksam werden können.
Im HipHop ist es allerdings möglich, durch einerseits dem feldspezifischen Normenkodex konformen, zugleich aber innovativen, tradierte Ästhetiken überschreitenden, also aktualisierenden Stil, Anerkennung zu erhalten und zu einem legitimierten Sprecher zu werden. Daraus ergibt sich das, von Klein und Friedrich hervorgehobene „Potenzial, zur Veränderung der feldimmanenten Spielregeln.“[20] Dadurch, dass dieses Prinzip besteht und bei Jams und gerade den sog. Battles aktiv auf die Bühne getragen, zelebriert und somit zu einem festen Bestandteil der Praxis wird, ermöglicht sich „die permanente Aktualisierung der legitimierten Position des Sprechers/Performers – aber auch deren Scheitern.“[21]
II.2 Der gelungene performative Akt
Ein gelungener performativer Akt kann also nicht nur von Personen von hohem sozialem Status, also legitimierten Sprechern vollzogen werden. Ebenso kann ein ‚Performer’ eben durch das Gelingen eines solchen Aktes unter den oben aufgeführten Prämissen zum legitimen Sprecher werden. Der gelungene Performative Akt beinhaltet also verschiedene Wirkungen auf das Feld und seine Akteure: Zum einen dient er eben dieser sozialen Positionierung desjenigen, der ihn durchführt, da er durch das Gelingen in der Lage ist symbolisches Kapital zu beziehen. Zum anderen werden die feldspezifischen Normen Aktualisiert, dadurch, dass er sie zitiert (‚Iteration’). Es kommt zu einer Neukontextualisierung des bereits Bestehenden. Dabei kann man sowohl eine Sprechhandlung, als auch eine körperliche Handlung als performativen Akt bezeichnen. Da im HipHop beides von so großer Bedeutung ist, kann HipHop als nächstmögliche Praxis zwischen Theatralität und selbst erfahrener Realität in der (pop-)kulturellen Szene verstanden werden. Denn durch das immanente Hervorheben des Performativen in der Praxis des HipHop werden Identitätsordnungen permanent verschoben und kann Macht (in Form von großem sozialen und symbolischen, zuweilen auch ökonomischen Kapital) in Frage gestellt werden.
III Zu zweit unter Wölfen – ein Erfahrungsbericht.
Als ich am Samstag, den 10.1.2004 mit Bastian Beutler nach Bad Hersfeld fuhr, geschah das in der Annahme, dort finde ein HipHop- Jam statt, auf dem (siehe Glossar) alle Disziplinen des HipHop vertreten sein würden. Da wir unser spezielles Augenmerk auf den musikalischen Teil, also den Rap gelegt hatten, hofften wir auf besonders viele Teilnehmer aus diesem Bereich. Ein Open-mic-Contest war auf dem entsprechenden Flugblatt für nach dem Konzert der Gruppe ‚Die Valschen’ [sic!] angekündigt. Dabei handelt es sich um eine spezielle Form des Freestyle Battles. Die Teilnehmer sind nicht vorher ausgewählt worden, oder haben sich angemeldet. Wer etwas zu sagen hat, bzw. sein können unter Beweis stellen möchte, geht auf die Bühne und erhält, wenn er/sie an der Reihe ist, das Mikrophon. Für den Identitäten- und besonders auch den Performativitätsdiskurs erwarteten wir uns davon den größten Ertrag.
Zu unserem äußersten Missfallen handelte es sich bei der Veranstaltung im Jugendhaus um einen Graffiti-Jam, bei der, zum Zeitpunkt unseres Eintreffens, der Hauptteil, nämlich das Besprühen der bereitgestellten Stellwände, bereits geschehen war. Im Nachhinein erschien das durchaus logisch, denn Tageslicht ist für das Erstellen eines Bildes dienlich. Allerdings verwunderte es uns schon, dass wirklich kein Einziger der Teilnehmer später noch sprühte, denn in der gängigen Praxis müsse man, so dachten wir, doch ständig im Dunkeln und noch dazu in Eile sprühen, sodass dies auch ein vertrautes Vorgehen sein müsste. Ein wenig enttäuscht sahen wir uns, uns ständig nach etwaigen kulturellen Besonderheiten oder potenziellen Interviewpartnern umsehend, den Auftritt von ‚die Valschen’ an. Mäßig begeistert konnten wir uns aber nicht wirklich vorstellen, welche besonderen Vorkommnisse wir für erwähnenswert halten sollten, denn selbst das anwesende Publikum erwies sich als recht zäh und ließ sich mit „werft die Hände in die Luft“ und „make some noise!“ nicht aus der Reserve locken. Also sahen wir uns erst einmal den folgenden Open-mic Contest an, bei dem vor allem lokale Bekanntheiten vertreten zu sein schienen, denn als sie die Bühne betraten, wurde das bei den meisten von Applaus oder tiefstimmigen Gejohle begleitet. Das Freestyle-Duell zwischen Antrax und Plastiker sollte zum Höhepunkt des Abends werden. Plastiker schien in der Gunst des Publikums zu stehen, denn er hatte bereits in vorherigen Beiträgen, seine Redegewandtheit unter Beweis gestellt und so die sechzig bis achtzig Zuschauer auf seine Seite gezogen. Als Antrax das Mikrophon ergriff, versuchte er ihn direkt anzugehen und forderte ihn mit Aussagen, wie „der Typ hier nennt sich Plastiker, ich sag’ euch es ist drastischer. Er ist zwar auch kein Spastiker, doch sein Style wird nie zum Klassiker.“ indirekt zu einem Kräftemessen heraus, das Plastiker annahm. Etwa sechzehn Zeilen lang versuchten beide einander die Untauglichkeit zu beweisen. Da der Plastiker ein wenig wortgewandter erschien und sich immer wieder, mit in die Raps eingebauten Fragen, an das Publikum wendete, das ihm den erhofften Respekt in Form von Lautstärke entgegen brachte, musste letztlich Antrax, der zum Ende hin nur noch Plattitüden übrig zu haben schien, die Bühne kopfschüttelnd verlassen. Die Zeit für das Interview war gekommen. Ich ging auf ihn zu und fragte ihn, ob er ‚Bock’ habe ein kurzes Interview zu führen. Darauf hin wendete er sich zu seinem Freund neben ihm. „Das ist mein DJ. Kann der mitkommen?“ fragte er, ohne sich zu erkundigen aus welchem Zweck wir das Interview führen wollte, als sei es Routine. Der DJ stellte sich als Elude vor, was im Deutschen ausweichen, entwischen oder auch sich entziehen bedeutet. Beide beantworteten unsere Fragen sehr bemüht, und erst gegen Ende des Gesprächs richteten sich die Blicke zunehmend auf den Platz, wo die Freunde bereits dabei waren, den Abend adäquat ausklingen zu lassen. Als einer der Freunde zu uns kam und sagte „Ey; kommt mal rüber; der Schrecker geht voll ab!“, wussten wir, dass wir uns kurz fassen müssten. Aber gerade die Fragen, die sich mit dem Wesen des Freestyle Raps beschäftigten, beantworteten sie uns mit sichtlicher Anteilnahme. Das Interview ist im Anhang beigefügt und kann dort nachgelesen werden.
III.1 Schlussbemerkung
Der Abend, das Interview, unsere Beobachtungen und die vereinzelten Gespräche, die wir sonst mit Leuten führten, die als Besucher oder Teilnehmer auf der Veranstaltung anwesend waren, gaben mir unmittelbar nur wenig Aufschluss darüber, was wir dem Kurs über diese Veranstaltung und unsere so genannte Forschung dort erzählen würden. Erst in der Retrospektive (und mit zunehmender Vertrautheit mit den bearbeiteten Theorien) wurden mir einige Dinge bewusster. Zum einen braucht man Performativität nicht zu suchen, wie ich das fast krampfhaft versucht habe, denn sie ist – gerade im HipHop – permanent präsent. Sie vollzieht sich in den kleinsten Handlungen, wie einem gelungenen Move bei den Breakdancern oder originellen und besonders kreativen Reimen bei den Rappern. Außerdem werden Performative Akte auch längerfristig wirksam. Das lässt sich an einem Beispiel verfolgen: In den Anfangszeiten des HipHop galt es als MC, das Publikum zu unterhalten und zum Tanzen zu bringen und sich als ‚Master of Ceremony’ zu repräsentieren. Reicher Goldschmuck (oder Imitate, die wie solcher aussahen) waren ein Zeichen der Opposition gegen das Monopol der Weißen auf Reichtum., ebenso wie Rap, wie andere von Afroamerikanern dominierte Genres, zur Plattform des Ausdrucks „I am somebody“ wurde. In neuerer Zeit gilt die Anhäufung vor allem ökonomischen Kapitals immer noch für einige Genres des HipHop, wie den Gangster-Rap und dem Mainstream. Andere Genres grenzen sich davon ab und verbinden mit der Kommerzialisierung des Raps eine Adaption an den Mainstream, was als Authentizitätsverlust gewertet wird. ‚Das blinde Verlangen Geld zu verdienen führt dazu, dass man sich selbst verkauft.’ Diese Auffassung ist in Europa auch oft zu finden. So nannten I AM, die bislang berühmteste französische Rapcrew ihr zweites Album L’ecole du micro d’argent – und verkauften Millionen davon. Auch im deutschen Rap ist diese Auffassung immer wieder zu finden. Das vor allem bei kleineren Gruppen, die sich damit brüsken ‚im Untergrund’ zu agieren, also nicht kommerziell tätig zu sein. ‚Kommerz’ ist so wahrlich zum Schimpfwort in der deutschen Szene geworden.
Eine Leitfragestellung für die Feldforschung hätte also lauten können: „Welche Art des performativen Aktes hat einen besonders großen Einfluss auf das soziale Gefüge und die soziale Position des ‚Performers’ in einem, nach Bourdieu definierten Feld?“ und „Unterscheidet sich die Art eines solchen gelungenen performativen Aktes und seiner jeweiligen Wirkung in den verschiedenen Teilbereichen des HipHop?“. Zu der Zeit, als es galt praktische Erfahrung zu sammeln, war ich aber nicht ausreichend vertraut mit den oben vorgestellten Theorien, sodass diese Brücke zwischen Theorie und Praxis in diesem Fall leider nicht einhundertprozentig geschlossen werden konnte.
Literaturverzeichnis
BOURDIEU, Pierre
1987 „Sozialer Sinn: Kritik der theoretischen Vernunft.“ Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 503 S.
1990 „Was heißt sprechen? Die Ökonomie des sprachlichen Tausches.“ Wien: Braumüller 183 S.
BUTLER, Judith
1995 „Körper von Gewicht: die diskursiven Grenzen des Geschlechts“ Berlin: Berlin-Verlag. 367 S.
KLEIN, Gabriele und Malte Friedrich
2003 „Is this real? Die Kultur des HipHop.” Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 224 S.
MENRATH, Melanie
2001 „Represent what…: Performativität von Identitäten im HipHop.“ Hamburg: Argument Verlag. 282 S.
SCHWINGEL, Markus
1998 „Pierre Bourdieu zur Einführung.“ Hamburg: Junius. 181 S.
Internetquellen
ROEDIG, Andrea
2002 „Mit dem Körper denken.“ IN: http://www.freitag.de/2002/38/02381701.php [20.1.2004]
Alle Informationen über einzelne Künstler, sowie über Stilrichtungen und deren Entwicklung:
http://www.allmusic.com [20.1.2004]
Bildquellennachweis
Abbildung Deckblatt von:
DECLAIM
1999 „Illmindmuzik.“ Beverly Hills: Good Vibe Recordings. [Compact Disc]
Anhang I
Protokoll des Interviews, geführt am 10.1.2004 im ‚Jugendhaus’ in Bad Hersfeld mit DJ Elude und MC Antrax von Version:
Was hat Dich zum HipHop gebracht?
Anthrax: Mein Bruder hat immer im JuZe gebreakt und ich hab’ zugeguckt und die Mucke hat mich immer voll geflasht … so Tupac und Der und Snoop. Und dann hab ich auch irgendwann mit denen gerappt, weißt Du?
Elude: Antrax hat in meiner Nähe gewohnt und wir haben nach der Schule immer rumgehangen. Einmal bin ich mit zu so seinem Bruder auf Bruder auf so ne Party gegangen. Die hat der immer im JuZe gemacht, wo die gebreakt haben und so. Da hab ich zum ersten Mal Westcoast gehört und fand’s voll geil.
Was hat es für deine damalige Situation bedeutet?
A.: Es hat voll Bock gebrach! Alle anderen haben immer nur schwule Gitarrenmucke oder Dance oder so’n Scheiß gehört. Kein bisschen cool, alder! Ich fand den sound fat und das ganze Gangster-Ding war auch was ganz neues.
E.: Bevor ich A. kennen gelernt hab bin ich immer mit Freunden in der Gegend rumgelaufen und hab scheiße gebaut. Auch wenn’s manchmal lustig war, wenn’s irgendwie gebrannt hat oder so was, war’s immer voll langweilig, weil hier halt nix [ lauter ] geht! Das Einzige ist halt das JuZe und da hängen immer so komische Typen rum un machen ihre Hausaufgaben oder so. Mit dem Rappen und Breaken war’s dann immer voll cool. Auch weil die älter waren und wir mit denen rumhängen konnten. Aber’s war halt immer nur so zwei- oder dreimal in der Woche.
Wer hat damals als HipHopper gegolten? Welche Art von Leuten haben sich im HipHop-Milieu bewegt?
A.: Das waren viel weniger als heute. HipHopper warn eigentlich n Paar, keine Frauen. Das warn nur Freundinnen oder so was. Bitches halt. Es gab n Paar Breaker und n Paar Rapper, aber weniger. Das warn auf jeden Fall die coolsten Leute, die so rumgelaufen sind!
E.: Es gab nich so viele HipHopper. Ich kannte nur Alis Bruder und seine Kumpels (…) und natürlich uns [lacht]. Später haben wir dann auf Jams noch andere kennengelernt, aber die waren nicht in unserer Posse. Von den Breakern waren viele Türken aber auch Deutsche und Rumänen. Bei den Rappern waren die meisten Deutsch.
Hat sich die Szene seitdem stark verändert?
E.: Klar, Alda! Es sind viel mehr Leute geworden und die meisten glotzen nur noch doof. Außerdem achten die meisten Leute nicht mehr darauf, was die Leute sagen oder können, sondern nur noch, ob man darauf mit dem Arsch wackeln kann.
War das früher anders?
E.: Auf jeden! Früher ham alle was gemacht. Alle die ich kannte, die mit HipHop steil gegangen sind, die ham gebreakt oder gerappt oder gekratzt oder irgend n Scheiß!
Gibt es Deutschrap oder nur deutschsprachigen Rap, oder würdest Du sagen, HipHop ist ein schwarzes Ding?
A.: HipHop ist nicht nur n schwarzes Ding. Eminem z.B. ist krass. Obwohl der heute soviel Kohle macht. Der kann rappen und der hat style. Aber es ist mehr, wo Du herkommst, als ob Du schwarz bist, oder nicht. Die Leute aus Berlin sind auf jeden Fall real – die wissen, was geht. Aber die Beats sind trotzdem scheiße!
E.: Deutschrap ist im kommen – muss man sagen. Deutschen Rap gibt es nur im Underground und kommen tut’s schon von den Amis. Es gab Zeiten, da hat jeder angefangen auf Deutsch zu rappen, so nach den Fanta 4. Da sind viele Crews raus gekommen; die sind aber nur hinter dem Geld her. Reale Leute verdienen meistens kein Geld mit Rap. Da gibt es nur wenige Ausnahmen. Fast alle in Deutschland, die Geld damit verdienen sind wack.
Wer nicht?
A.: Es gibt n Paar Leute, die haben derbe Skillz und geben n Dreck darauf, was die Leute denken. Wie z.B. KKS [King Kool Savas] oder Ecko.
E.: Blumentopf sind auch noch ganz dope!
Was ist style?
A.: Äm… style is so…cool sein und so. So, sein eigenes Ding machen und cool flowen, wie’s sonst keiner macht. Mein Style ist meine Art zu rappen und auf der Bühne abzugehen. Wer keinen eigenen Style hat brauch’s gar nicht erst versuchen.
E.: Style ist, wenn Du dein eigenes Ding drehst und auf der Bühne abgehst und die Leute pushst. Wenn ich auf der Bühne meine Styles kick, dann zeige ich, was ich drauf hab, meine Skills, verstehst Du? Beim Battle zählen auch die Stylez, denn am Ende bleiben nur noch die übrig, die Skills haben und tight sind.
Was bedeutet Realness für Dich?
E.: Real kannst Du nur sein, wenn Du ehrlich bist. Das heißt nicht, dass Du immer die Wahrheit sagst, sondern dass Du die Sachen auch so meinst. [Zwischenfrage: Wie Bitte? ] Ja, man, also...wenn Du Sachen sagst, die Du aber nicht direkt erlebt hast, oder wenn Du absichtlich lügst. (…) Dann kannst Du trotzdem real sein, weil das auch was mit `ner Philosophie zu tun hat [ Welcher Philosophie? ] Na, dass Du Dich nicht verkaufst, sondern dein Ding machst. Nicht wie die Massiven, oder so Spongos.
A.: Realness ist, das zu leben, was ich auch sage. Ehrlich sein un’ kein’ Scheiß labern oder so. Weil ich Ahnung hab, also wissen worum’s geht und das auch sagen.
Oft hört man den Vorwurf Deutsche kopierten nur von den USA.
A.: Nee! Was geht? Wir machen voll unser eigenes Ding. Aber in Deutschland gibt’s halt keinen von dem man was lernen kann! (…) Aber wir rappen ja auf Deutsch, damit man was versteht. Die Lyrics sind voll wichtig. Wir machen nich so’n Pseudo-Gelaber, wie Freundeskreis oder die Massiven.
Viele Leute verbinden HipHop mit Gewalt.
A.: Ja klar; weißt Du – HipHop ist Kampfmusik. Das’ n Battleding. Du musst das sehen, wie einen Kampfsport. Wir zeigen unsere Skillz und am Schluss ist einer am Ende und der andere gewinnt. So richtig Gewalt gibt’s auch manchmal, aber nicht wie bei den Amis, so mit Drive-by shooting oder so. Da ham die ja jetzt schon wieder den Jam Master Jay erwischt. Das find ich scheiße!
E.: Es gibt immer mal Typen, die sich auf Jams oder davor auf die Schnauze haun wollen. Und manchmal ne Gasknarre oder n Messer ziehn. Dass ist dann wegen Frauen oder Beef oder weil die besoffen sind.
Ist die Szene dafür anfällig?
E.: Eigentlich nicht. In Amerika ist das was anderes, aber bei uns ist das was anderes. Aber Stress gibt’s eigentlich überall. Da musst Du nur in die Stadt gehen und einen schief angucken.
Was macht die Gemeinschaft HipHop, die Community aus?
E.: Das ist voll wichtig. Wenn ich irgendwie Stress krieg, weiß ich, dass ich mich auf meine Posse verlassen kann. Außerdem weiß ich bei denen woran ich bin. Wir hören die gleiche Musik, hängen zusammen rum und machen einfach super viel.
A.: Community, das sind wir. Die, die real sind. Hier sind das meine Homies und ich und noch n Paar Crews, mit denen wir down sind. Und wir geben uns Probs oder jammen zusammen.
Rapper dissen einander aber häufig. Wie geht das zusammen?
A.: Viele labern halt Scheiße und die ham keine Skillz und klauen mein’ Style. Und dann geh ich nach vorne und zeig denen, wer der Boss ist. Da geht’s manchmal derbe ab. Aber wir machen auch Freestyle-Battles, wo wir uns nur so aus Scheiß dissen. Da schmeißen wir uns die krassesten Sachen an den Kopf und saufen danach ein’. Das is nich so ernst gemeint – da geht’s nur um die Skillz. Das is dann so wie heute abend.
E.: Dissen ist ne wichtige Sache. Das gehört zum Freestyle einfach dazu.
Wieso?
E.: Weil Du den Anderen, mit dem Du dich battlest damit herausfordern kannst. Am Ende gewinnt der Witzigere und die Witze gereimt, da brauchst Du schon derbe Skills und Du hast keine Zeit zu überlegen. Du musst sofort rauskotzen, was Dir durch den Kopf schießt und dabei auch noch reimen. Das is echt derbe schwer!
Anhang II:
Glossar:
Biter Verb ‚bite’ = beißen
Eine Person, die Breakdance-Moves, Graffiti Pieces, Rap Styles o.ä. kopiert und als eigene Entwicklungen ausgibt.
Battle Engl. - Schlacht, Kampf;
bezeichnet zum einen die konkrete künstlerische Auseinandersetzung innerhalb der HipHop-Bewegung, etwa Freestyle- oder Graffiti-Battle, aber auch den Motor der Bewegung (Competition-Gedanke).
Community Engl. - Gemeinschaft
Ausdruck des Gefühls der Zugehörigkeit zur Wertegemeinschaft HipHop.
Competition
Grundgedanke des Wettbewerbs. Hat seine Wurzeln in den Anfängen des HipHop, als es für Performer (MC, Breaker, DJ, Sprayer) galt zu repräsentieren, was man kann, um Respect zu erhalten.
Freestyle Engl. – Freistil
Im Rap: freies Rappen auf Instrumental- Beats ohne Textvorgabe oder festen Stil. Vor allem auf → Jams. (Freestyle-Battle)
Jam Engl. - Gedränge
Bezeichnung für eine HipHop-Party, an der Protagonisten aller Ausdrucksformen der HipHop-Kultur vertreten sind.
Realness Adjektiv ‚real' = echt, authentisch;
ein HipHopper, der nicht versucht, etwas darzustellen, was er nicht ist, der den Wurzeln der Kultur treu bleibt und seinen Vorgängern respect erweist, ist real. Vgl. Biter.
Sample Engl. - Probe, Muster;
einzelne Sequenz, die von einer anderen Platte übernommen wurde.
Sampler
Gerät zur Musikproduktion; digitales Aufnahmegerät. Wandelt analoge Tonsignale in digitale Daten, die dann verändert und in neuer Zusammenstellung und Reihenfolge abgespielt werden können.
Scratching Engl. - kratzen;
DJ-Technik, durch rhythmisches Vorwärts- und Rückwärtsbewegen der Platte bei auflie-gender Nadel wird ein vom Rhythmus geprägtes Geräusch erzeugt, durch das Samples oft eingeleitet werden. Die Erfindung des Scratching machte den Plattenspieler zum eigenstän-digen Instrument.
Style Engl. - Stil, Ausdrucksweise
bezeichnet die individuelle Gestaltung und Darbietung eines Raps. Neben der formalen Gestaltung spielen die Art des Vortrags und die Ausstrahlung des Rappers eine wichtige Rolle. Style ist also nicht mit Sprachstil zu übersetzen.
[...]
[1] Vgl. Bourdieu 1987: 98 - 105
[2] Klein/Friedrich,2003: 191
[3] zitiert nach Schwingel 1998: 58.
[4] Klein/Friedrich, 2003: 194
[5] zitiert nach Klein/Friedrich, 2003: 195
[6] Klein/Friedrich, 2003: 198f
[7] Klein/Friedrich, 2003: 197
[8] Bourdieu 1990: 20
[9] ders. 1990: 23
[10] vgl. Klein/Friedrich, 2003:
[11] vgl. Klein/Friedrich, 2003: 194
[12] Roedig 2002
[13] vgl. Menrath, 2001: 21f
[14] Vgl. Klein/Friedrich, 2003: 198ff und Menrath 21f
[15] Butler, 1995: S. 22
[16] Butler, 1995: 249
[17] vgl. Menrath, 2001: 19ff
[18] vgl. Bourdieu, 1990: 55f
[19] Ebd.
[20] Klein/Friedrich, 2003: 200
Häufig gestellte Fragen zum Language Preview: Habitus-Feld-Theorie im HipHop
Was ist das Hauptthema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die lebensweltliche Konsolidierung der globalen HipHop-Kultur im Lokalen anhand der Habitus-Feld-Theorie Bourdieus und der Performativitätstheorie Butlers, wobei Butlers Theorie als Erweiterung zu Bourdieu verstanden wird. Sie beleuchtet die Praxis des HipHop mit Auszügen aus Interviews.
Was ist die Habitus-Feld-Theorie nach Bourdieu?
Es ist ein Konzept zur Erklärung der Entstehung sozialer Felder, das Handeln als ein reziprokes Verhältnis zwischen Akteur und seiner sozialen Umgebung (Feld) betrachtet. Der Habitus ist ein System dauerhafter Dispositionen, das Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata zusammenwirken lässt.
Was sind die Kapitalsorten im Feld nach Bourdieu?
Bourdieu unterscheidet vier Kapitalsorten: ökonomisches (Geld, rare Güter), soziales (Kontakte, Netzwerke), kulturelles (feldspezifisches Wissen) und symbolisches Kapital (Prestige, Ehre). Der Zugang zu diesen ist grundlegend für den sozialen Status des Akteurs.
Was ist der Sens pratique im Kontext der Habitus-Feld-Theorie?
Der Sens pratique (der praktische Sinn) ist ein aktiver Teil der Logik des Feldes, der das verleiblichte Wissen aktualisiert und situationsadäquate Handlungen aktiviert. Er beschreibt situationsadäquates Handeln im Sinne der feldspezifischen Normen und im Rahmen des Habitus.
Wie wird die Habitus-Feld-Theorie auf das Feld HipHop angewendet?
Die Arbeit versucht zu erklären, wie szene- bzw. feldspezifische Normengefüge im HipHop Wirklichkeit werden: Globale Symbole werden nicht nur lokal verankert, sondern als real geglaubt und verleiblicht, sie werden habitualisiert. Aktive Teilnahme an der Community ist entscheidend, wobei "real" nur diejenigen sein können, die sich aktiv und erfolgreich in den Teilfeldern des HipHop betätigen.
Was ist Judith Butlers Performativitätstheorie und wie ergänzt sie Bourdieus Theorie?
Butler's Performativitätstheorie, basierend auf Austins Sprechakttheorie, sieht Identitäten (ursprünglich Geschlechterrollen) als sozial konstruiert und durch wiederholende Akte geformt. Sie ergänzt Bourdieu, indem sie die Möglichkeit der Veränderung von Normen betont, im Gegensatz zu Bourdieus stärker konventioneller Sicht.
Was ist ein "gelungener performativer Akt" nach Butler im Kontext von HipHop?
Ein gelungener performativer Akt dient der sozialen Positionierung des Performers (Erlangung symbolischen Kapitals) und aktualisiert gleichzeitig die feldspezifischen Normen. Im HipHop kann dies zu einer Verschiebung von Identitätsordnungen und einer Infragestellung von Macht führen.
Was war das Ziel des Erfahrungsberichts "Zu zweit unter Wölfen"?
Der Erfahrungsbericht schildert einen Besuch eines HipHop-Jams und die Beobachtungen dort im Hinblick auf Identitäten und Performativität. Ziel war es, die theoretischen Konzepte in einem praktischen Kontext zu beleuchten und zu überprüfen.
Welche Schlussfolgerungen werden aus dem Erfahrungsbericht gezogen?
Performativität ist im HipHop permanent präsent und vollzieht sich in den kleinsten Handlungen. Performative Akte wirken langfristig und beeinflussen soziale Gefüge und die soziale Position des Performers. Es wird betont, dass die Verbindung zwischen Theorie und Praxis während der Feldforschung nicht vollständig geschlossen werden konnte.
Welche Literatur wird in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet Werke von Pierre Bourdieu, Judith Butler, Gabriele Klein, Malte Friedrich und Melanie Menrath sowie Internetquellen und Bildquellennachweise.
- Arbeit zitieren
- Benjamin Bois (Autor:in), 2004, Performativität im Hip-Hop, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108705