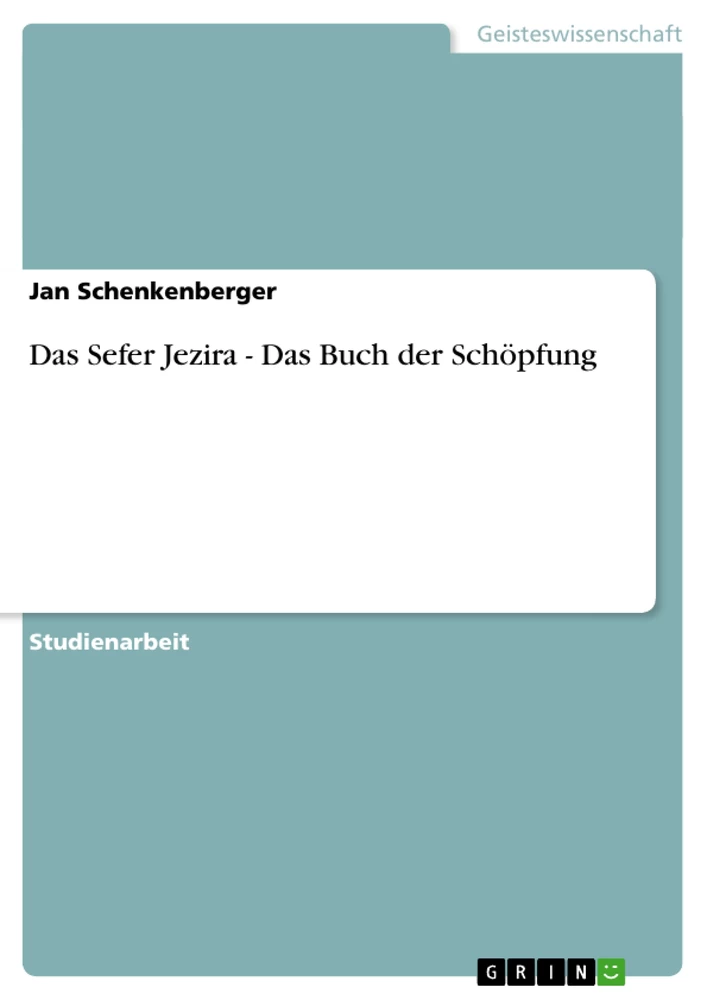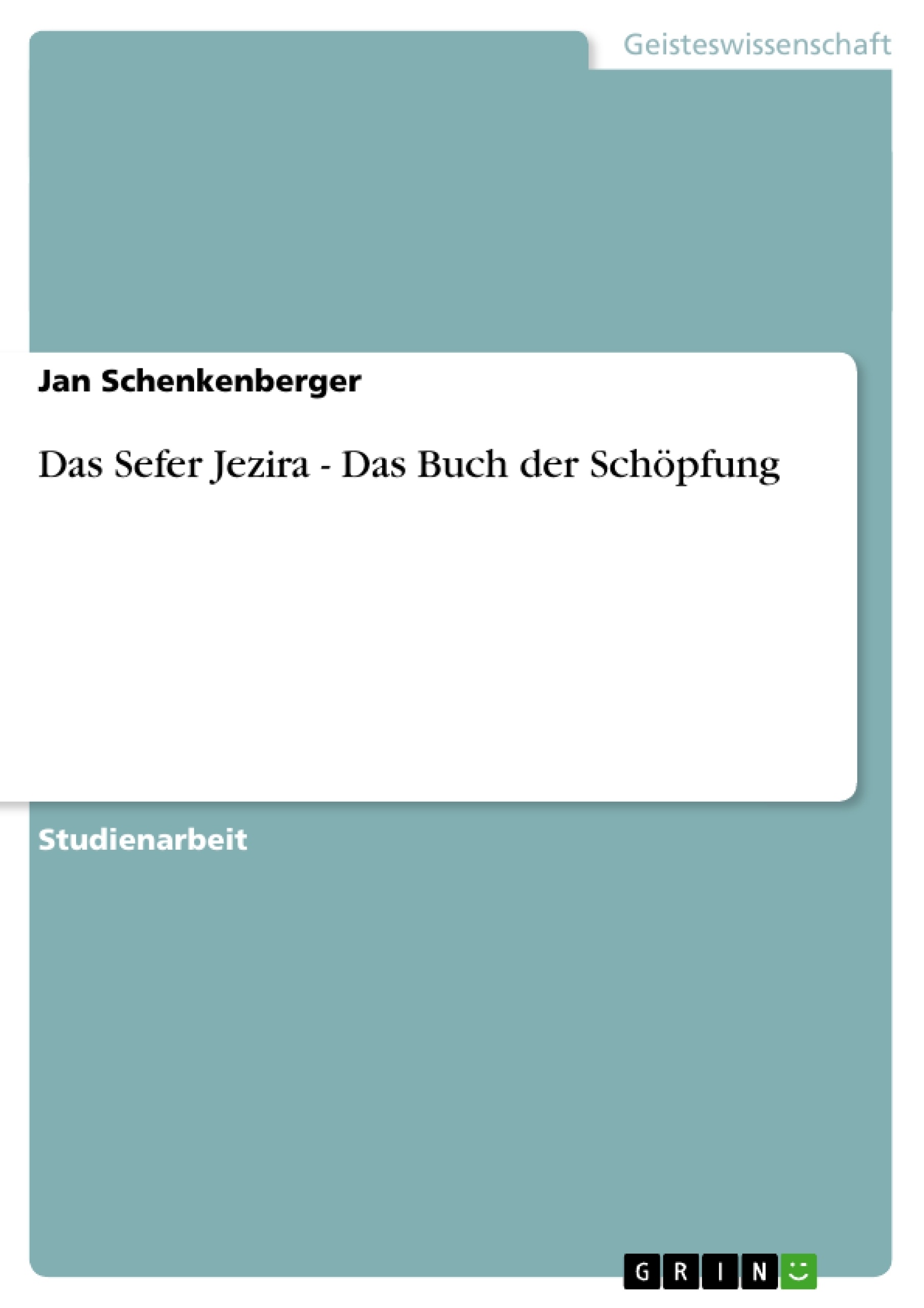"...Ihr Ende ist in ihrem Anfang und ihr Anfang ist in ihrem Ende, so wie die Flamme zur Kohle gehört schließe Deinen Mund, daß er nicht spreche und Dein Herz, daß es nicht urteile..."
aus dem Sefer Jezira
"Dann, aus der Ewigkeit, mit zehn Sprichworten meißelst Du,
Mit Schreiber, Manuskript und Liste - Zehn,
Du fertigtest sie in sechs Richtungen, Zehn Worte."
Hinweis des Rabbi Eleasar Kalir auf das Sefer Jezira
Das Alter des Werkes und seine Verfasserschaft
Über die Entstehungsumstände des Sefer Jezira weiß man nichts; ebenso unklar bleibt sein Alter und auch die Frage nach seiner Verfasserschaft kann nicht eindeutig beantwortet werden. Alles was man sagen kann ist, daß es sich wohl um die älteste vollständig erhaltene kabbalistische Schrift handelt. Die wissenschaftlichen Datierungsversuche reichen von der Zeitenwende bis zum achten Jahrhundert nach Christus; Gerschom Scholem datiert die Schrift auf die Zeit zwischen dem zweiten und fünften Jahrhundert, wobei er den Zeitraum um das dritte Jahrhundert präferiert.
Zitate aus dem Werk tauchen allerdings erst ab der posttalmudischen Zeit auf, den ältesten erhaltenen Kommentar schrieb Saadja Gaon im 10. Jahrhundert, das erste erhaltene Manuskript ist noch ein Jahrhundert jünger.
Traditionell wird das Buch Abraham zugeschrieben; so steht es im Sohar und auch Saadja Gaon berichtet im 10. Jahrhundert: "Die Alten sagen, daß Abraham es schrieb"1 Einige alte Manuskripte des Werkes nennen ihn ebenfalls als Verfasser, ebenso der erste Druck2 Andere gehen von Rabbi Akiba aus, allerdings wurden in dem Werk auch neuplatonische und neupythagoräische Einflüsse nachgewiesen. Es ist allerdings durchaus möglich, daß es in Teilen auf vorchristlichen Quellen beruht. In jedem Falle läßt sich sagen, daß das Sefer Jezira mehrere Schichten enthält, wahrscheinlich wurden auch frühe Kommentare eingefügt3 und mit dem Werk verschmolzen, was nicht nur eine Altersbestimmung zusätzlich erschwert, sondern es auch nahezu unmöglich macht, die Originalversion des Buches aus dem Text herauszufiltern.
"Es gibt viele Versionen, einige sehr verworren."
Rabbi Yehuda Barceloni. 11. Jahrhundert
Verschiedene Versionen des Sefer Jezira
Heute sind vier wichtige Varianten des Sefer Jezira bekannt: Die Kurze, die Lange, die Saadia- sowie die Gra-Ari-Version.
Davon ist die Saadja als die älteste anzusehen. Der älteste Kommentar des Sefer Jezira bezieht sich auf sie, sie trägt auch den Namen seines Autors, des Saadja Gaon. Sie findet sich in einigen alten Fragmenten und ähnelt der Langen Version. Allerdings spielte sie für die Kabbala kaum eine Rolle, auch wenn es sich hierbei wohl um die Version handelt, mit der Yehuda Halevi arbeitete.
Die wegen ihres Umfanges von 2500 Worten als "Lange" Version bezeichnete Überlieferung des Textes ist wahrscheinlich im Wesentlichen eine Synthese der Kurzen Version und eines Kommentars; diese Annahme wird auch durch einige Wiederholungen im Text gestärkt.
Am weitesten verbreitet dürfte allerdings die mit nur 1300 Worten "Kurze" Version genannte Überlieferung sein. Das dürfte auch daran liegen, daß es sich hierbei im großen und ganzen um die Variante handelt, die für den zweiten Druck des Buches (Mantua 1562), der auch mit Kommentaren versehen war. So dürfte sie von vorneherein eine größere Verbreitung gefunden haben.
Die für die Kabbalisten wichtigste dürfte allerdings die sogenannte Gra-Ari- Version sein. Sie wurde 1550 aus älteren Manuskripten von Moshe Cordevero gewonnen, später von Yitzak Luria bearbeitet und im 18. Jahrhundert ein weiteres Mal durch den berühmten Gaon von Vilna, Rabbi Eliahu redigiert. Sie ist die einzige Variante, die mit dem System des Sohars übereinstimmt und ähnelt in weiten Teilen der Kurzen Version. Sie gilt den Kabbalisten als die Version, die von allen dem Original am nächsten kommt.
Allerdings kursieren noch sehr viele weitere Abwandlungen des ursprünglichen Textes; ein Grund dafür dürfte in der langen mündlichen Überlieferung zu finden sein, ein weiterer darin, daß die Kabbala nicht jedem zugänglich sein sollte und ihr Wissen für Außenstehende nicht zugänglich machen wollte. So ist es denkbar, daß bewußt falsche Versionen dieser Schrift in Umlauf gebracht wurden.
Kommentare
Der älteste erhaltene Kommentar stammt von Saadja Gaon, geschrieben wurde er 931. Allerdings wissen wir, daß auch zuvor bereits Kommentare zum Sefer Jezira geschrieben worden waren; sie sind zum Teil in jüngeren Schriften zitiert. Um die Mitte des zehnten Jahrhunderts schrieben Rabbi Shabbatai Donello und Donash ibn
Tamim zwei weitere Kommentare; bemerkenswert hierbei und für die Schwierigkeit des Buches kennzeichnend ist, daß jeder dieser Kommentare eine andere Version behandelt.
Insgesamt dürfte es heute mehr als 80 verschiedene Kommentierungen des Sefer Jezira geben, die das Buch sowohl aus philosophischer als auch aus mystischer Richtung anzugehen versuchen. Oft wurde auch versucht, ein gemeinsames System mit dem Sohar und dem Sefer Bahir (Buch der Großartigkeit / der Helle) zu finden oder zu schaffen.
"G-tt ersann sie, bildete sie, stellte sie zusammen, wog sie vertauschte sie und brachte durch sie die ganze Schöpfung hervor,
wie alles, was erschaffen werden soll..."
aus dem Sefer Jezira
Anmerkungen zum Inhalt des Sefer Jezira
Die Grundlage des Denkens, wie es uns im Sefer Jezira vorgestellt wird bilden die zehn Sefiroth, die Urzahlen, zusammen mit den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets, die zugleich auch die Elemente symbolisieren. Diese 32 "Wege der Weisheit" beinhalten die Kräfte, vermittels derer Gott durch ihre immer neue Kombination die Welt schuf, sie bieten den Zugang zum mystischen Prinzip der Schöpfung und geben damit auch die Möglichkeit, selber schöpferisch tätig zu werden.
Der Autor vermischt dabei ganz offensichtlich die Zahlenmystik des Neuplatonismus bzw. Neupythagoräismus mit altem jüdischen Gedankengut, indem er bis auf das Gedankengut der Merkaba-Mystik sowie alter magischer Traditionen zurückgreift, verschmilzt er doch den Gedanken der Sefiroth mit den Wesen, die nach Hesekiel den Thron Gottes tragen.
Die Art der hellenistischen Einflüsse auf das Buch läßt sich aber nicht genauer bestimmen; die These Leo Baecks, daß sie auf eine Bearbeitung der Philosophie des Neuplatonikers Proclus zurückgehen, wird von Scholem zurückgewiesen, auch wenn er neuplatonische Einflüsse auf das Werk durchaus anerkennt. Scholem selbst macht sie jedoch eher an dem Vokabular des Buches fest, an Formulierungen wie sefiroth belima, die normalerweise auf Hebräisch keinen Sinn ergeben, im Sefer Jezira jedoch von zentraler Bedeutung für die nähere Bestimmung der Sefiroth sind. Sie bleiben rätselhaft, Scholem geht davon aus, daß ihnen meist griechische Termini zugrundeliegen, die allerdings noch nicht identifiziert werden konnten.
Was festzuhalten bleibt, ist, daß die Sefiroth so etwas wie mystische Weltprinzipien darstellen, die verschiedenen Kategorien zugeordnet sind. Dabei stehen die ersten vier Sefiroth offenbar in besonders enger Verbindung zueinander, da sie offensichtlich auseinander entstehen. Am bedeutensten ist hierbei das erste Sefiroth, das den Hauch oder Geist Gottes darstellt, aus dem als erstes Element die Luft hervorgeht, aus der wiederum die anderen Elemente, Wasser und Feuer hervorgehen. Die Erde erscheint nicht, wie bei Aristoteles, als Element.
Hier spaltet sich die Kette der Schöpfung: aus der Luft entstehen die 22 Buchstaben, aus dem Wasser das kosmische Chaos und aus dem Feuer schließlich die Merkaba. Wie genau dieser Schaffensprozeß vor sich geht, bleibt im Dunkeln, ebenso wie die Entstehung der letzten sechs Sefiroth, die die Dimensionsrichtungen angeben. Was jedoch immer wieder betont wird, ist die Einheit der Sefiroth; auch ist augenfällig, wie häufig Vokabeln aus der Merkabavision Hesekiels benutzt werden. Offensichtlich versucht der Autor hier, eine Brücke zur älteren Tradition der Merkaba-Mystik zu schlagen.
Die Schöpfung selbst wird in drei Bereiche aufgeteilt, den Bereich des Menschen, sowie zwei rein kosmologische: den der Sterne und Planeten und, abstrakter, den der Zeit und ihrer Wirkungen. Diese Bereiche unterliegen der Wirkung der kosmischen Kräfte, die von den 32 Wegen der Weisheit ausgehen und sind durch sie geschaffen. Eine wichtige, speziellere Rolle spielen hierbei die "231 Pforten", die aus der Kombination jeweils zweier Elemente mit den Buchstaben entstehen.
Dabei sind die Buchstaben nach einem komplizierten phonetischen System in drei Gruppen geordnet:
- Aleph, Mem und Schin als "Mütter", die in den drei Elementen, aber auch den drei Jahreszeiten und den drei Teilen des menschlichen Körpers (Kopf, Brust, Bauch) ihre Entsprechungen finden. Bemerkenswert ist hier die Übernahme altgriechischer Vorstellungen in der Aufteilung des Jahres und in der Anatomie.
- Die zweite Gruppe besteht aus sieben "Doppelkonsonanten, die für die sieben Körperöffnungen, Planeten, Himmel und die Wochentage stehen, zugleich aber auch für sieben Pole, zwischen denen sich der Mensch in seinem Leben und seiner Beschränkung bewegt und die grundlegend sind: Leben / Tod, Frieden / Krieg, Klugheit / Dummheit, Schönheit / Häßlichkeit, Reichtum / Armut, Herrschaft / Sklaverei sowie schließlich Aussaat und Zerstörung.
- Die übrigen zwölf Konsonanten schließlich entsprechen den Tierkreiszeichen, den Monaten, den wichtigen Organen des menschlichen Körpers sowie den wichtigsten menschlichen Tätigkeiten.
Auch das Ziel des Buches ist dem der Merkaba-Mystik sehr ähnlich: es soll lehren, "was die Welt im Innersten zusammenhält" und Kenntnis vermitteln über die Buchstabenkombinationen und Namen, die es möglich machen, alles Seiende zu kontrollieren. Dadurch soll eine besondere Nähe zu Gott und eine Einsicht in seine Macht gewonnen werden.
Jedoch bleibt das Buch in weiten, oftmals bereits grundlegenden Teilen unklar: So ist sowohl die Natur der Sefiroth umstritten, es bleibt unklar, ob sie unendlich oder endlich sind, abstrakt, oder gar vollkommen unaussprechlich. Ebenso ist nicht vollends gewiß, ob sie aus Gott selbst entstehen oder auseinander, ob sie identisch sind mit den Elementen der Schöpfung oder bloße Zuordnungen.
"Rabha sagte: Wenn die Gereschten wollten, so könnten sie eine Welt schaffen, denn es heißt [Jes. 59,2]: Denn eure Sünden machen eine Scheidung zwischen euch und eurem Gott. Rabha nämlich schuf einen Menschen und schickte ihn zu Rabbi Zera. Der sprach mit ihm und er gab keine Antwort. Da sagte er: Du stammst wohl von den Genossen; kehre zu deinem Staub zurück."
aus dem Talmud4
Gebrauch des Sefer Jezira
Neben vollkommen abwegigen Vermutungen, die das Sefer Jezira lediglich als eine Art sprachhistorisches Werk ansehen, das sich mit dem Aufbau der hebräischen Sprache auseinandersetzt5, ist auch unter den Kabbalisten der praktische Nutzen des Buches nicht klar. Offenbar wird es mehrfach im Talmud erwähnt; die bekannteste Geschichte dabei dürfte die sein, derzufolge die Rebbes Oschaja und Chanina es jeden Freitag gelesen hätten, mit seiner Hilfe dann ein Kalb erschufen und es verzehrten. Der Überlieferung zufolge soll die Mystik, die das Sefer Jezira überliefert auch beim Aufbau des Stiftzeltes eine Rolle gespielt haben.
Das volkstümlichste Motiv allerdings, das auf das Buch der Schöpfung zurückgeht ist der Golem. Durch die Popularität dieser Vorstellung entstehen Zusammenhänge zu magischen Traditionen; ob sie bereits vom Verfasser intendiert waren oder ob er auf solche Wurzeln zurückgriff erscheint mir nicht unwahrscheinlich, bleibt bisher aber leider unbewiesen.
Umstritten ist, insbesondere bei der Schaffung eines Golem, inwieweit er einen praktischen Nutzen haben kann oder haben darf. Vor allem in alten Schriften wird abgestritten, daß es möglich wäre, einen künstlichen Menschen tatsächlich mit Leben zu erfüllen6. Später berichtet jedoch Judas der Fromme, daß Ben Sira zusammen mit seinem Vater Jeremia einen Menschen schuf, der alle Merkmale Adams trug; dazu gehört auch die Aufschrift JHWH Elohim 'Emeth (Gott der Herr ist die Wahrheit) auf der Stirn, was symbolisieren soll, daß dieser Mensch de facto Gottes Siegel trägt, also mit dem wahren Adam vollkommen übereinstimmt. Die darin implizierten Folgen wurden in einer Fortführung dieser Legende aus dem 13. Jahrhunderts erkannt, indem der Golem das aleph von Emeth ausradiert und die Inschrift ändert in: Gott der Herr ist tot. "Nun aber, wo ihr, wie ER, einen Menschen erschaffen habt, wird man sagen: Es ist kein Gott in der Welt außer diesen beiden!" Die Folge ist, wie in allen mir bekannten Fällen, die außerhalb der reinen volkstümlichen Überlieferung anzusiedeln sind, die augenblickliche Vernichtung des Golems und die Ziehung einer Konsequenz: "Wahrlich, man sollte diese Dinge nur studieren, um die Kraft und Allmacht des Schöpfers dieser Welt zu erkennen, aber nicht, um sie wirklich zu vollziehen."7 Denn was diese Legende als ausdrückliche Warnung vor uns hinstellt ist nichts anderes, als daß die Folge einer solchen Schöpfungstat nichts anderes wäre als der Tod Gottes.
Dennoch lebte die Idee der Golemschöpfung weiter und dürfte das Vorbild gewesen sein für die Idee des Homunculus wie sie in der Folge von Paracelsus auftaucht. Auch von neuzeitlichen Rebbes gibt es Berichte, sie hätten sich einen Golem als Diener geschaffen, ihn dann aber unter Gefährdung ihres eigenen Lebens aus Furcht vor seiner Kraft zerstört. Es ist also auch eine Veränderung im Ideal der Golemschöpfung festzustellen: Versuchte man zunächst, dem Bild des Adam möglichst nahezukommen, so stehen in späterer Zeit meist ungeheuer mächtige, aber sprach- und damit seelenlose Kreaturen im Mittelpunkt, die quasi die Funktionen von Dienern oder Maschinen übernehmen, also im Gegensatz zur früheren Zeit einen explizit praktischen Nutzen haben.
Doch habe ich den Eindruck, daß in der Tat das Buch der Schöpfung in erster Linie dem Zweck einer mystischen Versenkung in die Macht Gottes dienen soll und daß Berichte, die von einer zielgerichteten, praktisch sinnvollen Erschaffung irgendwelcher Wesen berichten, in erster Linie popularisierte Überlieferungen sind. Sagt doch Abraham Abulafia im 13. Jahrhundert, daß die, die wünschten anhand des Sefer Jezira sich ein Kalb zu erschaffen, selbst Kälber seien.
Quellen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Homepages:
http://www.hagalil.com/judentum/kabbala/jezirah0.htm members.tripod.de/Seashore_NGE/Sephiroth_Essay.html
Elektronische Nachschlagewerke:
Ecyclopaedia Britannica Deluxe Edition 2001
Encyclopaedia Judaica CD-Rom Edition Lambda Publishers o.J.
[...]
1 zitiert nach: http://www.hagalil.com/judentum/kabbala/jezirah0.htm
2 Paris 1552, übersetzt und herausgegeben von Guillaume Postel unter dem Titel: Abrahami Patriarchae liber
Jezirah, sive Formationis mundi, Patribus quidem Abrahami tempora praecedentibus revelatus, sed ab ipso etiam Abrahamo expositus Jsaaco, et per Profetarum manus posteritati conservatu, ipsis autum 72 Mosis auditoribus in secundo divinae veritatis loco, hoc est in ratione que est posterior autoritate habitus
3 Einen Hinweis darauf finden wir bei Rabbi Yaakov ben Nissim im 10. Jahrhundert: "Leute schreiben hebräische Kommentare zu dem Buch, und andere törichte Leute kommen später und kommentieren den Kommentar. Unter ihnen ist die Wahrheit verloren."
zitiert nach: http://www.hagalil.com/judentum/kabbala/jezirah0.htm
4 zitiert nach: Gerschom Scholem, Zur Kabbala und ihrer Symbolik, Zürich 1960
5 Phineas Mordell, The Origin of Letters and Numerals according to the Sefer Yetzirah, Philadelphia 1914
6 So heißt es im 2. Jahrhundert im Bereschit rabba, daß es allen Lebewesen unmöglich wäre, ein Leben zu schaffen und ihm eine Seele zu verleihen
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Sefer Jezira?
Das Sefer Jezira ist eine der ältesten vollständig erhaltenen kabbalistischen Schriften. Sein Ursprung, Alter und Urheberschaft sind unklar, aber es wird traditionell Abraham zugeschrieben. Wissenschaftliche Datierungen reichen von der Zeitenwende bis zum achten Jahrhundert nach Christus.
Wer hat das Sefer Jezira geschrieben?
Die Urheberschaft des Sefer Jezira ist umstritten. Traditionell wird es Abraham zugeschrieben, aber einige glauben, dass Rabbi Akiba der Autor war. Es wurden auch neuplatonische und neupythagoräische Einflüsse festgestellt. Es ist möglich, dass es auf vorchristlichen Quellen beruht und mehrere Schichten sowie frühe Kommentare enthält.
Welche Versionen des Sefer Jezira gibt es?
Es gibt vier wichtige Varianten des Sefer Jezira: die Kurze, die Lange, die Saadia- sowie die Gra-Ari-Version. Die Saadja-Version gilt als die älteste, während die Gra-Ari-Version für die Kabbalisten die wichtigste ist, da sie mit dem System des Sohars übereinstimmt.
Was sind die "32 Wege der Weisheit" im Sefer Jezira?
Die 32 "Wege der Weisheit" bestehen aus den zehn Sefiroth (Urkräfte) und den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets. Sie beinhalten die Kräfte, durch die Gott die Welt schuf und bieten einen Zugang zum mystischen Prinzip der Schöpfung.
Was sind die Sefiroth?
Die Sefiroth sind mystische Weltprinzipien, die verschiedenen Kategorien zugeordnet sind. Die ersten vier Sefiroth stehen in enger Verbindung zueinander und entstehen auseinander. Das erste Sefiroth stellt den Hauch oder Geist Gottes dar.
Was ist die Bedeutung der Buchstaben im Sefer Jezira?
Die Buchstaben des hebräischen Alphabets symbolisieren die Elemente und sind nach einem komplizierten phonetischen System in drei Gruppen geordnet: Aleph, Mem und Schin (die "Mütter"), sieben "Doppelkonsonanten" und zwölf weitere Konsonanten, die den Tierkreiszeichen, Monaten, Organen und Tätigkeiten entsprechen.
Was ist das Ziel des Sefer Jezira?
Das Ziel des Sefer Jezira ist es, Kenntnisse über die Buchstabenkombinationen und Namen zu vermitteln, die es ermöglichen, alles Seiende zu kontrollieren. Dadurch soll eine besondere Nähe zu Gott und eine Einsicht in seine Macht gewonnen werden.
Was ist ein Golem im Zusammenhang mit dem Sefer Jezira?
Der Golem ist ein künstliches Wesen, das durch die Mystik des Sefer Jezira erschaffen wird. Die Idee der Golemschöpfung ist populär, aber es gibt unterschiedliche Ansichten darüber, ob es möglich oder erlaubt ist, einem Golem tatsächlich Leben einzuhauchen.
Welchen praktischen Nutzen hat das Sefer Jezira?
Neben mystischen Versenkungen wird das Sefer Jezira oft mit der Erschaffung von Wesen in Verbindung gebracht, aber diese Berichte werden oft als popularisierte Überlieferungen angesehen. Abraham Abulafia sagte im 13. Jahrhundert, dass diejenigen, die anhand des Sefer Jezira ein Kalb erschaffen wollen, selbst Kälber seien.
Wo finde ich weitere Informationen über das Sefer Jezira?
Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Homepages: http://www.hagalil.com/judentum/kabbala/jezirah0.htm und members.tripod.de/Seashore_NGE/Sephiroth_Essay.html. Sie können auch in elektronischen Nachschlagewerken wie der Encyclopaedia Britannica Deluxe Edition 2001 und der Encyclopaedia Judaica CD-Rom Edition suchen.
- Arbeit zitieren
- Jan Schenkenberger (Autor:in), 2001, Das Sefer Jezira - Das Buch der Schöpfung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108726