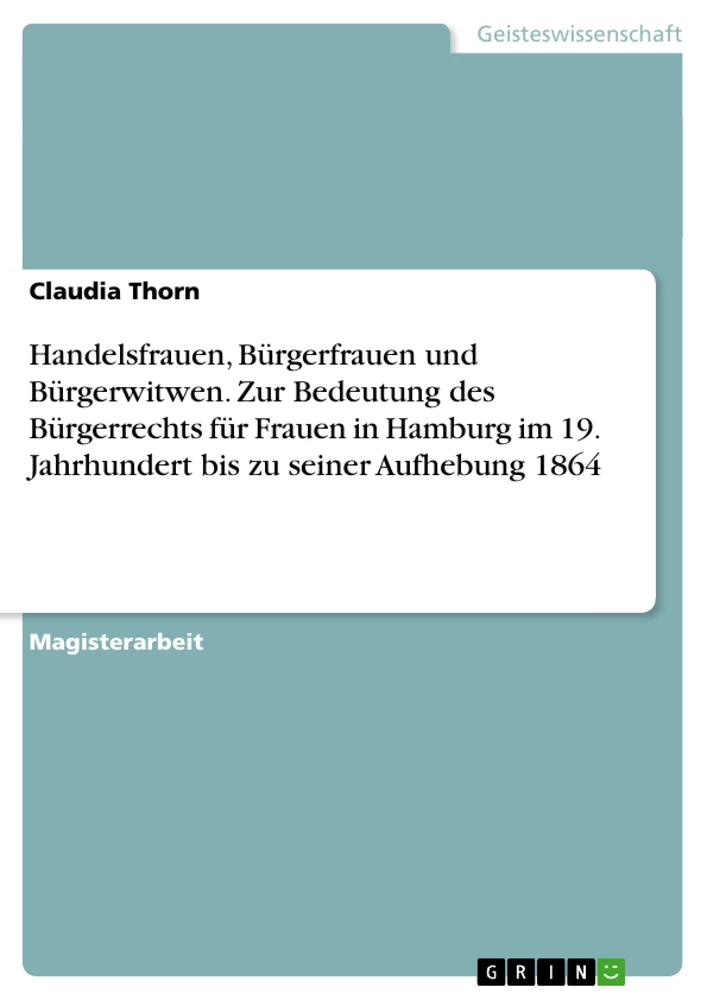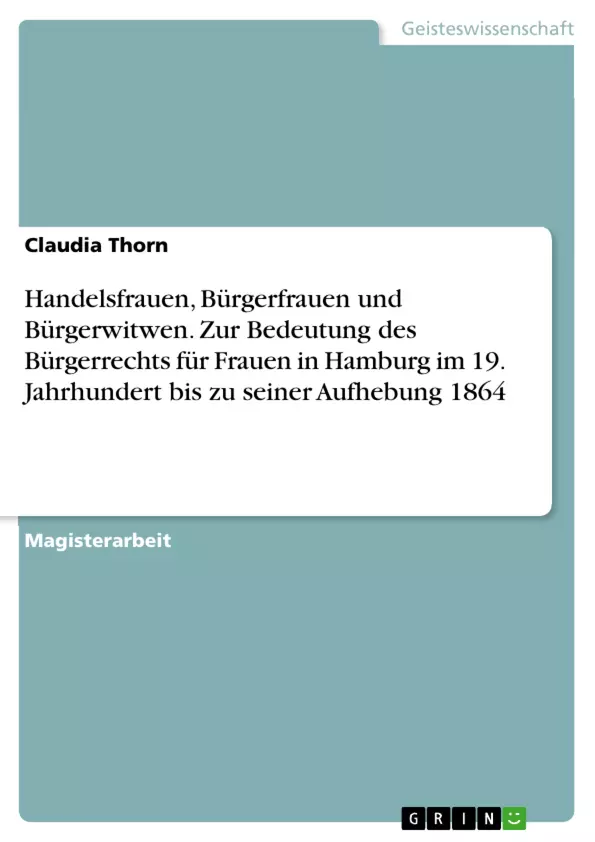Stellen Sie sich eine Hansestadt vor, in der das Echo mittelalterlicher Traditionen noch im 19. Jahrhundert widerhallt, aber sich gleichzeitig die Rufe nach Modernisierung und sozialer Gerechtigkeit mehren. In diesem Hamburg, einem Schmelztiegel aus Kaufmannsherrlichkeit und aufstrebendem Bürgertum, entfaltet sich eine intrigue um das Bürgerrecht – ein Privileg, das nicht nur den Männern vorbehalten war. Diese tiefgreifende Analyse taucht ein in die verborgene Welt der Handelsfrauen, Bürgerfrauen und Bürgerwitwen, die im Schatten der Speicher und Kontorhäuser um ihren Platz in der Gesellschaft kämpften. Untersucht werden die rechtlichen Grundlagen, die soziale Realität und die wirtschaftlichen Zwänge, die das Leben dieser Frauen prägten. War das Bürgerrecht tatsächlich ein Schlüssel zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit, oder nur ein symbolischer Status, der ihnen letztendlich verwehrt blieb? Das Buch beleuchtet die Entwicklung des Bürgerrechts in Hamburg von den ersten Kodifizierungsversuchen bis zur dessen Aufhebung für Frauen im Jahr 1864. Es analysiert die Bürgerrechtsverordnungen von 1833 und 1845, die Verfahrensweisen beim Erwerb und bei der Aufgabe des Bürgerrechts sowie die Kosten, die damit verbunden waren. Ein besonderer Fokus liegt auf der sozioökonomischen Verteilung der Bürgerinnen, ihrer Herkunft, ihrem Familienstand und ihrer Altersstruktur. Welche Gewerbe betrieben diese Frauen, und inwieweit wurden sie durch zünftische Beschränkungen oder gesellschaftliche Vorurteile behindert? Die Darstellung berücksichtigt sowohl quantitative Daten aus den Bürgerprotokollen als auch qualitative Aspekte, wie die Motive für die Aufgabe des Bürgerrechts. Schließlich wird die Aufhebung des weiblichen Bürgerrechts im Kontext der allgemeinen Diskussion um Gewerbefreiheit und politische Partizipation untersucht. War die Aufhebung ein Zeichen fortschrittlicher Modernisierung, oder ein Rückschritt für die Gleichberechtigung der Frauen? Das Buch bietet einen differenzierten Einblick in die Lebenswelt der Frauen im Hamburg des 19. Jahrhunderts und wirft ein neues Licht auf die Bedeutung des Bürgerrechts und die komplexen Zusammenhänge zwischen Recht, Wirtschaft und Geschlecht. Es behandelt die Entwicklung des Bürgerrechts in Hamburg bis 1845, die bürgerrechtliche Situation zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die Bürgerrechtsverordnung von 1833, Definition des großen und kleinen Bürgerrechts sowie des Bürgerrechts für Frauen, Ursprünge des Bürgerrechts für Frauen und des Status der Handelsfrau, die Bürgerrechtsverordnung von 1845, Bürgerswitwen, Bürgerstöchter, Verfahren und Kosten des Erwerbs des Bürgerrechts, Vereidigung der Bürgerinnen, Kosten für Bürgerinnen. Ebenso die sozio-ökonomische Verteilung der Bürgerinnen bei Erwerb und Aufgabe des Bürgerrechts, generelle Verhältnismäßigkeiten von weiblichen und männlichen Einwohnern und Bürgern in Hamburg, Anzahl und familiäre Struktur der Einwohner Hamburgs 1866, quantitative Verteilung der männlichen Bürgeranträge zwischen 1811 und 1864, quantitative Verteilung der weiblichen Bürgeranträge zwischen 1811 und 1864, die soziale Struktur der Bürgerinnen, Familienstand und Herkunft, Altersverteilung der Bürgerinnen bei Antragstellung, die von den Bürgerinnen betriebenen Gewerbe, Gewerbe der Ledigen vor und nach Erwerb des Bürgerrechts, Gewerbe der Witwen nach Erwerb des Bürgerrechts, mögliche Ausgrenzung von Frauen aus dem Bereich selbständiger Tätigkeit, Verlassen des hamburgischen Nexus, Aufgabe des Bürgerrechts, Gründe für die Aufgabe des Bürgerrechts von Frauen zwischen 1834 und 1865. Abschließend wird die Aufhebung des weiblichen Bürgerrechts 1864 behandelt, die gesellschaftspolitische Präsenz und Akzeptanz des weiblichen Bürgerrechts, Hamburger Bürgervereine, Bürgerliche Rechte und weibliches Engagement in Hamburg um 1850, die Hamburger Frauenhochschule, Frauen, politisches Bürgerrecht und Gewerbefreiheit, allgemeine Diskussion um die Gewerbefreiheit und das Bürgerrecht, frauenspezifische Aspekte der Verhandlungen um Gewerbefreiheit und Bürgerrecht.
Handelsfrauen, Bürgerfrauen und Bürgerwitwen
Zur Bedeutung des Bürgerrechts für Frauen in Hamburg im 19. Jahrhundert
bis zu seiner Aufhebung 1864
Wissenschaftliche Hausarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
einer Magistra Artium
der Universität Hamburg
vorgelegt von
Claudia Thorn
Hamburg 1995
Abkürzungen
BGB - Bürgerliches Gesetzbuch
BremJb - Bremisches Jahrbuch
gen. - genannt
geschied. - geschieden
Handl. - Handlung (Geschäft)
Hbg - Hamburg
HGBll - Hansische Geschichtsblätter
HZ - Historische Zeitschrift
J. - Jahr
MHG - Mitteilungen des Vereins für Hamburgische Geschichte
Mk - Kurant Mark
Mo. - Monat
RhVBll - Rheinische Vierteljahresblätter
Rth - Reichstaler
Sh - Schilling(e)
StAHbg - Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg
StABrem - Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen
TO - Tagesordnung
v. - von/vom
Wo. - Woche(n)
ZHG - Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte
ZLGA - Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde
Inhaltsverzeichnis
1 EINLEITUNG 5
2 DIE ENTWICKLUNG DES BÜRGERRECHTS IN HAMBURG BIS 1845 13
2.1 Die bürgerrechtliche Situation zu Beginn des 19. Jahrhunderts 13
2.2 Die Bürgerrechtsverordnung von 1833 17
2.2.1 Definition des großen und kleinen Bürgerrechts sowie des Bürgerrechts für Frauen 17
2.2.2 Ursprünge des Bürgerrechts für Frauen und des Status der Handelsfrau 20
2.3 Die Bürgerrechtsverordnung von 1845 25
2.3.1 Bürgerswitwen 27
2.3.2 Bürgerstöchter 29
2.4 Verfahren und Kosten des Erwerbs des Bürgerrechts 32
2.4.1 Vereidigung der Bürgerinnen 33
2.4.2 Kosten für Bürgerinnen 35
3 SOZIO-ÖKONOMISCHE VERTEILUNG DER BÜRGERINNEN BEI ERWERB UND AUFGABE DES BÜRGERRECHTS 42
3.1 Generelle Verhältnismäßigkeiten von weiblichen und männlichen Einwohnern und Bürgern in Hamburg 42
3.1.1 Anzahl und familiäre Struktur der Einwohner Hamburgs 1866 42
3.1.2 Quantitative Verteilung der männlichen Bürgeranträge zwischen 1811 und 1864 45
3.1.3 Quantitative Verteilung der weiblichen Bürgeranträge zwischen 1811 und 1864 49
3.2 Die soziale Struktur der Bürgerinnen 54
3.2.1 Familienstand und Herkunft 54
3.2.2 Altersverteilung der Bürgerinnen bei Antragstellung 58
3.3 Die von den Bürgerinnen betriebenen Gewerbe 60
3.3.1 Gewerbe der Ledigen vor und nach Erwerb des Bürgerrechts 63
3.3.2 Gewerbe der Witwen nach Erwerb des Bürgerrechts 69
3.3.3 Mögliche Ausgrenzung von Frauen aus dem Bereich selbständiger Tätigkeit 75
3.4 Verlassen des hamburgischen Nexus 78
3.4.1 Aufgabe des Bürgerrechts 78
3.4.2 Gründe für die Aufgabe des Bürgerrechts von Frauen zwischen 1834 und 1865 80
4 DIE AUFHEBUNG DES WEIBLICHEN BÜRGERRECHTS 1864 86
4.1 Die gesellschaftspolitische Präsenz und Akzeptanz des weiblichen Bürgerrechts 88
4.1.1 Hamburger Bürgervereine 89
4.1.2 Bürgerliche Rechte und weibliches Engagement in Hamburg um 1850 91
4.1.3 Die Hamburger Frauenhochschule 95
4.2 Frauen, politisches Bürgerrecht und Gewerbefreiheit 98
4.2.1 Allgemeine Diskussion um die Gewerbefreiheit und das Bürgerrecht 98
4.2.2 Frauenspezifische Aspekte der Verhandlungen um Gewerbefreiheit und Bürgerrecht 104
5 SCHLUSSBETRACHTUNG UND AUSBLICK 114
6 LITERATURVERZEICHNIS 120
6.1 Quellen 120
6.1.1 Unveröffentlichte Quellen 120
6.1.2 Veröffentlichte Quellen 121
6.1.3 Zeitungsartikel 123
6.2 Literatur 124
7 ANHANG 129
7.1 Daten der weiblichen Bürgerrechtsanträge aus den Bürgerprotokollen 1811-1864 129
7.2 Anzahl der gesamten Bürgeranträge in den Bürgerprotokollrn von 1811 bis 1864 getrennt nach dem Geschlecht 154
Jahr gesamt Frauen Männer 154
7.3 Vergleich zwischen der Anzahl der selbständig von Bürgerinnen zwischen 1811 und 1864 betriebenen Gewerbe und denen der selbständigen Frauen in der Statistik der Volkszählung vom 3. Dezember 1867 156
1. Einleitung
Eine grundlegende Voraussetzung für die Untersuchung der wirtschaftlichen und sozialen Stellung der Frau in der Gesellschaft ist die Kenntnis ihres rechtlichen Status. Dies ist in bezug auf die Stellung der Frau in der Stadtgesellschaft vor allem für das Mittelalter von der Forschung berücksichtigt worden. Das sich im Mittelalter ausprägende Städtewesen entwickelte neue Formen der rechtlichen Stellung seiner Einwohner und ermöglichte dadurch neue Chancen der wirtschaftlichen und sozialen Etablierung auch von Frauen. Die rechtlichen Bedingungen, unter denen die Frauen lebten und arbeiteten, setzten sich aus verschiedenen Bestimmungen zusammen (z. B. das eheliche Güterrecht, das Erbrecht, die Vormundschaftsregelungen), von denen das Bürgerrecht nur ein Teil war. Doch gerade dem Bürgerrecht und dem Bürgerstatus kam bis weit in das 19. Jahrhundert hinein eine besondere Bedeutung zu.
Stadtbürger zu sein bedeutete nicht nur die Wahrnehmung besonderer Rechte und Pflichten gegenüber der städtischen Verwaltung, sondern war seit dem Mittelalter auch der Inbegriff für Unabhängigkeit und Fortschrittlichkeit der städtischen Gemeinschaften und ihrer Bewohner. Während für das Mittelalter die Grundlagen des Selbstverständnisses der Stadtbürger(innen) im Vordergrund der (frauenhistorischen) Forschung stand, weil die Entstehung der großen Handelsstädte mit ihren Stadtrechten und städtischen Bürgerrechten ein Gegenstück zur ländlichen, feudalen Gesellschaft darstellten, ist der Erforschung dieser Formen des gesellschaftlichen Lebens in der Frühen Neuzeit weniger Aufmerksamkeit gewidmet worden. Dem mag die Gegebenheit zugrunde liegen, daß, wie Erika Uitz es ausdrückte, die gesellschaftliche Stellung der Frau in den mittelalterlichen Städten "eine beachtliche Aufwertung" erfuhr, sich diese Tendenz in der Frühen Neuzeit jedoch nicht fortsetzte.1
Einen Einblick in verschiedene Aspekte des weiblichen (hanse-)städtischen Lebens vom Mittelalter bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts gibt die von Barbara Vogel und Ulrike Weckel herausgegebene Aufsatzsammlung "Frauen in der Ständegesellschaft".2 Aber auch hier ist der rechtliche Status und die daraus resultierende soziale Stellung der Frau nur für das ausgehende Mittelalter und den Beginn der Frühen Neuzeit Gegenstand der Darstellungen.
Für das 19. Jahrhundert verbessert sich die Forschungslage zur Stellung der Frau in der Gesellschaft wieder. Dies ist zum einen durch die einschneidenden Veränderungen des gesellschaftlichen Lebens im Zuge der Industrialisierung und die daraus resultierende Umstrukturierung der Familie, die Frauenfabrikarbeit und das Armutsproblem bedingt, aber auch durch die Stadtbürger, deren ökonomischer, sozialer und kultureller Habitus im 19. Jahrhundert die sogenannte bürgerliche Gesellschaft formierte, deren Wertvorstellungen auch das Leben der bürgerlichen Frauen nachhaltig beeinflußten. So tritt in der Forschung zum 19. Jahrhundert der Bürger und die städtische bürgerliche Gesellschaft in der historischen Frauenforschung wieder in den Mittelpunkt des Interesses.3
Schwerpunkte der Forschung sind dabei weniger die bürgerlichen Rechte und deren praktische Bedeutung, sondern kulturelle Aspekte und Reformansätze, die seit der Aufklärung durch das Bürgertum repräsentiert und vorangetrieben wurden, und ihr Wirken auf einzelne Bereiche des weiblichen Lebens, wie die Organisation des Familienlebens, oder auf die generelle Stellung der Frau in der bürgerlichen Gesellschaft. Doch sind es die Bürgerrechte in Städten wie Lübeck, Bremen, Frankfurt und Hamburg, die bis in das zweite Drittel des 19. Jahrhunderts die politische und ökonomische Entwicklung der Stadtgesellschaften bestimmten und dadurch auch die Perspektiven der Frauen in den Städten.
In dieser Arbeit ist ′die Bürgerin′ bzw. ′der Bürger′ ein zentraler Begriff. Er ist gekennzeichnet durch verschiedene Bedeutungen, die sich im Laufe der Zeit durch den jeweiligen zeitgenössischen Sprachgebrauch entwickelt haben. Besonders in bezug auf das 19. Jahrhundert gibt es sehr unterschiedliche Definitionen des Bürgers sowohl in der zeitgenössischen Selbsteinschätzung als auch in der historischen Forschung. Mit dem Bürger als Stadtbürger, wie er seit dem Mittelalter aufgrund seines rechtlichen Status existierte, vermischte sich das sogenannte Wirtschaftsbürgertum als bourgeoise Schicht und das sogenannte Bildungsbürgertum. Beide flossen als neue bürgerliche Kategorien in den zeitgenössischen Bürgerbegriff ein, gleichzeitig distanzierten sich einzelne Gruppen des Bürgertums von anderen Bürgern. So verstand das sogenannte Bildungsbürgertum, entgegen der Rechtspraxis vieler Städte, kleine Handwerker und Kaufleute oftmals nicht als Bürger.4
Es besteht die Möglichkeit, den Bürgerbegriff dadurch zu verdeutlichen, daß man ihn durch wesentliche Einschränkungen auf eine bestimmte Gruppe präzisiert, wie den Wirtschaftsbürger, den Bildungsbürger, den Stadtbürger, den Kleinbürger etc. Problematisch ist es jedoch in einer Stadt wie Hamburg, die zu den "Handels- und Gewerbestädten alter Tradition"5 im 19. Jahrhundert gehörte und die auf eine lange Tradition des sie verwaltenden Bürgertums zurückblicken kann, eindeutig zwischen den einzelnen Aspekten des Bürgerdaseins zu unterscheiden. Im zeitgenössischen hamburgischen Sprachgebrauch des 19. Jahrhunderts umfaßte die Bezeichnung oftmals nur die politisch partizipierenden Bürger, also jene, die das Recht hatten, in der Bürgerschaft zu erscheinen.6 Die rechtliche Definition des Bürgers ging jedoch bis 1864 viel weiter, da mit dem Status nicht nur politische Rechte verbunden waren.
Eine Grundbedingung des hamburgischen Staates, die sein Selbstverständnis gegenüber seinen Einwohnern ausdrückte und dadurch die Bedingungen festlegte, unter denen Einheimische wie Fremde in der Stadt leben und arbeiten konnten, war der Eintritt in den Nexus der Stadt. Das Recht, hamburgischer Bürger zu werden, war die umfassendste von verschiedenen Formen der Staatsangehörigkeit.7 Es gab das kleine und das große Bürgerrecht, die sich durch die Höhe des zu entrichtenden Bürgergeldes und durch differierende wirtschaftliche Rechte unterschieden, aber alle Inhaber des Bürgerrechts waren Bürger der Stadt.
Deshalb bezieht sich der Bürgerbegriff dieser Arbeit auf die rechtliche Bedeutung des Begriffs, also auf den Stadtbürger im eigentlichen Sinne, der eine Vielzahl verschiedener Bevölkerungsgruppen einschloß. Aufgrund der sozialen Schichtung der Bürger ist in einigen Zusammenhängen auch von bürgerlich, großbürgerlich und kleinbürgerlich die Rede. Diese Unterscheidung bezieht sich auf den ökonomischen Status der jeweiligen Bürger und wurde gewählt, um zu verdeutlichen, daß die Gruppe der Bürger ökonomisch weit auseinanderklaffte. Denn jeder, der in der Stadt ein Gewerbe treiben, ein Grundstück erwerben oder heiraten wollte, war verpflichtet, Bürger in Hamburg zu werden. So waren Kleinhändler und kleine Handwerker, deren Einkommen kaum über dem Existenzminimum lag, ebenso Bürger, wie die Senatsmitglieder oder Kaufleute. Jedoch konnten jüdische Einwohner Hamburgs, auch wenn sie Kaufleute waren und dem Hamburger ′Bürgertum′ im Sinne der Kaufmannschicht zugerechnet wurden, den rechtlichen Bürgerstatus bis 1849 nicht erlangen (zugewanderte fremde Juden erst 1854).8 Insgesamt gilt es zu bedenken, daß die Bürger, auch wenn sie eine heterogene Gruppe darstellten, die theoretisch unbegrenzt erweiterungsfähig war, innerhalb der Stadt nur eine Minderheit waren.
Die ersten zwei Drittel des 19. Jahrhunderts zeichneten sich in Hamburg durch generelle Reformbestrebungen aus. Sie galten nicht nur verfassungsrechtlichen Reformen, sondern waren auch auf die soziale Problematik gerichtet, die eine ständig wachsende Stadt mit sich brachte. Spiegelbild für solche Entwicklungen ist immer der politische Diskurs und die damit verbundene Gesetzgebung.
Besonders in bezug auf die bürgerlichen Rechte der Frauen in Hamburg sind die Verwaltungsakten, die bei den verschiedenen Novellierungen der Bürgerrechts- und Staatsangehörigkeitsgesetze angefallen sind, von ausschlaggebender Bedeutung, weil es in diesem Bereich - wie in vielen die gesellschaftliche Stellung der Frau betreffenden Bereichen - an privaten oder anderen individuellen frauenspezifischen Quellen mangelt. Den Rahmen für diese Arbeit bildet dementsprechend die Bürgerrechtsgesetzgebung des 19. Jahrhunderts.
Im 19. Jahrhundert kam es zu einer Kodifikation des Bürgerrechts, angefangen von der "Verordnung über die gegen das Einschleichen der Fremden erlassene Verfügung und bei der Annahme zum Bürger beliebte Einrichtung" vom 20. November 18059 und der "Vorschrift für diejenigen[,] die das Bürgerrecht nachsuchen" gleichen Datums.10 Mit der Festlegung der Zulassungsrechte von Fremden und einem vereinheitlichten Fragebogen, der bei der Anmeldung zum Bürgerrecht Aufschluß über die Person und deren wirtschaftliche Basis geben sollte, versuchten Senat11 und Bürgerschaft durch soziale Kontrolle bei der Bürgerannahme, den ansteigenden Problemen der Armut in Hamburg entgegenzutreten.
Ihren Abschluß fand die Kodifikation im "Gesetz betreffend die Staatsangehörigkeit und das Bürgerrecht" vom 7. November 1864.12 Es bildete aus verschiedenen Gründen den Schlußpunkt der bürgerrechtlichen Entwicklung, bei dem viele Aspekte älterer Bürgerrechtsgesetze aufgehoben wurden, so daß sich das Bürgerrecht zu einem reinen Recht der politischen Partizipation wandelte. Das Gesetz schrieb zum ersten Mal kein städtisches Bürgerrecht mehr, sondern bezog sich auf das gesamte hamburgische Staatsgebiet. Schließlich war es das letzte Gesetz, in dem die Staatsangehörigkeitsverhältnisse Hamburgs geregelt wurden, bevor das Bundesgesetz vom 1. Juni 1870, das die Bundes- und Staatsangehörigkeitsfragen regelte und mit der Reichsgründung im ganzen Deutschen Reich Gültigkeit besaß, inkrafttrat und die Landesgesetzgebung bezüglich der Staatsangehörigkeit aufhob.13
Auch für die Frauen der Hansestadt stellte das Gesetz von 1864 einen besonderen rechtlichen Schlußpunkt dar. Ihnen wurde das Recht, Bürgerin zu werden, das erst 1845 gesetzlich genau definiert worden war, entzogen. Bis dahin waren Frauen nicht nur Ehefrauen bzw. Witwen von Bürgern, sondern konnten selbständig das Bürgerrecht erwerben. Sprachlich wurden sie im allgemeinen dadurch unterschieden, daß erstere Bürgersfrauen und Bürgerswitwen genannt wurden, während letztere als Bürgerinnen bezeichnet wurden.
Das Bild der selbständigen Bürgerin ist verbunden mit dem Bild der Kauffrau. Bekannte Frauen, über deren Leben uns Zeugnisse vorliegen und die die Bürgerinnen der freien Städte repräsentierten, waren zumeist Witwen, die nach dem Tod des Mannes das Handelshaus weiterführten, bis die Kinder erwachsen waren. Vereinzelt gab es auch Frauen, die als Ehefrauen großen Anteil an den Handelsgeschäften des Mannes hatten.
In Hamburg war es im 17. Jahrhundert vor allem Glückel von Hameln, die durch die von ihr verfaßten Memoiren eine reichhaltige Quelle hinterließ.14 Sie gehörte zu den Witwen der Oberschicht, die nach dem Tod des Mannes den Handel weiterführten, und sie tat dies mit großem Erfolg. Allerdings konnte Glückel von Hameln als Jüdin nicht Bürgerin werden, doch genoß sie als Kauffrau die gleichen ökonomischen Rechte wie christliche Kauffrauen, die Bürgerinnen waren. Ebenfalls als Witwen führten im 18. Jahrhundert Eva König, Anna Elisabeth Berenberg und Elisabeth Schramm die Handelsgeschäfte ihrer Männer weiter. Maria Möhring, die Ende des 18. Jahrhunderts den Vertrieb von Leinen aus der Weberei ihres Mannes zu einem eigenen großen Handelsgeschäft ausweitete, war in Zusammenarbeit mit ihrem Mann eine erfolgreiche Handelsfrau.15
Ziel dieser Arbeit ist es jedoch nicht, einzelne Beispiele von Bürgerinnen des 19. Jahrhunderts vorzustellen und daran die Bürgerin der Zeit zu dokumentieren. Vielmehr soll die generelle Entwicklung des weiblichen Bürgerrechts im 19. Jahrhundert dargestellt werden und die Bedeutung der Erlangung des Bürgerrechts für Frauen allgemein untersucht werden. Dies scheint nicht zuletzt deshalb notwendig, weil in der frauenhistorischen Literatur oftmals festgestellt wird, daß Frauen nicht Bürgerin werden konnten und kein eigenes Bürgerrecht besaßen, wobei jedoch unterstellt wird, daß Bürgerrecht gleich politische Rechte war. Wenn auf die Existenz von Bürgerinnen verwiesen wurde, dann um zu dokumentieren, daß es sich hier fast nur um Witwen handelte, die die Geschäfte des Mannses weiterführten.16
Zwar ist es richtig, daß mit dem weiblichen Bürgerrecht keine politischen Rechte verbunden waren, doch konnte im 19. Jahrhundert, in dem immer mehr (ledige) Frauen auf eigene Einkünfte angewiesen waren, der Erwerb des Bürgerrechts als wirtschaftliche Basis wichtig sein.
Es stellt sich die Frage, wie das Bürgerrecht für Frauen beschaffen war, und für welche Bereiche des weiblichen Alltags das Bürgerrecht von Bedeutung war. Waren es tatsächlich nur Witwen von Kaufleuten und vereinzelt ledige Bürgerstöchter, die in der elterliche Handelsfirma tätig wurden, die das Bürgerrecht erlangten oder war das Spektrum der Bürgerinnen größer? Gab es Geschäftsgründungen von ledigen Bürgerinnen oder Bürgerswitwen als Kauffrauen oder in anderen Erwerbszweigen?
Dazu galt es zunächst, den rechtlichen Rahmen abzustecken und festzustellen, in welcher Form das Bürgerrecht Frauen betraf, inwiefern Frauen bei selbständiger Arbeit dazu verpflichtet waren das Bürgerrecht zu gewinnen, welche Vorteile es ihnen brachte und wie hoch die Kosten waren, um Bürgerin zu werden.
Für die Beantwortung dieser Fragen waren vor allem die Bürgerrechtsgesetze von 1833 und 1845 und deren Erarbeitung in den Kommissionen als administrative Quellen von ausschlaggebender Bedeutung.17
Die administrativen Quellen geben Auskunft über Verfahren und Rechte der Bürgerrechtsgewinnung von Frauen und deren Behandlung durch den Senat. Um die persönliche Bedeutung des Bürgerrechts besser beurteilen zu können, wären subjektive Stimmen von Hamburger Bürgerinnen als Informationsquelle erforderlich, die jedoch nur in sehr begrenztem Umfang vorliegen. Die Quellenlage läßt es jedoch zu, über die Bürgerprotokolle die sozialen Hintergründe der Antragstellerinnen zu beleuchten.
Anhand der quantitativen Auswertung der Bürgerprotokolle von 1811 bis 1864 soll dargestellt werden, wie hoch der Anteil der Frauen an der Gesamtzahl der Bürger war, wie sich die Verhältnisse im Verlaufe des 19. Jahrhunderts entwickelten und wie die soziale Zusammensetzung der Bürgerinnen war. Letzteres wurde durch die Erfassung und Auswertung der Bürgerprotokolle von Bürgerinnen nach dem Familienstand, der Herkunft, der Altersstruktur und der von ihnen als Bürgerinnen angestrebten Berufe realisiert.
Ergänzt wird diese Auswertung durch die Analyse der persönlichen Motive von Frauen, den Nexus der Stadt zu verlassen. Sie ergeben sich aus den "ex nexu civico" Akten, die für den Zeitraum von 1834 bis 1864 ausgewertet wurden.18 Im Gegensatz zu den Antworten in den tabellarischen Fragebögen, die bei Erwerb des Bürgerrechts ausgefüllt werden mußten, finden sich hier persönliche schriftliche Begründungen des Austritts, die Einblick in die Einschätzung der persönliche Situation durch die Antragstellerin geben. Sie geben als einzige Quellen individuelle Stellungnahmen wieder.
Nachdem im dritten Kapitel festgestellt wird, welche Frauen das Bürgerrecht im neunzehnten Jahrhundert als Grundlage für eine selbständige Arbeit gewannen, wird im abschließenden vierten Kapitel die Aufhebung des Bürgerrechts für Frauen, die im Zusammenhang mit der Einführung der Gewerbefreiheit steht, dargestellt. Die Untersuchung der Diskussion um die Bürgerrechtsänderung und die Einführung der Gewerbefreiheit wurde unter zwei Aspekten vorgenommen: Zum einen unter der Perspektive, inwiefern die Aufhebung des Bürgerrechts die wirtschaftliche Stellung der Frauen beeinflußte, zum anderen, ob bei der Bürgerrechtsänderung, die schließlich das Bürgerrecht auf ein politisches Recht reduzierte, das den Frauen nicht zugestanden wurde, die politische Partizipation von Frauen in Erwägung gezogen oder als Forderung von außen an Senat und Bürgerschaft herangetragen wurde.
Ausgehend von den wirtschaftlichen Vorteilen, die Bürgerinnen gegenüber anderen Bewohnerinnen Hamburgs hatten, wird gefragt, ob die Aufhebung des weiblichen Bürgerrechts den wirtschaftlichen oder sozialen Status der Frau veränderte, ob Frauen auf den Gesetzentwurf reagierten oder ob das wirtschaftliche Bürgerrecht an sich im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts als Anachronismus angesehen werden muß und dementsprechend auch für Frauen ein Hindernis war.
Die Frage nach der politischen Partizipation der Frauen stellt sich nicht nur vor dem Hintergrund der beginnenden Frauenbewegung und der Einbeziehung von Frauen in die staatsbürgerliche Verantwortung, sondern auch in bezug auf die eingeführte Gewerbefreiheit, denn die rechtliche und politische Beschränkung von Frauen war trotz Gewerbefreiheit ein Nachteil bei deren geschäftlicher Interessenvertretung.
Um den Umgang mit den frauenspezifischen Entscheidungen hinsichtlich des Bürgerrechts und der Gewerbefreiheit innerhalb der gesamten Diskussion zu Beginn der 1860er Jahre beurteilen zu können, ist im vierten Kapitel vor den Ausführungen zur Aufhebung des Bürgerrechts der Versuch unternommen worden, anhand der Darstellung von Organisationen der bürgerlich-demokratischen Bewegung und der frühen Frauenbewegung in Hamburg, eine Beschreibung der gesellschaftlichen Präsenz von Frauenfragen zu geben. Sie soll zeigen, ob das Bürgerrecht für Frauen um die Mitte des 19. Jahrhunderts von den demokratischen Kräften und öffentlich aktiven bürgerlichen Frauen als Möglichkeit für Frauen zu selbständigem Erwerb wahrgenommen wurde, aber auch als mögliche Basis für die politische Einbeziehung der Bürgerinnen in die demokratischen Reformen.
3 Die Entwicklung des Bürgerrechts in Hamburg bis 1845
3.1 Die bürgerrechtliche Situation zu Beginn des 19. Jahrhunderts
Bis zur französischen Besatzung Hamburgs im Jahre 1806 gab es in Hamburg das Bürgerrecht, den Fremdenkontrakt und die Schutzverwandtschaft als Formen des städtischen Nexus.
Das Bürgerrecht ermöglichte dem Bürger eine selbständige wirtschaftliche Existenz, erlaubte ihm, Grundeigentum zu erwerben und sich zu verheiraten. Es war aber auch Voraussetzung, um bestimmte Ämter19 zu erwerben. Auch die Ausübung politischer Rechte war an das Bürgerrecht gebunden, jedoch wurden sie bis 1859 durch weitere Auflagen eingeschränkt. Seit 1712 stellte die hamburgische Bürgerschaft zusammen mit dem sich selbst ergänzenden Senat die gesetzgebende Gewalt der Stadt dar. Teilnahmeberechtigt an den Konventen der Bürgerschaft waren aber nur evangelisch-lutherische Bürger, die Grundeigentum in der Stadt besaßen, das einen Wert von 1.000 Rth Species innerhalb der Stadtmauern bzw. 2.000 Rth Species außerhalb der Stadtmauern hatte; die sogenannten Erbgesessenen.20
Da die Zahl der Grundstücke in der Stadt begrenzt war, die Einwohnerzahlen im 19. Jahrhundert jedoch ständig stiegen und mit ihnen auch die Zahl der Bürger, bedeutete das Bürgerrecht für den Großteil der Hamburger Bürger lediglich das Recht zu heiraten und auf die Ausübung einer ′bürgerlichen Nahrung′, d. h. die Ausübung der Berufe, für die das Bürgerrecht Voraussetzung war. Dazu gehörte der Handel, sowohl als Krämer wie auch als Großhändler (Kaufmann), zünftige Gewerbe und die Realgerechtsame, Ämter, die von vornherein auf eine bestimmte Zahl begrenzt waren, wie Bäcker, Brauer und Schlachter. Aber auch die wirtschaftlichen Rechte machten das Bürgerrecht zu einer exklusiven Form der Staatsangehörigkeit. Wer das Bürgerrecht nicht besaß, war in seinen beruflichen Möglichkeiten sehr beschränkt. Ziel dieser Regelung war es, möglichst viele Einwohner dazu zu bewegen, in den städtischen Nexus einzutreten, um sie auch in die Bürgerpflicht, wie z.B. den Beitritt zum Bürgermilitär, nehmen zu können.
Bis in das 19. Jahrhundert gab es Auflagen bezüglich der Zulassung von Einwohnern und Fremden zum Bürgerrecht. Die Antragsteller durften nicht wendischer Herkunft oder Leibeigene sein und mußten dem christlichen Glauben oder den Mennoniten angehören.21 Auch Adeligen war theoretisch der Eintritt in den städtischen Nexus verwehrt, was jedoch in der Praxis nicht durchgeführt wurde, sofern diese Personen nicht auf die Geltendmachung des Adels bestanden.22 Eine Ablehnung der Bürger wegen der Herkunft aus einer bestimmten sozialen Gruppe gab es nicht. Die Exklusivität des Bürgerrechts drückte sich jedoch auch in seinen Kosten aus. Auf diese Weise wurden die finanziell schlechter gestellten Einwohner vom Bürgerrechtserwerb abgehalten. Zwar gab es das sogenannte große und das kleine Bürgerrecht, doch waren die Kosten für das kleine Bürgerrecht, mit dem in Hamburg alle bürgerlichen Rechte erworben wurden, mit 40 Mk23 sehr hoch.
Besonders die Verknüpfung von Bürgerrecht und Recht auf Verehelichung brachte Probleme mit sich, da viele Einwohner sich das Bürgerrecht nicht leisten konnten, aber ohne es nicht rechtmäßig heiraten durften. Hier setzte die Schutzverwandtschaft an. Sie war dazu da, ärmeren Einwohnern, die das Bürgerrecht nicht erwerben konnten und es aus wirtschaftlichen Gründen auch nicht erwerben mußten, das Heiraten zu ermöglichen. Die Schutzverwandtschaft wurde nur denjenigen erteilt, die nachweisen konnten, daß sie wegen ihres geringen Einkommens lediglich zu einer jährlichen Abgabe von einem Schutztaler fähig waren und kein Gewerbe betrieben. Dabei handelte es sich überwiegend um Tagelöhner und Matrosen. Schutzbürger durften heiraten, aber keine ′bürgerliche Nahrung′ treiben. Wurde der Schutzbürgervertrag nicht verlängert, z. B. weil der Schutzbürger über mehr Einkommen verfügte, mußte er entweder die Stadt verlassen oder Bürger werden.24
Das gleiche galt für die Einwohner Hamburgs, die über den Fremdenkontrakt befristet mit der Stadt verbunden waren. Der Fremdenkontrakt war geschaffen worden, um wohlhabenden Fremden die Niederlassung in Hamburg zu erleichtern, wenn sie ihre eigentliche Staatsangehörigkeit nicht aufgeben konnten oder wollten. Durch den Fremdenkontrakt wurden finanzkräftige Fremde in die Lage versetzt, alle bürgerlichen Rechte außer den politischen und der Ausübung von zünftigen Gewerben wahrzunehmen. Sie konnten selbständigen Handel und unzünftige Gewerbe betreiben, Grundstücke erwerben und heiraten. Allerdings mußten sie, wenn sie eine Bürgerswitwe oder -tochter heiraten wollten, Bürger der Stadt werden. Von den bürgerlichen Pflichten waren sie befreit. Generell stand ihnen das Recht, Bürger zu werden, jederzeit zu.25
Jüdische Einwohner konnten bis 1849 das Bürgerrecht nicht gewinnen, bezüglich ihrer wirtschaftliche Rechte waren sie seit 1710 als Mitglieder der beiden israelitischen Gemeinden in Hamburg jedoch berechtigt, selbständig Handel zu treiben. Grundstücke durften sie nicht erwerben.26
Erste Bestrebungen, das Bürgerrecht im 19. Jahrhundert genauer zu definieren, gab es gleich zu Beginn des Jahrhunderts. Sie waren auf Fremde ausgerichtet, die sich in der Stadt aufhielten und arbeiteten, ohne die Staatsangehörigkeit zu erwerben. Die schon erwähnte Verordnung des Jahres 1805 gegen das Einschleichen von Fremden, deren Bestimmungen 1806 auf das Gebiet des damaligen Hamburgerbergs ausgeweitet wurde27, war einzig darauf ausgerichtet, zu vermeiden, daß arme Fremde mit ihren Familien in die Stadt kamen und hier der Armenversorgung zur Last fielen. Da mit dem Wachstum der Stadt und ihrer wirtschaftlichen Bedeutung ein ständiger Zuzug von Fremden einherging, sollte der Erwerb des Bürgerrechts und ab 1806 auch der der Schutzverwandtschaft insofern reglementiert werden, daß die Antragsteller und Antragstellerinnen detailliert über ihre persönliche Situation Auskunft geben mußten. Dazu wurde in der "Vorschrift für diejenigen die das Bürgerrecht nachsuchen wollen", die ebenfalls 1805 erlassen wurde, ein standardisierter Fragebogen aufgeführt, den alle Bewerber zum Bürgerrecht auszufüllen hatten: das Bürgerprotokoll.28 Es wurde gesetzlich verfügt, daß der finanzielle Status der Bürgeranwärter soweit als möglich hinterfragt werden sollte, bevor sie zum Bürgerrecht zugelassen wurden. Gleichzeitig wiesen Senat und Bürgerschaft in der Verordnung von 1805 eindringlich darauf hin, daß es Hamburgern seit 1791 verwehrt sei, Fremde aufzunehmen, von denen sie nicht wußten, wovon sie sich ernährten, und daß sie bei Strafe verpflichtet seien, aufgenommene Fremde am nächsten Tag bei der Wedde zu melden.29 In §1 der Verordnung wurde zusätzlich festgelegt, welche Fremde an den Toren der Stadt sofort zurückzuschicken seien und wie mit unberechtigt eingeschlichenen Fremden zu verfahren sei. Die Fremdenpolizei wurde also erheblich verstärkt.
In dieser Verordnung gab es keine frauenspezifischen Definitionen. Bei dem ′unrechtmäßigen′ Erwerb des Bürgerrechts hatten Senat und Bürgerschaft männliche Arbeitskräfte im Auge, die mit ihren Familien nach Hamburg gekommen waren und nach kurzer Zeit der Armenversorgung bedurft hatten.
Durch die französische Besatzung wurden die Formen der Staatsangehörigkeit in ihrer Anwendung eingeschränkt.
1810 wurde das Fremdenrecht außer Kraft gesetzt und ab 1813 wurden keine Schutzverwandten mehr aufgenommen. Es bestand nach Abzug der Franzosen 1814 faktisch nur noch das Bürgerrecht als Form der Staatsangehörigkeit30, was zu einer Diskussion um die Wiederaufnahme bzw. Revision des hamburgischen Nexus führte, die aber zunächst nicht ernsthaft verfolgt wurde. 20 Jahre blieb das Bürgerrecht die einzige Möglichkeit, offizielles Mitglied des hamburgischen Staates zu werden.
Seit 1815 bestand eine Kommission zur Prüfung der Staatsangehörigkeitsverhältnisse. Sie wurde jedoch erst in den 30er Jahren auf Drängen des Mitglieds Senator Hudtwalcker, der die steigende Zahl der wilden Ehen begrenzen wollte, aktiv.
Das Bürgerrecht als einzige Form der Staatsangehörigkeit konnten sich viele der einheimischen einfachen Arbeiter ebensowenig leisten wie viele Fremde, die auf der Suche nach Arbeit in die Stadt kamen. Und da eine Verheiratung - wie oben beschrieben - nur dem erlaubt war, der im Besitz des hamburgischen Bürgerrechts war, hatte die Zahl der Partnerschaften ohne Trauschein in Hamburg zugenommen. Als besonderes Klientel für wilde Ehen sah Hudtwalcker die Dienstboten an.31
Unmittelbares Ergebnis von Hudtwalckers Bemühungen waren die Erfassung aller Dienstboten sowie der Erlaß einer Verordnung über wilde Ehen. Gleichzeitig wurde die Revision der Staatsangehörigkeit vorangetrieben, um die Zuwanderung zu begrenzen32, doch kam es zunächst nur zu einer neuen Bürgerrechtsverordnung. Der Fremdenkontrakt wurde nicht wieder eingeführt, die Schutzverwandtschaft erst 1837.
Der Umgang mit Fremden und die Begrenzung der Verleihung des Bürgerrechts nur an solvente Einwohner war das beherrschende Thema der gesamten Kodifikation des Bürgerrechts im 19. Jahrhundert. Doch die Bürgerrechtsverordnung von 1833 war gleichzeitig die erste Verordnung, in der versucht wurde, das Bürgerrecht umfassend zu definieren und gesetzlich festzuhalten.
3.2 Die Bürgerrechtsverordnung von 1833
Die Regulierung des Bürgerrechts bezog sich weniger auf Inhalte, als auf die Fixierung der Rechte und Pflichten der Bürger, die es schon seit langer Zeit gab, wobei es aber zu einer Umverteilung von Rechten von der Großbürgerspflicht zur Kleinbürgerspflicht kam.
3.2.1 Definition des großen und kleinen Bürgerrechts sowie des Bürgerrechts für Frauen
In seiner ersten Stellungnahme bezüglich der Neugestaltung des Bürgerrechts vor dem Senat führte Senator Hudtwalcker schon am 20. Januar 1830 die historische Entwicklung der einzelnen Rechte an, um darauf aufbauend die nach Ansicht der Kommission notwendigen Inhalte einer neuen Bürgerrechtsverordnung zu erläutern.33 Dabei handelte es sich um Details des Bürgerrechts, die aus vorhandenen Akten, aus früheren Recherchen und aus der täglichen Praxis bei der Zulassung zum Bürgerrecht zusammengestellt waren. Bezüglich der bürgerlichen Rechte wies Hudtwalcker auf die Unterschiede von großem und kleinem Bürgerrecht hin. Während das kleine Bürgerrecht die generellen bürgerlichen Rechte wie den Grundstückserwerb, das Betreiben ′bürgerlicher Nahrung′, die Heirat, das Ausüben einiger zünftiger Gewerbe und die politischen Rechte sicherte, waren einige Berufsgruppen auf den Erwerb des großen Bürgerrechts angewiesen.
Es mußten "alle Kaufleute, die einen beträchtlichen Handel treiben, und zum Betrieb ihres Gewerbes offene Laden, Buden, und Keller halten wollten"34 das Großbürgerrecht gewinnen. Hinzu kamen einige Handwerksmeister und alle, die die große Waagschale benutzen wollten. In Anlehnung an eine Zusammenstellung von Bürgermeister Amsinck 1815 führte Hudtwalcker aus, daß demnach außer Kaufleuten auch "Apotheker, Gewürzhändler, Tuchhändler, Weinhändler, Fetthändler, Mehlhöker, Grützmacher, und Zuckerbäcker" Großbürger werden mußten. Demgegenüber waren zum Kleinbürgerrecht "Handwerker, Flachskrämer, Mäkler, Buchhalter, Arbeitsleute, Krüger, Höker" verpflichtet.35
Nach dieser Definition waren alle, die Handel in ihrem eigenen Geschäft betrieben und war es auch noch so klein, bis 1833 zum Großbürgerrecht verpflichtet.
Als zusätzliche Rechte konnten Großbürger bis 1833 in Anspruch nehmen, vom Stader- und Landzoll befreit zu werden und ein Bankkonto zu führen.
Mit der Bürgerrechtsverordnung von 1833 wurde das Großbürgerrecht lediglich auf die Rechte des Deklarierens von Transitwaren und auf den Besitz eines Bankfoliums beschränkt, eine Verpflichtung zum Großbürgerrecht für diejenigen, die zur Ausübung ihres Berufs auf den Gebrauch der Waage angewiesen waren, gab es nicht mehr. Dies wurde auch in der Presse als Fortschritt gewertet, denn gerade für manche Detailhändler, die auf den Gebrauch der Waage angewiesen waren, wie z. B. Mehlhöker, war der Erwerb des teuren Großbürgerrechts eine Last.36
Den Ausführungen der Kommission zum Bürgerrecht läßt sich nicht entnehmen, inwiefern die Bürgerrechtspflicht vor 1833 generell auch für selbständige Frauen galt. Daß Frauen seit dem Mittelalter Bürgerin wurden, hat die Auswertung des ältesten bekannten hamburgischen Bürgerbuchs, in dem die Bürgerannahmen von 1277 bis 1452 verzeichnet waren, durch Laurent 1841 gezeigt.37 Auch Westphalen erwähnt nur, daß es schon im Mittelalter Bürgerinnen gegeben hat, ohne deren Rechte oder Pflichten näher zu beschreiben. Lehr weist in seinem historischen Abschnitt zum Bürgerrecht lediglich darauf hin, daß Frauen der Erwerb des Bürgerrechts nicht "verwehrt" war38, geht aber nicht darauf ein, inwieweit sie verpflichtet waren, es zu erwerben.
Erstaunlicherweise wird im "Bürgerfreund", der 1831 als Ratgeber von Amalie Schoppe nach den Aufzeichnungen von Friedrich Heinrich Schoppe herausgegeben wurde, das weibliche Bürgerrecht nicht erwähnt. Der "Bürgerfreund" verstand sich als Handbuch für "jeden" Bürger und Einwohner Hamburgs, in dem deren Rechte und Pflichten erläutert wurden, doch findet sich unter dem Punkt "Das Bürgerwerden" weder ein Hinweis auf das Bürgerrecht für hamburgische Frauen noch für Zugewanderte.39
Die Kommission zur Bürgerrechtsreform von 1833 ging in ihrer Definition der weiblichen Bürgerrechte nicht sehr weit. In der Verordnung wurden Frauen nur an zwei Stellen explizit erwähnt. In §1 heißt es zunächst.:
"Jeder, der hieselbst in eigenem Namen oder für eigene Rechnung ein Geschäft treiben, oder sich verheirathen will, muß, in sofern er nicht zur israelitischen Gemeinde gehört, das Bürgerrecht gewinnen. Auch Handelsfrauen sind dazu verpflichtet."40
Da jüdische Einwohner das Bürgerrecht vor 1849 nicht gewinnen konnten, wurden sie in §3 der Verordnung darauf hingewiesen, daß sie als Kaufleute für die großbürgerlichen Zoll- und Bankrechte den gleichen Betrag zu zahlen hatten wie Großbürger. Auch an dieser Stelle wurden die Ausführungen durch den Hinweis ergänzt, daß dies auch für jüdische Handelsfrauen gelte.41
Der Hinweis auf die Bürgerrechtspflicht von Handelsfrauen ist die einzige Hervorhebung der weiblichen Form in der Verordnung. Weitere spezifische Vorschriften, wie das Verhalten beim Verlassen des städtischen Nexus in § 14 und die im Anhang der Verordnung aufgeführten Kosten für das Bürgerrecht, unterschieden zwar zwischen Bürger und Bürgerssohn, von Bürgerinnen und Bürgerstöchtern ist jedoch nicht die Rede.
Wären die Vorschriften zum Erwerb des Bürgerrechts allgemein gültig, Frauen also ebenso verpflichtet gewesen, bei jeder Art von selbständigem Handel das Bürgerrecht zu gewinnen wie Männer, hätte es des Zusatzes der Verpflichtung von Handelsfrauen nicht bedurft. Dann wären nach 1833 Hökerinnen und Krämerinnen zum kleinen Bürgerrecht verpflichtet gewesen und Kauffrauen, die die Zollrechte in Anspruch nehmen wollten, zum großen Bürgerrecht.
Romina Schmitter hat in ihrer Darstellung des Bürgerrechts für Frauen in Bremen darauf hingewiesen, daß es im Gegensatz zu mittelalterlichen Texten im 19. Jahrhundert üblich war, generell die maskuline Form zu verwenden, auch wenn Frauen mitgemeint waren. In den Fällen, wo männliche und weibliche Rechte sich unterschieden, mußte dies deshalb deutlich gemacht werden, in dem darauf hingewiesen wurde, daß nur Männer oder Frauen davon betroffen waren.42
Legt man diese Einschätzung für die hamburgische Verordnung zu Grunde, so bleibt es weiterhin unerklärlich, warum die Bürgerrechtspflicht von Handelsfrauen betont wurde, es sei denn, es sollte darauf hingewiesen werden, daß von den selbständig erwerbstätigen Frauen nur Handelsfrauen persönlich das Bürgerrecht erlangen mußten.
Auch die Untersuchung der während der Ausarbeitung der Verordnung angefallenen Akten gibt keinen Hinweis auf den Grad der Bürgerrechtspflicht von Frauen und des Verständnisses des Wortes Handelsfrau. Der Begriff Handelsfrau wurde ohne Erörterung in die Verordnung aufgenommen, so daß davon auszugehen ist, daß es sich bei den weiblichen Bürgerrechten und -pflichten um allgemein bekannte und praktizierte Voraussetzungen handelte, die im 19. Jahrhundert nicht modifiziert wurden.
3.2.2 Ursprünge des Bürgerrechts für Frauen und des Status der Handelsfrau
Ein Blick auf die deutsche Mittelalterforschung zeigt, daß sich auch hier bezüglich des Bürgerrechts von Frauen kein eindeutiges Bild ergibt. Zwar ist sich die Forschung einig darüber, daß den Frauen mit dem Bürgerrecht große wirtschaftliche Vorteile verschafft wurden und, so Uitz, es den Bürgerinnen den "nötigen Rückhalt" im Alltagsleben gab43, doch ist nicht immer zweifelsfrei zu klären, auf welche Art von selbständiger Arbeit sich das Bürgerrecht erstreckte. Zum einen waren die damit verbundenen Rechte in den Städten unterschiedlich, zum anderen finden sich nicht überall in den Quellen ausreichend Belege, um die rechtliche Handhabung des Bürgerrechts für Frauen zu definieren.
Margret Wensky hat mit ihrer Dissertation zu Frauen in der mittelalterlichen kölnischen Wirtschaft wohl die umfangreichste regionale Studie zum Anteil der Frauen am städtischen Wirtschaftsleben im Mittelalter vorgelegt.44 Sie stellt für Köln fest, daß Frauen ebenso wie Männer gegen Bezahlung des Bürgergelds und Leistung des Bürgereids als Bürgerinnen aufgenommen und in die Listen der Neubürger eingetragen wurden. Es gab aber keinen generellen Zwang zum Bürgerrechtserwerb, um ein Gewerbe ausüben zu können oder Handel zu treiben. Nur für einzelne konzessionierte Gewerbe war das Bürgerrecht Voraussetzung. Darunter fielen jedoch auch Gewerbe, die teilweise oder fast ausschließlich von Frauen ausgeübt wurden, wie der Weinzapf, der Gewandschnitt und die Seidenweberei.45
In Lübeck konnte aus mittelalterlichen Testamenten entnommen werden, daß Frauen als Kauffrauen und Krämerinnen Bürgerinnen wurden.46 Ichikawa kommt in ihrer Zusammenfassung der Forschung zum lübischen Bürgerrecht für Frauen jedoch zu dem Schluß, daß es in den Quellen keine eindeutigen Hinweise gibt, mit denen unzweifelhaft nachgewiesen werden konnte, ob das Ausüben eines bürgerlichen Gewerbes nur in Verbindung mit dem Bürgerrecht möglich war, oder ob es weit mehr erwerbstätige Frauen als Bürgerinnen gab.47 Loose vertritt die Ansicht, daß das Bürgerrecht für Krämerinnen nicht Voraussetzung zum Betreiben des Gewerbes war, sondern bei den Bürgerinnen, die als Krämerinnen tätig waren lediglich "auf eine günstige Ausgangsposition für das gewählte Geschäft" hinweise.48 Er sieht die lübische Verpflichtung zum Bürgerrecht also auf Großhandel treibende Kauffrauen reduziert.
Ennen weist auf die besonderen Rechte von Handelsfrauen hin, dabei versteht sie unter Handelsfrauen auch Frauen, die ihre Ware zu Markte trugen.49 Insofern umfaßt die Gruppe der Handelsfrauen sowohl Großhändlerinnen als auch Einzelhändlerinnen im heutigen Sinne.
Uitz dagegen unterscheidet zwischen Fernhändlerinnen (Kauffrauen), Krämerinnen und Hökerinnen.50 Den Unterschied zwischen einer Kauffrau und einer Krämerin sieht Uitz in der Form der Handelsgeschäfte. Während die Kauffrau spezielle Waren en gros einkaufte und verkaufte, handelte die Krämerin mit einem breiten Warensortiment, um die Käuferschichten aus der Stadt und dem Umland zu versorgen. Eine Hökerin schließlich hatte nur ein sehr geringes Angebot an Waren, die sie nur in kleinen Stückzahlen vorrätig hielt, oder sie beschränkte sich als Detailhändlerin auf das Anbieten nur einer Ware51, wobei Hökerinnen im Straßenverkauf tätig waren und keinen Laden betrieben. Besonders der Detailhandel mit Waren des täglichen Bedarfs auf Märkten und Straßen war im Mittelalter das Betätigungsfeld von Frauen. Hierbei handelte es sich zumeist um Frauen (Ehefrauen und Töchter), die die in der Familie hergestellten oder angebauten Waren verkauften, sofern die Zünfte dies gestatteten, teilweise aber auch um Frauen, die für ihre Arbeit als Weberin mit fertigen Waren entlohnt wurden, und diese dann auf dem Markt verkaufen mußten.52
Die von Uitz vorgenommene Unterteilung in Krämerinnen und Kauffrauen gilt auch für Hamburg im 19. Jahrhundert, jedoch waren die Übergänge vom Groß- zum Einzelhandel fließend. Buek stellte 1828 fest:
"In Hamburg besteht ein nothwendiger und gesetzlicher Unterschied zwischen dem Kaufmanne und dem Krämer. Der erstere handelt im Großen, in Quantitäten, der Krämer im Einzelnen. Um Krämer (oder hamburgisch technisch: Kramer) zu werden, muß man das Krameramt erlangen, Kaufmann aber kann Jeder werden, ohne sich in eine Innung oder ein Amt aufnehmen zu lassen, auch der Kramer ist oft neben seinem Kramhandel wirklicher Kaufmann."53
Diese Unterscheidung und die Tatsache, daß Einzelhändler ein Amt gewinnen mußten, also ′registriert′ wurden, während Kaufleute ohne jegliche gewerbliche Organisation handeln konnten, kann der Grund dafür gewesen sein, daß Handelsfrauen in der Verordnung ausdrücklich erwähnt wurden. Eine Krämerin, die eine Handlung führte, benötigte dazu die Genehmigung des Krameramts und wurde so von seiten des Amts zum Bürgerrecht veranlaßt, während eine Kauffrau ihr Gewerbe nicht genehmigen lassen mußte und vermutlich deshalb über das Gesetz nachdrücklich zum Bürgerrechtserwerb aufgefordert wurde.
Diese Annahme geht konform mit der Interpretation des weiblichen Bürgerrechts durch Baumeister 1856. Er meinte, daß sich das Bürgerrecht
"... in soweit auch auf das weibliche Geschlecht [erstreckt], daß Handelsfrauen oder die ein Geschäft auf eigenen Namen betreiben wollen, persönlich Bürgerin werden müssen,..."54
Baumeister bezog sich bei denen, die ein Geschäft ausüben wollten, auf alle, die dazu einen Laden, eine offene Bude oder andere ′Nahrung′ gebrauchten (wie z. B. die Waage). Begründet liegt diese Annahme in der Beschränkung der Vormundschaftsregelung für Handelsfrauen ab 1603.
Seit dem Mittelalter standen alle Frauen unter ständiger Vormundschaft hinsichtlich der Verwaltung ihres Vermögens. Grundsätzlich wurden Frauen durch die Geschlechtsvormundschaft sowohl in bezug auf ihr Auftreten vor Gericht wie auch bei außergerichtlichen Rechtsgeschäften als unmündig angesehen und konnten ohne einen hinzugezogenen Vormund (Kurator) diese Geschäfte nicht wahrnehmen. Bei verheirateten Frauen nahm der Ehemann diese Aufgabe wahr und bei ledigen Frauen bis 1732 lebenslang der Vater, sofern er nicht starb. Seit 1732 wurde die Vormundschaft dahingehend verändert, daß ledige Frauen über 18 Jahre als mündig angesehen wurden, was jedoch nur bedeutete, daß sie sich ihren Vormund selbst wählen konnten und nicht mehr ein Leben lang dem Vater Rechenschaft schuldig waren. Auch Witwen mußten nach dem Tod ihres Mannes wieder einen Kurator hinzuziehen.55
Seit dem Stadtrecht von 1603 gab es jedoch eine Ausnahme von dieser Regelung, die in vielen handelsorientierten Städten üblich war. Frauen, die Handel trieben, wurden von der Geschlechtsvormundschaft befreit:
"Eine Frau die Kauffmannschaft gebrauchet, offene Laden und Fenster hält, mit Gewichten aus- oder einwieget und misset, soll pflichtig seyn, dasjenige, so sie kauffet oder verkauffet, zu zahlen und zu liefern. Die aber, so der Kauffmannschaft nicht zugethan ist, kann ohne ihres Mannes oder ihrer Vormünder Wissen und Vollbort, außerhalb Leinwand und Flachs zu des Hauses Nothdurft gehörig, nichts beständiglich contrahiren."56
Die Aufhebung der Handlungsbeschränkung von Händlerinnen bezog sich jedoch nur auf die mit ihrem Geschäft in Zusammenhang stehenden Rechtsgeschäfte, für alle anderen Vermögensfragen mußte auch sie einen Kurator hinzuziehen. Ebenso wie Baumeister die Verpflichtung zum Bürgerwerden von Frauen, sah Gries, Anfang des 19. Jahrhunderts, die Befreiung der Kauffrau von der Geschlechtskuratel nicht nur auf Kauffrauen, die Großhandel betrieben, begrenzt, sondern auf "Alle Arten Handel oder Gewerbe treibende Frauen, z. B. Gastwirthinnen, Vorsteherinnen von Pensionsanstalten u. dgl.,...".57
Ob von der Geschlechtsvormundschaft befreite Frauen gleichzeitig das Bürgerrecht erwerben mußten, läßt sich aus den Bestimmungen nicht erkennen. Jedoch weisen die Details in den verschiedenen Abhandlungen darauf hin, daß die bürgerrechtspflichtigen Frauen mit den von der Geschlechtskuratel zu befreienden Frauen identisch waren, sofern es sich nicht um verheiratete oder verwitwete Bürgersfrauen handelte.
Bei verheirateten Frauen hing der Status als Handelsfrau davon ab, wie ihr Ehemann den Geschäftsbetrieb bewertete. Die Rechtssprechung des Handelsgerichts aus dem Jahre 1864 zeigt, daß eine Frau, die eine Handlung betrieb, nur dann als haftbar für Zahlungsversäumnisse im Rahmen des Geschäftsbetriebs angesehen wurde, wenn ihr Mann sie ausdrücklich als eigenverantwortliche Handelsfrau anerkannte. Nahm er hingegen wissentlich das Betreiben des Geschäftes hin, lehnt es aber ab, sie offiziell als Handelsfrau anzusehen, wurde der Ehemann als eigentlicher Betreiber des Geschäfts aufgefaßt und seine Frau lediglich als Angestellte der Handlung verstanden. In dieser Funktion konnte sie, wie jeder Handlungsangestellte, Rechtsgeschäfte abschließen, haftbar blieb jedoch der Ladeninhaber, also der Ehemann.58
Das Zusammentreffen von Bürgerrecht und Aufhebung der Beschränkung der Handlungsfähigkeit von Frauen kam also nur bei ledigen Frauen zustande, die ein eigenes Geschäft führten und bei verwitweten, wenn sie Großhandel betrieben. Grundsätzlich war die Befreiung von der Geschlechtskuratel an die Tätigkeit, also den Status der Handelsfrau gebunden. Demzufolge konnte eine Frau auch ohne Hinzuziehung eines Kurators ein Handelsgeschäft eröffnen59, während sie bei der Beantragung des Bürgerrechts entweder den väterlichen Vormund oder den gewählten Kurator als Beistand mitzubringen hatte.
Allerdings merkte Buek 1828 zum Bürgerrechtserwerb durch Frauen an:
"In neueren Zeiten hat der Senat auch hin und wieder Frauenzimmer, welche eigene Grundstücke in der Stadt hatten, Bürgerinnen werden lassen, in dem sie den Bürgereid vor versammeltem Senate abgestattet und dadurch das Recht erhalten haben, ohne einen Geschlechts-Curator Rechtsgeschäfte eingehen zu können."60
Nach seiner Auslegung wäre die Anerkennung der Befreiung von der Geschlechtskuratel an den Status der selbständigen Bürgerin gebunden gewesen. Buek erwähnt aber keine Handelsfrauen, die Bürgerin werden konnten, sondern nur Grundeigentümerinnen. Aus den Bürgerprotokollen ergibt sich jedoch, daß zwischen 1811 und 1827 unter 20 Frauen, die das Bürgerrecht beantragten, keine war, die wegen des Erwerbs eines Grundstücks Bürgerin wurde. Es befanden sich lediglich 2 Frauen darunter, die als Partikulierin ohne Geschäft das Bürgerrecht beantragten. Alle anderen wollten mit dem Bürgerrecht ein Geschäft ausüben.61 Bueks Einschätzung läßt sich also nicht untermauern.
Über die Bürgerrechtspflicht von Handwerkerinnen gibt die Verordnung keine Auskunft. Handwerker waren zum Bürgerrecht verpflichtet, konnten es aber nur erlangen, wenn sie vom zuständigen Amt die Erlaubnis dazu bekamen.62 In der Bürgerrechtsverordnung von 1845 wurde diese Auflage auf unzünftige Handwerker ausgeweitet. Sie mußten dazu nachweisen, daß sie eine Zeitlang in Hamburg bei einem Handwerker in Diensten standen und ihr Gewerbe beherrschten. Frauen wurden in diesem Zusammenhang allerdings nicht erwähnt.63
Unter den handwerklichen Berufen waren es vor allem die Schneiderei und die Putzmacherei, in denen Frauen im 19. Jahrhundert arbeiteten.64 Nach der Auslegung des Bürgerrechts durch Baumeister, wären Handwerkerinnen nur dann bürgerrechtspflichtig gewesen, wenn sie für ihr Gewerbe einen eigenen Laden beanspruchten. Übten sie ihr Gewerbe jedoch ohne Geschäft in den Häusern der Kundschaft oder in ihrer eigenen Wohnung aus, was allgemein üblich war, mußten sie nicht Bürgerin werden.
Es läßt sich zusammenfassend feststellen, daß die Bürgerrechtspflicht für Frauen an die Ausübung eines Handels mit eigenem Laden gebunden war. Da es nach der ′Franzosenzeit′ lediglich das Bürgerrecht als Staatsangehörigkeitsverhältnis gab, ist es fraglich, inwiefern alle erwerbstätigen Frauen, auch Handwerkerinnen oder Hökerinnen ohne eigenen Laden bürgerrechtspflichtig waren. In den Verhandlungen wurde dies nie berücksichtigt. Da jedoch die Anzahl der Bürgerinnen bis zu Beginn der 30er Jahre äußerst gering war - denn zwischen 1811 und 1830 beantragten nur 24 Frauen das Bürgerrecht65 - ist zumindest davon auszugehen, daß eine eventuelle Bürgerrechtspflicht den betroffenen Frauen nicht bewußt gewesen ist, oder von ihnen ignoriert wurde.
1837 führte die Stadt die Schutzverwandtschaft wieder ein. Sie ermöglichte es einfachen Arbeitern, Handwerkern in unzünftigen Gewerben, die keine Gehilfen hatten und Händlern, die keinen festen Laden hatten, ihr Gewerbe auszuüben, ohne das Bürgerrecht gewinnen zu müssen. Die Schutzverwandtschaft basierte auf der Zahlung eines jährlichen Schutztalers in Höhe von 3 Mk. Die Schutzbürger wurden vereidigt und demonstrierten so ihre Zugehörigkeit zum Staat, mußten aber keine Kaution hinterlegen und kein Bürgergeld bezahlen.66 Mit Wiedereinführung der Schutzverwandtschaft waren zumindest Hökerinnen und selbständige, alleinarbeitende Frauen in anderen Gewerben, die ein geringes Einkommen hatten und keinen Laden betrieben, nicht mehr verpflichtet, aufgrund ihres Gewerbes Bürgerin zu werden.
3.3 Die Bürgerrechtsverordnung von 1845
Der Versuch, das Bürgerrecht 1833 eindeutig zu fassen, kann nur als erster Schritt auf dem Weg der Kodifikation des Bürgerrechts betrachtet werden. Das zeigt die erneute Revision des Bürgerrechts 184567, in der vor allem in der Praxis schon übliche Vorgehensweisen, die in der Verordnung von 1833 nicht berücksichtigt worden waren, festgeschrieben wurden. Dies betraf im besonderen auch die Rechte von Frauen und hier vorrangig die von Bürgerswitwen und Bürgerstöchtern.
Als die Bürgerrechtsverordnung ab 1843 erneut verhandelt wurde, stellte sich heraus, daß es bezüglich der Bürgerrechtspflicht von Frauen große Unsicherheiten einzelner Deputationen gab, so daß die weiblichen Pflichten und Rechte bei Erwerb des Bürgerrechts in der Verordnung von 184568 detaillierter dargestellt wurden und auch in den Kommissionen eingehender behandelt wurden.
Ohne der Auswertung der Bürgerprotokolle im dritten Kapitel vorgreifen zu wollen, sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß es auch unter den Frauen Unsicherheiten über die Bürgerrechtsbedingungen vor 1833 gegeben haben muß, denn die Betonung der Verpflichtung von Handelsfrauen führte dazu, daß innerhalb von gut zwei Wochen nach Inkrafttreten der neuen Verordnung fünf Bürgerswitwen als Handelsfrauen das Bürgerrecht beantragten, vier von ihnen an einem Tag.69 Diese ungewöhnliche Häufung von weiblichen Bürgeranträgen kann nur darauf zurückzuführen sein, daß ihnen zuvor nicht bewußt war, daß sie als Handelsfrauen das Bürgerrecht erlangen mußten oder diese Pflicht ignorierten.
Die 1845 vorgenommenen Veränderungen betrafen im wesentlichen den Status der Bürgerswitwen und Bürgerstöchter, doch gab es erstmals auch allgemeine Bestimmungen zum Bürgerrecht für Frauen, die über die Feststellung, daß Handelsfrauen das Bürgerrecht gewinnen mußten, hinaus gingen.
So wurde eine Altersgrenze für Frauen erlassen. Sie mußten nicht wie männliche Bewerber das 22. Lebensjahr erreicht haben, sondern konnten mit 18. Jahren das Bürgerrecht gewinnen.70
Auch die Verpflichtung zum Bürgerrechtserwerb wurde genauer definiert. In §1 wurde unmißverständlich darauf hingewiesen, daß Bürgersfrauen und Bürgerstöchter für den Erwerb eines Grundstücks nicht selbst das Bürgerrecht gewinnen mußten. Schon in der Verordnung von 1839 war darauf hingewiesen worden, daß "rücksichtlich der Zuschreibung von Grundstücken an Bürgers-Frauen und Töchter (...) keine Änderung verfügt"71 wurde, obwohl diese Verfügung nicht Bestandteil der Verordnung von 1833 war. Es handelte sich hier also um eine Ausnahme von der Bürgerrechtspflicht, die schon seit langer Zeit existierte und erst 1839 explizit gesetzlich verfügt wurde.72
Obwohl der Passus zum Grundeigentumserwerb 1845 von §2 in §1 gezogen wurde und dort nun in direktem Zusammenhang mit den anderen Bürgerrechten und -pflichten von Frauen genannt wurde, blieben auch 1845 Unklarheiten bestehen.
Der oben genannten Verfügung ist nicht zu entnehmen, daß unter Bürgersfrauen auch Bürgerswitwen verstanden wurden, da deren Rechte und Pflichten ebenfalls in §1 der Bürgerrechtsverordnung unter der Verwendung der Anrede Bürgerswitwen benannt wurden. Danach ist davon auszugehen, daß sprachlich zwischen Bürgersfrauen und Bürgerswitwen unterschieden wurde. Aus den Äußerungen Hudtwalckers zum Witwenrecht läßt sich jedoch entnehmen, daß im Fall des Grundstückserwerbs unter Bürgersfrauen auch Bürgerswitwen fielen, denn er stellte fest, daß, mit Ausnahme der Befreiung vom Bürgerrecht bei Grundstückserwerb seit der letzten Verordnung, die Verhältnisse der Witwen vor 1845 nicht geregelt waren, was der Grund für einige Rechtsunsicherheiten war.73 Bürgerrechtspflichtig im Falle des Grundstückserwerbs waren demzufolge nur fremde Frauen und Frauen deren Angehörige nicht Bürger der Stadt waren.
3.3.1 Bürgerswitwen
Diese Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Status der Bürgerswitwen hatte seit der Verordnung von 1833 zu Unsicherheiten in der Verwaltung geführt, so daß sich die Kommission, die die Bürgerrechtsreform bearbeitete, gezwungen sah, die Witwenrechte eindeutiger zu formulieren.
Sowohl die Zoll- als auch die Akzisedeputation machten auf Schwierigkeiten im Umgang mit Bürgerswitwen aufmerksam. Die Zweifel wurden dadurch verursacht, daß aus der Verordnung von 1833 nicht eindeutig hervorging, ob unter der Bürgerrechtspflicht von Handelsfrauen auch Bürgerswitwen zu verstehen waren, die die Handelshäuser ihrer verstorbenen Männer leiteten.
In einem Schreiben an Senator Hudtwalcker vom 20.11.1843 betonte die Zolldeputation die Praxis, daß die Witwen Zollpapiere ohne Bürgerrecht unterschreiben konnten, doch ergäben sich Probleme, wenn das Privileg der Zollfreiheit abgelaufen sei und nun auf den Namen der Witwe verlängert werden müsse. Es sei unklar, ob diese Witwe vorher Bürgerin werden müsse oder nicht.74 Auch Kleinbürgerswitwen waren von dem Problem betroffen, wenn sie Schenkwirtinnen waren. Denn die Voraussetzung unter der die Akzisedeputation das Schenkrecht erteilte, war der Erwerb des Bürgerrechts und so verlangte die Deputation, daß auch Bürgerswitwen eigenständig das Bürgerrecht erlangen müßten, wenn sie eine Wirtschaft weiterführen oder gründen wollten.75
Senator Hudtwalcker verwahrte sich gegen die Annahme, daß diese Witwen selbständig Bürgerin werden müßten und stellte allgemein fest, daß es Fälle gebe,
"...wo Wittwen entweder, meiner Überzeugung nach, ohne Noth das Bürgerrecht erworben oder auch sich dem entziehen wollten, wo sie es hätten erwerben müssen."76
Die Unentschlossenheit betraf also sowohl den Umgang der Behörden mit den Witwen als auch die betroffenen Frauen selbst, die allem Anschein nach nicht genau wußten, in welchem Fall sie das Bürgerrecht gewinnen mußten.
Im Gesuch des Senats an die Bürgerschaft, das neue Gesetz zu genehmigen, hieß es zu §1, daß es bisher Rechtsunsicherheit darüber gegeben habe, inwiefern Bürgerswitwen, die das Geschäft des Mannes weiterführten, persönlich als Bürgerin vereidigt werden müßten:
"Es war bisher die Anomalie gebräuchlich, daß Bürgerswittwen entweder persönlich mit ihrem Curator die Zollzettel unterschrieben oder eine Zollvollmacht ausstellten, ohne den Bürgereid geleistet zu haben; andererseits blieb es bei der allgemeinen Vorschrift des § 22 der Consumtions-Accise Verordnung, daß niemand die Schenkfreiheit ausüben dürfe, der nicht das Bürgerrecht gewon[n]en habe, zweifelhaft, ob nicht auch die Wittwen selbst der kleinsten Schenkwirthe, die das Geschäft der Männer fortsetzen wollten, persönlich jenes Recht erlangen müßten."77
Während der Senat Wert darauf legte, daß zur Ausübung der großbürgerlichen Rechte auch Witwen persönlich das Bürgerrecht gewannen, nicht zuletzt, weil sie als Großbürgerinnen höhere Abgaben leisten mußten, konnte sich die Akzise mit der Forderung nach dem Bürgerrecht für Schenkwirtswitwen nicht durchsetzten.
Dementsprechend wurde der §1 der Bürgerrechtsverordnung, in der schon die Handelsfrauen erwähnt waren, um den Zusatz erweitert:
"Bürgerswittwen brauchen, wenn sie das Geschäft des Mannes fortsetzen, oder ein neues anfangen, nur dann persönlich das Bürgerrecht zu gewinnen, wenn das Geschäft eine Erklärung auf geleisteten Eid erforderlich macht, z. B. beim Verzollen."78
Wenn sie aber persönlich das Bürgerrecht erwerben mußten, so waren sie bezüglich des Bürgergeldes den Bürgerssöhnen gleichgestellt, die ein wesentlich geringeres Entgelt zahlen mußten als fremde Bürgeranwärter.79
Die Bürgerrechtspflicht für bestimmte Bürgerswitwen hatte also weniger finanzielle, als ideelle Ursachen. Hätte der Senat dies nur aus finanziellen Gründen für notwendig gehalten, hätte er allen Witwen, die die Geschäfte ihrer Männer weiterführten, auch solchen, die lediglich Kleinhandel oder Schenkwirtschaften betrieben, die Pflicht auferlegen können, Bürgerin zu werden. Hier ging es aber um die Ehrenbekundung gegenüber dem Staat, die Bürgerinnen und Bürger mit dem Bürgereid ablegten und die sie so berechtigte, territoriale wirtschaftliche Rechte wie das Verzollen wahrzunehmen.
Die Tatsache, daß die Befreiung der meisten Witwen von der Bürgerpflicht sich nicht nur auf das Führen des schon vorhandenen Geschäfts beschränkte, sondern auch auf Geschäftsgründungen bezogen war, weist darauf hin, daß die berufliche Tätigkeit von Witwen nach dem Tod des Mannes im 19. Jahrhundert verbreitet war und es nicht nur darum ging, Geschäfte solange zu führen und zu erhalten, bis die Kinder sie übernehmen konnten, sondern auch darum, den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Die Befreiung von der Bürgerrechtspflicht brachte ihnen einen großen Vorteil gegenüber fremden Frauen, die, um die gleichen Geschäfte betreiben zu können, Bürgerinnen werden mußten.
3.3.2 Bürgerstöchter
Die Versorgung der hamburgischen weiblichen Bürgerangehörigen spielte nicht nur bei den Bürgerswitwen eine Rolle, sondern auch bei den Bürgerstöchtern. Die Auseinandersetzung mit dem Problem fand auf zwei Ebenen statt.
Zum einen ging es darum, im Gesetz eindeutig festzustellen, welchen Status Bürgerstöchter im Vergleich zu Bürgerssöhnen hatten, denn die Praxis lehrte:
"Es kommt jetzt gar nicht selten vor, daß Frauenzimmer das Bürgerrecht erwerben. Die Wedde behandelt sie dabei, wenn sie Bürgerstöchter sind, den Bürgerssöhnen gleich, was im Gesetz auszudrücken zweckmäßig sein dürfte."80
Die Verordnung von 1845 bezog sich entsprechend dieser Einsicht in der Frage des Verlusts des Bürgerrechts, der Anerkennung als Bürgersangehörige und dem Alter der persönlichen Zulassung zum Bürgerrecht nicht mehr nur auf Bürgerssöhne, sondern auch auf Bürgerstöchter und wies darauf hin, daß Handelsfrauen, sofern sie Bürgerstöchter seien, wie Bürgerssöhne ein geringeres Bürgergeld entrichten mußten. Baumeister sah sogar die Bestimmung für Bürgerswitwen, daß sie nur dann Bürgerin werden müssen, wenn ihr Geschäft eine Erklärung auf den geleisteten Bürgereid nötig machte, auch für Bürgerstöchter als gültig an.81 Dies hätte bedeutet, daß auch Bürgerstöchter nur für großbürgerliche Rechte Bürgerin werden mußten, was sich jedoch im Wortlaut der Verordnung von 1845 nicht nachvollziehen läßt, da dieses Privileg ausdrücklich auf Bürgerswitwen bezogen war.
Die zweite Ebene der Auseinandersetzung, die auch für Bürgerstöchter eine Rolle spielte, war die Verheiratung. Die Pflicht, bei Verheiratung Bürger zu sein, war zwar seit der Wiedereinführung der billigeren Schutzverwandtschaft 1837 abgeschwächt, denn sie garantierte denen, die sie erwerben konnten, auch das Recht zu heiraten, doch fielen nicht alle unvermögenden Leute in diese Kategorie. Wer einen Gehilfen beschäftigte, ein zünftiges Gewerbe ausübte oder Handel in einem feststehenden Laden oder Lokal betrieb mußte weiterhin, unabhändig von der Höhe des Einkommens, das Bürgerrecht erlangen, auch zum Heiraten.
Während der Verhandlungen zur Bürgerrechtsreform 1845 wurde festgestellt, daß ein Großteil der Bürgeranträge einging, weil die Antragsteller heiraten wollten. In den unteren Schichten führte dies dazu, daß viele Bürgeranwärter, um das Bürgerrecht erwerben zu können, ohne sich die seit 1833 geforderte Kaution von 500 Mk82 leisten zu können, andere Bürger dafür bezahlten, daß sie sich für den Antragsteller verbürgten.83 Auf der einen Seite war die Stadt bestrebt, den Zuzug von unvermögenden Fremden und deren Gewinnung des Bürgerrechts zu bremsen und hatte gerade deshalb die Kaution für Fremde eingeführt, auf der anderen Seite waren aber die Bürgerstöchter der Stadt auf Bürger zum Heiraten angewiesen.
Während ein Bürgerssohn heiraten konnte, wen er wollte, sofern ihn sein Status als Bürgerssohn nicht aus Standesdünkel davon abhielt, Schutzverwandte oder lediglich Heimatberechtigte zu heiraten, konnte eine Bürgerstochter in Hamburg dies nicht, ebensowenig wie eine Bürgerswitwe. Denn während der Status des Bürgerssohnes auch auf seine Frau überging, benötigte die Bürgerstochter oder -witwe jemanden gleichen Status, um den ihren zu halten. Innerhalb Hamburgs hatte sie nicht einmal die Wahl, ob sie für eine Heirat mit einem Nichtbürger auf die Anerkennung als Bürgerswitwe oder -tochter verzichten wollte und damit auch auf den günstigen Zugang zum persönlichen Bürgerrecht und auf das Recht, Grundeigentum in der Stadt zu erwerben, denn seit dem Rezeß von 1579 durften nur Bürger Bürgerstöchter oder -witwen heiraten. Eine Verpflichtung, die übrigens, nachdem Juden das Bürgerrecht erlangen konnten, auch für diese galt, sofern sie eine Christin heiraten wollten.84
Diese Regelung brachte im 19. Jahrhundert Probleme mit sich, die auch dem Senat bekannt waren, und die verdeutlichten, daß es auch in Hamburg ′Versorgungsprobleme′ für bürgerliche Frauen gab.
Schon 1805 hatte der Senat in einem Beschluß festgestellt, daß zwar arme Fremde, besonders wenn sie mit ihrer Familie in die Stadt gekommen waren und nun das Bürgerrecht gewinnen wollten, abzulehnen, daß aber solche, die in Hamburg eine Bürgerstochter heiraten wollten und dies auch belegen konnten, zuzulassen sind.85
Als der Senat 1833 festlegte, daß fortan alle Fremden, die Bürger werden wollen, eine Kaution von 500 Mk zu hinterlegen hatten, kritisierte Senator Hudtwalcker, daß dies nicht nur die Gefahr in sich berge, daß für die Stadt wichtige Arbeitskräfte vom Erwerb des Bürgerrechts abgehalten würden, sondern zusätzlich hinzukäme
"...daß dadurch für die Bürgerstöchter der unteren Stände das heirathen noch mehr erschwert werden würde, was unter Umständen an Grausamkeit grenze und gewiß die Unsittlichkeit befördern würde."86
Um die wilden Ehen einzugrenzen, hatte Hudtwalcker schon 1831 den Vorschlag gemacht, Bürgerssöhne, sofern ihre Eltern damit einverstanden wären, vor Erreichen der Volljährigkeit zur Ehe zuzulassen und sie erst mit Erreichen der Volljährigkeit aufzufordern, Bürger zu werden, womit er sich aber nicht durchsetzte.87
Daß Senat und Oberalte die Schwierigkeit der Versorgung der Bürgerstöchter ernst nahmen, zeigt der Fall eines Tischlergesellen, der 1845 eine Bürgerstochter heiraten wollte. Gleichzeitig ist diese Angelegenheit Beleg dafür, zu welchen Auswüchsen die verschiedenen Anforderungen des Bürgerrechts führen konnten.
Im April 1845 beantragte der ehemalige Tischlergeselle Christian Friedrich Soltwedel das Bürgerrecht als Arbeitsmann, um die Bürgerstochter Amanda Böttiger heiraten zu können. Da er das Tischlerhandwerk erlernt hatte, wurde er an das Tischleramt verwiesen, weil die Ämter bei Antragstellern ihrer Zunft über die Zulassung zu entscheiden hatten. Das Amt fürchtete zu viele Gesellen in der Stadt und lehnte den Antrag Soltwedels ab, obwohl dieser versicherte, als Arbeitsmann, nicht als Geselle leben zu wollen und bereit war, als Sicherheit beim Tischleramt eine Kaution zu hinterlegen. Daraufhin wandte sich der Geselle mit der Bittschrift an den Senat, ihn zum Bürgerrecht zuzulassen.
Die Oberalten erkannten sein Verhalten als rechtschaffen an und konnten keine Gründe dafür finden,
"daß er nicht ein nützliches Mitglied unser[e]s Staats werden sollte, zumahl er unter den angegebenen Umständen, nur wenn er hier bleibt, eine Bürgers-Tochter, die vielleicht ohne das keine Aussicht auf Versorgung hat, ehelichen und versorgen kann."88
Trotz der Einwände des Tischleramts hielten die Oberalten an dem 1805 beschlossenen Grundsatz fest, daß Fremden, die Bürgerstöchter heiraten wollen, das Bürgerrecht erteilt werden soll, ihnen der Zugang zum Bürgerrecht also gegenüber anderen, die aus beruflichen Gründen kamen und schnell als unsichere Existenzen abgelehnt wurden, erleichtert werden sollte. Dadurch kamen sie aber in Konflikt mit der Auslegung der Verordnung von 1833, wonach die Einführung der Kaution für alle Fremden gerade deshalb beschlossen wurde, um ihnen den Zugang zum Bürgerrecht zu erschweren. Dieser Sachverhalt schließe aus, daß einzelne Fremde bevorzugt behandelt würden.89 Es benötigte über ein Jahr und drei Bittschriften seitens des Antragstellers und seiner Braut, bis er zum Bürgerrecht zugelassen wurde und heiraten konnte.
Zeitgleich mit diesem Fall mußten sich Senat und Oberalte mit einer weiteren Bittschrift eines Gesellen auseinandersetzen, der ebenfalls vom zuständigen Amt abgelehnt wurde, obwohl er nicht auf das Handwerk Bürger werden wollte, sondern um zu heiraten.90 Es ist davon auszugehen, daß das Aufeinandertreffen der Konkurrenzangst der Ämter auf der einen Seite und die Versorgung der Bürgerstöchter auf der anderen keine Ausnahmeerscheinung war, und daß in den Fällen, wo es an Mut fehlte, den Senat um Klärung zu bitten, die Bürgerstöchter unverheiratet blieben, wenn die Ämter die Bräutigame ablehnten.
Wollte sich eine Bürgerstochter in einem anderen Staat verheiraten, so spielte ihr Status keine Rolle, denn durch die Verheiratung ins Ausland verlor sie - gleich den Bürgerssöhnen - die hamburgische Staatsangehörigkeit.
Dies war einer der Verlustgründe, die 1845 erstmals auch für Bürgerstöchter festgehalten wurden.
Bürgerstöchter verloren ebenso wie Bürgerssöhne, Bürger und Bürgerinnen ihren Status, wenn sie formell um Austritt aus dem hamburgischen Nexus baten. Waren sie zu dem Zeitpunkt, zu dem der Vater als Bürger oder die Mutter als Bürgerswitwe um den Austritt aus dem Staatsverband nachsuchte unter 18 Jahren, verloren sie ebenso ihren Status wie Söhne, die zu diesem Zeitpunkt unter 20 Jahren waren.
Trotz der definitiven Regelung für den Erwerb des Bürgerrechts für Frauen in dieser Verordnung, ist in dem Passus über den Statusverlust minderjähriger Kinder bei Austritt von Vater oder Mutter nur die Bürgerswitwe, aber nicht die Bürgerin, die eigenständig das Bürgerrecht erworben hat, berücksichtigt. Es ist anzunehmen, daß Senat und Bürgerschaft hier nur die üblichen anerkannten Konstellationen berücksichtigt haben, was bedeutet, daß selbständige Handelsfrauen, sofern sie keine Witwen waren, unverheiratet waren und damit üblicherweise kinderlos. Verheiratete Frauen hingegen erwarben nicht eigenständig das Bürgerrecht, weil sie durch die Ehe versorgt waren. Hier geben ihnen die Bürgerprotokolle Recht, denn von 401 Frauen, die zwischen 1811 und 1864 das Bürgerrecht erwarben, war keine verheiratet. Die Bürgerprotokolle bestätigen jedoch auch, daß es in diesem Zeitraum 5 geschiedene und 5 ledige Frauen mit Kindern gab, die selbständig das Bürgerrecht erwarben, doch finden sich diese Frauen - bis auf eine Ausnahme 1832 - erst ab 1853.91
Es ist anzunehmen, daß für ihre Kinder das Gleiche galt wie für Bürgers- und Bürgerswitwenkinder. Eindeutig festgelegt wurde dies jedoch nicht, ebensowenig wie die Frage, ob Kinder von geschiedenen oder ledigen Frauen, die selbst das Bürgerrecht erworben hatten, als Bürgerskinder anerkannt wurden.
3.4 Verfahren und Kosten des Erwerbs des Bürgerrechts
Das Bürgerrecht gab Frauen die Möglichkeit, sich durch selbständige Arbeit ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Seit der Bürgerrechtsverordnung von 1845 hatte der Senat wahrgenommen und auch durch die jeweiligen Änderungen des Gesetzes nach außen hin deutlich gemacht, daß es sich beim Bürgerrecht für Frauen nicht nur um Bürgerswitwen handelte.
Gleichzeitig waren die Kosten des Erwerbs des Bürgerrechts eine Barriere für die Antragstellerinnen, denn sie waren im Vergleich zu den Kosten der Schutzverwandtschaft sehr hoch. Kosten und Verfahren der Bürgerrechtsgewinnung verdeutlichen, daß es sich beim Bürgerrecht in Hamburg um eine besondere Form der Staatsangehörigkeit handelte, die nicht inflationär weitergegeben werden sollte.
3.4.1 Vereidigung der Bürgerinnen
Um in Hamburg das Bürgerrecht zu gewinnen, genügte es nicht, den Antrag auf Zulassung beim Weddebüro zu stellen. Bürger oder Bürgerin konnte man erst dann werden, wenn nach erfolgter öffentlicher Bekanntgabe des Namens in einer Hamburger Zeitung eine Einspruchsfrist von vierzehn Tagen verstrichen war, in der eventuelle Bedenken hamburgischer Bürger gegen Zulassung die der Person vorgebracht werden konnten.
War der Antrag gestellt und die Frist der Bekanntmachung verstrichen, ohne daß sich Gründe für die Ablehnung der Antragstellerinnen und Antragsteller ergeben hatten, mußte das Bürgerprotkoll erstellt, das Bürgergeld bezahlt und schließlich der Bürgereid geleistet werden.92 Diesen Eid hatten in Hamburg auch Frauen zu leisten, was nicht in allen Städten, in denen Frauen das Bürgerrecht erwerben konnten, üblich war. Beispielsweise waren Frauen in Bremen zwar seit dem Mittelalter nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet Bürgerin zu werden, den Eid leisteten sie jedoch nicht. Für sie galt der
Bürgereid von Anna Maria Walterstorff, 29.8.1798.StAHbg 111-1 Senat Cl. VII Lit. Bc Nr. 7b Fasc 6b1
als Voraussetzung für die Zulassung zum Bürgerrecht lediglich die Zahlung des Bürgergeldes.93
Das Leisten des Bürgereids von Frauen in Hamburg gehört zu den Rechtsinstituten, die auf Gewohnheitsrecht beruhten und auch im Verlaufe der gesetzlichen Entwicklung des Bürgerrechts im 19. Jahrhundert nicht festgeschrieben wurden. Georg Bueck wies 1828 darauf hin, daß die Einrichtung des Bürgerinneneids sich entgegen der Regelung des Stadtbuchs als Gewohnheit durchgesetzt hatte und es im Grunde einer gesetzlichen Norm dafür bedürfte.94
Auch wenn Frauen mit dem Bürgerrecht keine politischen Rechte erwarben, legte der Hamburger Senat Wert darauf, daß sie den Bürgereid schworen. Sie bekräftigten damit ihre Achtung gegenüber dem bürgerlichen Gemeinwesen, von dem sie durch die Eidleistung ein Teil wurden. Dies veranschaulicht vor allem die Einführung dieses ′Brauchs′ und das Festhalten an ihm, ohne jegliche rechtliche Grundlage. Der Eid war aber auch für die Bürgerinnen nicht nur ein Treueschwur gegenüber dem Staat, sondern ebenso eine Voraussetzung für die Ausübung bestimmter wirtschaftlicher Rechte.
Zu einer generellen gesetzlichen Regelung des Bürgereids für Frauen kam es, wie gesagt, auch im 19. Jahrhundert nicht, doch wurde zumindest für Bürgerswitwen 1845 eine Regelung geschaffen, um vorhandene Rechtsunsicherheiten auszuschalten.
Obwohl Bürgerswitwen seit dem Mittelalter berechtigt waren, die Geschäfte des Mannes fortzusetzen, sie also als Bürgerinnen angesehen wurden, verlangte der Senat 1845 den Bürgereid derjenigen Witwen, deren von den Männern übernommenes Geschäft "...eine Erklärung auf den Eid erforderlich macht, z. B. beim Verzollen".95
Die Tatsache, daß es sich bei dem Eid der Bürgerinnen um ein reines Gewohnheitsrecht handelte, macht es schwer, die Intentionen der Vereidigung von Frauen seitens des Senats genau festzustellen.
Die Bestimmungen über die Vereidigung von Frauen lassen sich jedoch einem anonymen Ratgeber von 1848 entnehmen, der eine Anleitung zum Bürgerrechtserwerb lieferte. Danach wurde die Vereidigung der Neubürgerinnen und -bürger in Hamburg getrennt nach dem Geschlecht vorgenommen und brachte dadurch eine finanzielle Mehrbelastung für die Frauen mit sich:
"Da jedoch Frauenzimmer nicht mit den übrigen Bürgern in der Rathstube, sondern durch einen der Herren Senatssekretäre besonders vereidigt werden, und die desfalligen Gebühren 14 4_ betragen, so hat eine Großbürgers-Wittwe oder Tochter im Ganzen 47 Court. und eine Kleinbürgers-Wittwe oder Tochter 45 zu bezahlen."96
Die zusätzlichen Gebühren entsprachen denjenigen, die anfielen, wenn der Bürgereid getrennt von den üblichen Vereidigungen abgeleistet wurde, weil er in einer fremden Sprache vorgenommen werden mußte.97
Da während der gesamten Bürgerrechtsänderungen im 19. Jahrhundert der Kostenfaktor eine große Rolle gespielt hat und in den 30er Jahren gerade auch in bezug auf das ′Einschleichen′ von Fremden und die wilden Ehen besonders die Schwierigkeiten der unteren Mittelschicht dargestellt wurden, die oftmals nicht in der Lage war, die Kosten für den Erwerb des Bürgerrechts aufzubringen, verwundert diese Gebühr für die, nicht von den Frauen verursachte, Sonderbehandlung.
Der erhöhte Kostenanteil für die Vereidigung der Bürgerinnen spielte bei den Verhandlungen der Bürgerrechtsverordnungen keine Rolle. Es ist deshalb davon auszugehen ist, daß es kein besonderes Interesse gab, Frauen, die nicht Bürgersangehörige, also Bürgerswitwen- oder Töchter waren, den Erwerb des Bürgerrechts zu erleichtern.
3.4.2 Kosten für Bürgerinnen
Abgesehen davon, daß alle Frauen die zusätzliche Gebühr bei Ableistung des Bürgereids tragen mußten, gab es für sie wie für die Männer unterschiedliche Kosten je nach Art des angestrebten Bürgerrechts und des persönlichen Status.
Für fremde Frauen oder Hamburgerinnen, deren Männer oder Väter keine Bürger waren, lagen die Gesamtkosten für das Bürgerrecht am höchsten, denn Bürgerswitwen und Bürgerstöchter wurden genauso behandelt wie Bürgerssöhne, d.h. sie mußten ein geringeres Entgelt für das Bürgerrecht entrichten als Fremde, Heimatberechtigte oder Schutzverwandte. Auch geschiedene Frauen, die im Gesetz nicht ausdrücklich genannt sind und deren Anteil an der Gesamtzahl der Frauen gering war98, wurden, wenn ihr Mann hamburgischer Bürger war, wie Bürgerswitwen und Töchter behandelt. Das größte Kostenproblem stellte sich also für zugewanderte und ledige hamburgische Frauen, deren Väter keine Bürger waren.
Die folgende Tabelle zeigt die Kosten für das Bürgerrecht nach den Verordnungen von 1833 und 1845 inklusive der verschiedenen allgemeinen Gebühren und der Vereidigungsgebühr für Frauen.99 Obwohl, wie gezeigt, Bürgerswitwen vom Erwerb des Kleinbürgerrechts befreit waren, wurden die Kosten auch für sie berücksichtigt, da sie berechtigt waren, daß Bürgerrecht freiwillig zu gewinnen.
Kosten des Erwerbs für Fremde und nicht bürgersangehörige Hamburger | 1833 | 1845 |
Großbürger | 758 Mk 8 Sh | 758 Mk 8 Sh |
Großbürgerinnen | 772 Mk 12 Sh | 772 Mk 12 Sh |
Kleinbürger generell | 46 Mk 8 Sh | - |
Kleinbürgerinnen generell | 60 Mk 12 Sh | - |
Kleinbürger verheiratet oder verheiratet gewesen, mit Kindern hier oder woanders | - | 86 Mk 8 Sh |
Kleinbürgerinnen verheiratet oder verheiratet gewesen, mit Kindern hier oder woanders | - | 100 Mk 12 Sh |
Kleinbürger über 40 Jahre | - | 66 Mk 8 Sh |
Kleinbürgerinnen über 40 Jahre | 80 Mk 12 Sh | |
Kleinbürger unter 40 Jahre | - | 56 Mk 8 Sh |
Kleinbürgerinnen unter 40 Jahre | - | 70 Mk 12 Sh |
Kleinbürger für Großbürgerrecht und Kleinbürgerinnen für Großbürgerinnenrecht | 710 Mk | 670 Mk, 690 Mk oder 700 Mk100 |
| Kosten des Erwerbes für Angehörige Hamburger Bürger | 1833 | 1845 |
Sohn eines Großbürgers für Groß- und Kleinbürgerrecht | 33 Mk 8 Sh | 33 Mk 8 Sh |
Sohn eines Kleinbürgers für Kleinbürgerrecht | 31 Mk 8 Sh | 31 Mk 8 Sh |
Sohn eines Kleinbürgers für Großbürgerrecht | 187 Mk 8 Sh | 187 Mk 8 Sh |
Großbürgerswitwen und -töchter für Groß- und Kleinbürgerinnenrecht | - | 47 Mk 12 Sh |
Kleinbürgerswitwen und -töchter für Kleinbürgerinnenrecht | - | 45 Mk 12 Sh |
Kleinbürgerswitwen und -töchter für Großbürgerinnenrecht | - | 187 Mk 8 Sh |
1845 erfolgte nicht nur eine Anhebung der Kosten für das Kleinbürgerrecht, es wurde gleichzeitig in drei Kategorien unterteilt. Sie belegen am eindringlichsten die Intention von Senat und Bürgerschaft, solchen Menschen den Erwerb des Bürgerrechts zu erschweren, die für die Stadt als Arbeitskräfte nicht effektiv erschienen. Obwohl generell bestrebt, die Niederlassung Fremder in Hamburg zu verringern, war sich der Senat durchaus bewußt, daß ein Stadt wie Hamburg auf Arbeitskräfte aus dem Umland angewiesen war. Dieser Zwiespalt war permanenter Gegenstand der Überlegungen zur Neuordnung des Kleinbürgerrechts101 und führte schließlich zu einer Unterteilung der Kosten, die sich nicht an den Rechten und Pflichten des zu erwerbenden Bürgerrechts ausrichtete, sondern an der persönlichen Situation der Antragsteller.
Ledige unter 40 Jahren galten als wirtschaftlich tragbare Neubürger, weil sie ihre volle Arbeitskraft zur Verfügung stellen konnten. Für sie fiel die Erhöhung des Bürgergeldes um 10 Mk am niedrigsten aus. Wer älter als 40 Jahre war, hatte den Zenit der Arbeitsfähigkeit überschritten. Er wurde von Senat und Bürgerschaft als größeres Risiko angesehen, weil er als Bürger Gefahr lief, sich nicht mehr wirtschaftlich etablieren zu können, und eines Tages der öffentlichen Armenversorgung zur Last zu fallen. Um diesen Personen den Zugang zum Bürgerrecht zu erschweren, wurde das Bürgergeld für über 40jährige um 20 Mk gegenüber 1833 angehoben. Am härtesten traf die Erhöhung jedoch Verheiratete mit Kindern, egal ob sie mit oder ohne Familie nach Hamburg kamen. Sie mußten ab 1845 30 Mk mehr für das kleine Bürgerrecht bezahlen, denn wenn sie der Armenanstalt bedurften, dann mit der ganzen Familie. Das erhöhte Bürgergeld wurde als Entschädigung für den Staat empfunden, wenn er in der Zukunft vermehrt Leistungen durch die Armenversorgung bringen mußte.102
Im Anhang über die Kosten des Bürgerrechts wurden Frauen nicht eigens erwähnt, aber die Unterteilung des Kleinbürgergeldes für Ledige und Verheiratete galt unterschiedslos für Männer und Frauen103, auch wenn Senat und Bürgerschaft innerhalb der Debatte um den Zuzug von Fremden bei der Unterteilung der Kosten des Kleinbürgerrechts 1845 den Zustrom von fremden, armen Männern im Auge gehabt haben werden, die ihre Familien mitbringen oder später nachholen könnten und dann eventuell mit der gesamten Familie auf öffentliche Leistungen angewiesen wären. Die Bürgerprotokolle zeigen die Berechtigung dieser Annahme. Unter den Frauen, die zwischen 1811 und 1864 das Bürgerrecht beantragten, befanden sich keine verheirateten Frauen.104 Die Bürgerrechtsverordnungen schlossen verheiratete Frauen von der Bürgerrechtspflicht nicht entschieden aus. Es ist jedoch vorstellbar, daß es hier wie bei den Witwen üblich war, sie nur im Falle des Großbürgerrechts zum Bürgerrecht heranzuziehen, wenn sie einen selbständigen Großhandel führten. Davon abgesehen, war es bei Verheirateten möglich, daß der Mann das Bürgerrecht gewann und die Frau ein selbständiges Gewerbe führte, das offiziell auf den Namen des Mannes betrieben wurde.105
Aber auch Witwen mit Kindern, die das Bürgerrecht beantragten und keine Bürgerswitwen waren und ledige Frauen älter als 40 Jahre, waren von der Unterteilung des Kleinbürgerrechts in ′Güteklassen′ betroffen.
Die Kosten für Bürgerstöchter und -witwen wurden erst 1845 definiert, doch ergibt sich aus den Akten, daß Bürgerstöchter auch vor der Verordnung von 1845 von der Wedde wie Bürgerssöhne behandelt wurden.106
Nicht überall war es üblich, den Frauen die gleiche oder eine höhere Summe für das Bürgerrecht abzuverlangen wie den Männern. In Bremen beispielsweise war die Gewinnung des Bürgerrechts für Frauen günstiger als für Männer. Ein Umstand, der bei den Verhandlungen zum Hamburger Bürgerrecht 1833 von Hudtwalcker in seinen Ausführungen zur Gestaltung des Bürgerrechts zwar angeführt107, aber nicht weiter verfolgt wurde. Ab 1806 zahlten Frauen in Bremen zwei Drittel der Kosten für das Bürgerrecht und Kinder ein Drittel. 1814, nachdem die Kosten insgesamt gesenkt worden waren, hatten sie die Hälfte des männlichen Bürgergeldes zu bezahlen, doch änderte sich dies 1820 nach einer erneuten Erhöhung des Bürgergeldes wieder und bis 1863 entrichteten sie wieder zwei Drittel der Sätze.108 Diese Sätze galten jedoch nur für uneheliche Bremerinnen oder für zugewanderte Ledige, denn Bürgerstöchter und Bürgerswitwen erbten in Bremen ebenso das Bürgerrecht wie Bürgerssöhne109, eine Einrichtung, die es in Hamburg nicht gab, wenn auch die niedrigen Kosten des Erwerbs für Großbürgerskinder und -witwen fast schon einem Erbe gleichkamen. Die Sonderkosten der Vereidigung für Bürgerinnen, die sich in Hamburg ergaben, konnten in Bremen natürlich nicht anfallen. Eine weitere Bremer Besonderheit bezog sich auf die Dienstboten der Stadt, unter denen hier - wie überall - die Frauen in der Mehrzahl waren. Sie konnten das Bürgerrecht, wenn sie eine bestimmte Anzahl von Jahren (5 Jahre nach 1645, seit dem 18. Jahrhundert 10 Jahre) in einem Haushalt gedient hatten, auf Antrag ihres Arbeitgebers unentgeltich erlangen.110 Da alle Einwohner Bremens Bürger oder Bürgerinnen sein sollten, war das Vererben des Bürgerrechts an in Bremen geborene Kinder und die kostenlose Verleihung an Dienstboten eine logische Konsequenz, wenn Bremen nicht seine Bürgerkinder verlieren wollte und darauf Wert legte, daß genügend Personal für die Bürgerhaushalte einwandern konnte.
Schmitter deutet die niedrigeren Kosten für Frauen in Bremen, die das Bürgerrecht nicht als Bürgersangehörige erbten, sondern es selbständig erwarben, als eine aus dem Mittelalter stammende Konzession an das wirtschaftlich generell schlechter gestellte weibliche Geschlecht, obwohl 1450 gleichzeitig darauf Wert gelegt wurde, daß "Frauen und ledige Dirnen" sich nicht "häuslich niederlassen, und ihr eigenes Gewerbe anfangen" sollten.111
In Hamburg schlug sich die finanziell schlechtere Situation der Frauen nicht generell in den Kosten für das Bürgerrecht nieder, obwohl die Frage der Versorgung zumindest der Bürgerstöchter im 19. Jahrhundert präsent war, wie die Sorge um die Verheiratung der Bürgerstöchter gezeigt hat. Die Probleme lediger auf Versorgung angewiesener Frauen, unabhändig davon ob sie Bürgersangehörige waren, hatten dagegen in den Verhandlungen keine Rolle gespielt. Um die Mitte des Jahrhunderts galt die Ehe immer noch als die Versorgungsinstitution, und der Senat versuchte sie für Bürgerstöchter zu sichern. Eine Sensibilisierung für den weiblichen Arbeitsmarkt gab es nicht, obwohl Hudtwalcker feststellte, daß immer häufiger Frauen das Bürgerrecht erwarben.
Wie hoch die Kosten für das Kleinbürgerrecht für Frauen tatsächlich waren, zeigt ein Vergleich mit den von Antje Kraus zusammengestellten üblichen Löhnen von 1848.112 So verdiente eine Schneiderin bei halber Verköstigung 3 bis 7 Mk in der Woche. Sie lag damit, zusammen mit der Putzmacherin, die ein gleich hohes Einkommen erzielte, an der Einkommensspitze der im allgemeinen von Frauen ausgeübten Berufe. Eine Hutstaffiererin bekam ohne Verköstigung zwischen 4 Mk 8 Sh und 5 Mk 4 Sh während Näherinnen für Industriegeschäfte nur 3 Mk bekamen. Näherinnen für Putzgeschäfte dagegen verdienten bei voller Verpflegung etwa 3 Mk und ein Dienstmädchen ebenfalls bei voller Verköstigung nur zwischen 9 Sh und 1 Mk 7 Sh pro Woche. Rechnet man 3 Mk Kostenersparnis bei voller Verköstigung und dementsprechend 1 Mk 8 Sh für halbe Kost hinzu113, liegt das höchste Einkommen bei 8 Mk 8 Sh für Schneiderinnen und das niedrigste bei 3 Mk und 9 Sh für Dienstmädchen. Die Kleinbürgerinnenkosten betrugen also nach 1845 für alleinstehende Frauen unter 40 Jahren, deren Väter nicht Bürger waren, im günstigsten Fall 9 Wochenlöhne und im Fall der niedrigsten Lohngruppe eines Dienstmädchens 20 Wochenlöhne.
Nach den Berechnungen des Senats lagen die Lebenshaltungskosten für einen alleinstehenden Arbeiter "geringerer Classe" 1848 zwischen 5 und 7 Mk in der Woche.114 Legt man diesen Verbrauch generell für Alleinstehende, die sich selbst versorgen mußten, zugrunde, blieben einer gut verdienenden Schneiderin oder Putzmacherin in der Woche zwischen 1 Mk 8 Sh und 3 Mk 8 Sh für nicht der Grundversorgung entsprechende Ausgaben. Sparten sie dieses Geld vollständig, um die Kosten des Bürgerrechts zu bestreiten, benötigten sie dafür zwischen 21 und 48 Wochen.
Dieser Vergleich ist nur begrenzt zulässig, da das Existenzminimum einer sozialen Gruppe nicht als Existenzminimum einer anderen angesehen werden kann, weil zwischen lebensnotwenigem, standesnotwendigem und standesgemäßem Einkommen unterschieden werden muß. Das heißt konkret: Jede soziale Gruppe stellte unterschiedliche Ansprüche an die Lebenshaltung, die für die entsprechende Gruppe als Existenzminimum zu betrachten sind. Dies wirkte sich beispielsweise auf höhere Mieten und höhere Kosten für Ernährung und Kleidung im Kleinbürgertum gegenüber den Vergleichskosten bei Arbeitern aus.115 Zwar verdienten Schneiderinnen und Putzmacherinnen relativ gleich viel, doch kann ihre unterschiedliche soziale Herkunft aus einer Arbeiterfamilie, aus einer kleinbürgerlichen oder bürgerlichen Familie einen dementsprechend unterschiedlichen Bedarf an Lebenshaltungskosten bewirken, daß sie nicht in der Lage waren, zwischen 1 Mk 8 Sh und 3 Mk 8 Sh zu sparen. So ist es wahrscheinlich, daß Schneiderinnen und Putzmacherinnen, die direkten Kontakt zu ihren Kundinnen aus höheren Kreisen hatten und teilweise auch in deren Häusern arbeiteten, mehr Geld in ihr eigenes Erscheinungsbild investieren mußten als ein Arbeiter. Generell ist zu berücksichtigen, daß ledige Frauen aus kleinbürgerlichen oder bürgerlichen Verhältnissen, die sich ihren Lebensunterhalt verdienen mußten, schon wegen ihrer sozialen Stellung, den gesellschaftlichen Ansprüchen an die Lebensweise ihres Standes und das eigene Selbstverständnis mehr Geld verbrauchten als alleinstehende Arbeiterinnen oder Arbeiter, sofern sie mit dem erzielten Einkommen ihren sozialen Status aufrecht erhalten konnten.
Dienstmädchen, Näherinnen für Putz- oder Industriegeschäfte, Handschuhmacherinnen und Hutstaffiererinnen verdienten weit weniger als Schneiderinnen und Putzmacherinnen und mußten dementsprechend länger sparen, um das Bürgerrecht erwerben zu können - falls Sparen bei ihrem Verdienst überhaupt möglich war.
Aus den Bürgerprotokollen geht nicht hervor, auf welche Weise die Bürgerinnen das Bürgergeld aufbrachten - ob sie es von ihrem eigenen Verdienst gespart oder geerbt hatten, ob sie von der Familie unterstützt wurden oder es liehen - und sie lassen somit auch keinen Einblick in die Besitz- oder Einkommensverhältnisse der Frauen zu. Aber die Art der vorher ausgeübten Berufe, das angestrebte Gewerbe sowie der Familienstand und der Status, den die Antragstellerinnen innerhalb des hamburgischen Nexus hatten (Bürgerstöchter, -witwen, Fremde ohne Staatsangehörigkeit etc.), erlauben doch einen Einblick in die soziale und ökonomische Zusammensetzung der hamburgischen Bürgerinnen im 19. Jahrhundert.
So konnte aus den Bürgerprotokollen werden, wer im 19. Jahrhundert das Bürgerrecht gewann, um festzustellen, inwiefern die gesetzlichen Bestimmungen sich hier wiederfinden und wie sich die Bürgerinnen auf die verschiedenen Gewerbe verteilten. Ebenfalls untersucht werden soll, ob es sich, wie in der Literatur angenommen, überwiegend um Witwen handelte, die die Geschäfte des Mannes weiterführen wollten116, oder ob es zu größeren Teilen ledige Frauen waren. Weiterhin lassen sich Fragen nach der Alterstruktur der Bürgerinnen beantworten und wie hoch der Anteil der Nichthamburgerinnen an den weiblichen Bürgerrechtsanträgen war.
4 Sozio-ökonomische Verteilung der Bürgerinnen bei Erwerb und Aufgabe des Bürgerrechts
Im neunzehnten Jahrhundert veränderte sich die wirtschaftliche Struktur der Städte und mit ihr auch die soziale. Die zunehmende Industrialisierung führte nicht nur dazu, daß sich die Familienstrukturen der arbeitenden Klasse änderten, daß Frauen und Kinder immer stärker auf Lohnarbeit angewiesen waren; sie führte mit zunehmender Bedeutung auch dazu, daß die veränderten Produktionsstrukturen nachhaltig die Lebensweise bürgerlicher Frauen berührten. Was wenige Jahre zuvor von der Hausfrau noch in eigener Handarbeit für den Haushalt hergestellt wurde, wurde jetzt in Manufakturen gefertigt und konnte gekauft werden. So entwickelte sich die ehemalige "Produzentin" zur "Konsumentin".117 Der Anteil der von Frauen zu bewerkstelligenden Tätigkeiten in den einzelnen Haushalten wurde immer geringer und konnte immer weniger Frauen beschäftigen.
Gerade in den bürgerlichen Haushalten jedoch war die Vollzeitbeschäftigung der Hausfrau eine Tugend, Müßiggang eine Schmach. Konnten in den herkömmlichen Haushalten auch die Witwen der Familie oder unverheiratete weibliche Familienangehörige ihr Auskommen finden, indem sie sich an der Organisation des Haushalts beteiligten und so eine Berechtigung auf die Integration in die Familie hatten, so änderte sich dies mit dem voranschreitenden Modell der Kleinfamilie, die sich aus der sozio-ökonomischen Entwicklung des 19. Jahrhunderts ergab. Immer mehr alleinstehende Frauen aus bürgerlichen und kleinbürgerlichen Verhältnissen waren auf Erwerbsarbeit angewiesen. Die steigende Zahl der unverheirateten Frauen, die sich aus dem Frauenüberschuß und einer generell hohen Quote von Unverheirateten in den Städten ergab, trug ihren Teil zu dieser Entwicklung bei.
4.1 Generelle Verhältnismäßigkeiten von weiblichen und männlichen Einwohnern und Bürgern in Hamburg
4.1.1 Anzahl und familiäre Struktur der Einwohner Hamburgs 1866
Die in der Statistik der Deputation für direkte Steuern in Hamburg aus der Volkszählung 1866 - also am Ende des in dieser Arbeit betrachteten Zeitraums - veröffentlichten Zahlen zum Familienstand der Bevölkerung verdeutlichen die o. g. Entwicklung.118 Danach gab es in den acht Steuerdistrikten der Stadt und der Vorstädte 106.556 männliche und 108.337 weibliche Bewohner. Während sich in diesen Zahlen der generelle Frauenüberschuß abzeichnet, wird er in der Unterteilung nach Familienstand in einzelnen Kategorien besonders deutlich. Bei der Untergliederung der Bevölkerung nach Familienstand wurde unterschieden in unverheiratete Männer und Frauen (wobei bei ersteren die über 24jährigen berücksichtigt wurden und bei letzteren die über 16jährigen), verheiratete, verwitwete, geschiedene Personen beiderlei Geschlechts sowie Männer unter 24 und Frauen unter 16 Jahren.
Die Verteilung zeigt bei den Männern folgendes Bild: Bleiben die unter 24jährigen ledigen Männer unberücksichtigt, ergibt sich eine Gesamtzahl von 58.410 männlichen Einwohnern in der Stadt und den Vorstädten. Davon waren 22.932 ledig, was einem Anteil von 39,3% entspricht. Hinzu kommen 2.648 verwitwete und 402 geschiedene Männer, die zusammen 5,2% der männlichen Bevölkerung ausmachten. Insgesamt waren also 44,5% der männlichen erwachsenen Bevölkerung alleinstehend.
Ausgehend von den über 16jährigen Frauen betrug der Anteil der ledigen Frauen mit 35.023 von 78.946 44,4%. Gemeinsam mit 10.723 Witwen und 602 Geschiedenen, die 14,3% der erwachsenen weiblichen Bevölkerung ausmachten, ergibt sich, daß 58,7% der weiblichen Bevölkerung alleinstehend war. Besonders gravierend ist hier die hohe Zahl von 10.723 Witwen. Ihnen standen nur 2.648 Witwer gegenüber.
Die geringe Anzahl von 41,3% verheirateter Frauen ergibt sich nicht zuletzt auch aus der sehr niedrig angesetzten Bemessungsgrundlage von 16 Jahren, weil es als Alter der Heiratsfähigkeit angesehen wurde. Würde diese Barriere höher angesetzt werden, würde sich der Anteil der ledigen Frauen um einige Prozentpunkte verringern, denn während bei den Männern der Anteil der unter 24jährigen, die bei den Berechnungen nicht berücksichtigt wurden, 48.146 Personen umfaßte, waren es bei den Frauen, durch die sehr niedrig angesetzte Altersgrenze nur 29.391. Daß eine Verschiebung des Heiratsalters von Frauen nach oben sinnvoll gewesen wäre, zeigen die Beobachtungen, die Johann Jakob Rambach schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Hamburg machte. Er wies darauf hin, daß das Heiratsalter der Frauen aus den unteren Schichten sehr hoch war. Als Gründe dafür nannte er die Bestrebungen der Frauen, vor der Ehe etwas zu sparen, während die Männer sehr früh heirateten, weil sie auf eine sicherere ökonomische Basis durch die Mitarbeit der Frauen setzten. So war bei den Ehepartnern die Frau oft älter als der Mann.119 Da sich die wirtschaftliche Situation der arbeitenden Klasse im Verlauf der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht verbesserte, ist es wahrscheinlich, daß das tatsächliche Heiratsalter von Frauen über 16 Jahren lag.
Trotz des niedrig angesetzten weiblichen Heiratsalters in der Statistik von 1866 ist indes die Tendenz deutlich erkennbar, daß ein Großteil der Bevölkerung alleinstehend war und sich selbst unterhalten mußte. Unter den Hamburger Frauen war es vor allem der sehr hohe Anteil an Witwen, der die Quote nach oben verschob.120
Zum Vergleich:
1. In Bremen waren 1867 48,55% der Frauen zwischen 16 und 50 Jahren verheiratet121, wobei hier die Quote weiter fallen würde, wenn alle Frauen, auch die über 50järigen berücksichtigt worden wären, denn je höher das Alter der untersuchten Personen ist, desto größer wird der Anteil der Witwen unter ihnen.
2. Von 1.000 Frauen über 20 Jahren waren 1867 in Berlin 530 verheiratet. Die Einbeziehung der 16-20jährigen hätte auch hier die Quote der Verheirateten unter 50% gedrückt. In ganz Preußen waren 1863 50,3% aller Frauen über 14 Jahre verheiratet.122
Die Zahlen belegen, daß es insgesamt in Deutschland eine große Zahl von Frauen gegeben hat, die sich auf andere Weise als über die Ehe versorgen mußten. Die Hamburger Statistik führt dabei unter den genannten Städten und Staaten die niedrigste Zahl von verheirateten Frauen an. Selbst wenn angenommen wird, daß ein Teil der Witwen aus bürgerlichen Haushalten durch die Hinterlassenschaften ihrer Männer versorgt war und auch einige ledige Frauen von Erbschaften lebten oder von der Familie durchgebracht wurden, bleiben immer noch viele Frauen übrig, die sich selbst ernähren mußten.
Angesichts dieser generellen Entwicklung stellt sich die Frage, welchen Anteil Frauen am Bürgerrecht hatten, denn die Zahlen für Hamburg lassen vermuten, daß es nicht nur ein Interesse von Großbürgerswitwen, die die Geschäfte der Männer weiterführen wollten, an der Erlangung des Bürgerrechts gegeben hat, sondern auch von Ledigen, vor allem in einer rapide wachsenden Stadt wie Hamburg.
Die gesamte Bevölkerung Hamburgs inklusive der Vorstädte St. Pauli und St. Georg wuchs zwischen 1811 und 1863 von 107.000 auf 206.500 Einwohner123; eine Zunahme um 93 %. Zahlen für den Anteil der Bürger an der städtischen Bevölkerung in diesem Zeitraum gibt es nicht, doch machten die Bürger 1848 rund 30% der erwachsenen Bevölkerung der Stadt und der Vorstädte aus.124 Anhand der Anzahl der Bürgerprotokolle soll im folgenden aufgezeigt werden, ob die Zahl der Bürgeranträge sich parallel zur Einwohnerentwicklung in Hamburg bewegte, welchen Anteil die Frauen unter den Bürgern hatten und wie sie sich quantitativ im betrachteten Zeitraum entwickelten.
4.1.2 Quantitative Verteilung der männlichen Bürgeranträge zwischen 1811 und 1864
Die folgende Graphik (Bild 1) zeigt die Anzahl der männlichen Bürgeranträge von Januar 1811 bis November 1864125 wie sie sich aus den Bürgerprotokollen dieses Zeitraums ergaben. Gemessen an der Anzahl der gesamten Anträge war die Zahl der Frauen sehr gering.126 So kann die graphische Darstellung der Anträge von Männern gleichzeitig für die generelle Entwicklung der Zahl der Bürgeranträge im Verhältnis zu der Bevölkerungsentwicklung herangezogen werden, da die geringe Frauenquote die Gesamttendenz nicht beeinflußt.
N
Bild 1:Quantitative Entwicklung der männlichen Bürgeranträge von 1811 bis 1864
Die Graphik in Bild 1 zeigt über den gesamten Zeitraum einen kontinuierlichen Anstieg der männlichen Bürgeranträge pro Jahr, wobei es in einzelnen Jahren zu herausragenden Spitzenwerten kam und in anderen zu Einbrüchen der Bürgerantragszahlen. Beide Formen der Abweichung lassen sich aus der besonderen Situation der jeweiligen Jahre erklären.
1813 gab es zunächst einen Einbruch bei den Bürgeranträgen auf weniger als 200, der sich aber in den folgenden Jahren durch die um so höheren Bürgerantragszahlen ausglich, bis 1816 ein Stand von 1.107 Anträgen (1.106 Männer und 1 Frau) erreicht war. Diese Entwicklung läßt sich im Zusammenhang mit dem Ende der französischen Besatzung erklären. Wie in Kapitel eins beschrieben, war das Bürgerrecht zu dieser Zeit die einzige Form des städtischen Nexus. Der starke Rückgang der Bürgeranträge 1813 ist einerseits auf die unsichere wirtschaftliche Situation Hamburgs während der sogenannten Franzosenzeit zurückzuführen, sie läßt speziell 1813 aber auch auf eine Rechtsunsicherheit seitens der Einwohner Hamburgs schließen, die sich aus dem Abzug der Franzosen ergab: Die französischen Truppen verließen Hamburg am 12. März 1813. Am 31. März erklärte der Hamburger Senat alle französischen Gesetzbücher und Verfügungen für aufgehoben und setzte das vor 1811 geltende Hamburger Recht wieder ein. Nach außen hin gab es jedoch keine eindeutigen Anzeichen dafür, daß in Hamburg wieder unmißverständliche verfassungsrechtliche und politische Verhältnisse herrschten. Der Senat verzögerte Entscheidungen, weil er vermutlich damit rechnete, daß die französischen Truppen zurückkämen. Dementsprechend nahm er bezüglich seiner politischen Intentionen weder gegenüber den Franzosen eindeutig Stellung noch gegenüber dem sich in der Stadt befindenden russischen General Tettenborn, der die Absetzung der französischen Verwaltung und die Wiedereinsetzung des Hamburger Senats nach Abzug der französischen Truppen forciert hatte. Am 31. Mai 1813 kehrten die französischen Truppen zurück und besetzten Hamburg ein weiteres Mal, diesmal für 12 Monate. Erst im Mai 1814 wurde die Souveränität Hamburgs wiederhergestellt. Senat und Bürgerschaft setzten die französischen Verordnungen abermals außer Kraft und erklärten die "Vier Hauptgrundgesetze der Hamburgischen Verfassung" der Jahre 1710 und 1712 zur erneut gültigen Hamburger Verfassung.127
Von 1814 bis 1816 wurde entsprechend zur sich stabilisierenden Situation in Hamburg das Bürgerrecht verstärkt nachgefragt, die Zahl der Anträge ging dann 1817 auf das Normalmaß zurück und steigerte sich in den folgenden Jahren stetig bis auf 1041 Anträge 1828. 1829 kam es zu einem weiteren einmaligen steilen Anstieg auf 1.530 Bürgeranträge (1.527 Männer und drei Frauen), für den keine eindeutige Ursache erkennbar ist, der sich jedoch im folgenden Jahr wieder relativierte.
Eine weitere überdurchschnittliche Zunahme der Anträge über einen längeren Zeitraum erfolgte 1832 bis 1834. Hamburg befand sich in den 30er Jahren konjunkturell in einer guten Verfassung, was sich aber nicht in einem übermäßigen Bevölkerungswachstum durch Zuwanderung niederschlug. Allerdings weist Matti für die Jahre 1832-1834 auf einen Anstieg der Eheschließungen hin. Von 7,5 geschlossenen Ehen pro 1.000 Einwohner 1831 stiegen die Eheschließungen auf 8,0 1832, über 10,5 1833 bis auf 11,1 1834 an. Im gleichen Zeitraum verstärkten sich auch die Geburtenziffern. 1835 fiel die Zahl der Bürgeranträge rapide ab von 1.680 1834 auf 749 1835 und auch die Heiratsrate ging auf 8,7 von 1000 Einwohnern zurück.128 Die überdurchschnittliche Zunahme der Bürgeranträge in der ersten Hälfte der dreißiger Jahre ist also weniger auf die Zuwanderung von Außen zurückzuführen als auf die Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage der Einwohner Hamburgs, die die Bereitschaft zur Eheschließung förderte und dementsprechend auch die Bürgeranträge. Dies bedeutet aber nicht, daß es sich bei den zusätzlichen Bürgeranträgen kaum um Fremde gehandelt hat, es besagt nur, daß es sich nicht überwiegend um neue Fremde gehandelt haben kann, sondern lediglich um solche, die schon seit längerer Zeit in Hamburg lebten, ohne bisher in den Nexus der Stadt eingetreten zu sein. Ein Problem, daß bei den Verhandlungen zur Bürgerrechtsverordnung 1833 im Zusammenhang mit der Verringerung der wilden Ehen eine erhebliche Rolle gespielt hatte.129 Zu der besonders hohen Anzahl der Bürgeranträge 1834 hat vermutlich auch die Bürgerrechtsverordnung von 1833, die am 30.3.1834 inkrafttrat, beigetragen, weil sie zum ersten Mal definierte, wer verpflichtet war, das Bürgerrecht zu erwerben.
Ein ähnliches Phänomen wie zu Beginn der 30er Jahre läßt sich auch für die Jahre 1843-1845 erkennen. Auch hier ist der Zuwachs der Bürgeranträge auf die wirtschaftliche Situation zurückzuführen, die sich jedoch anders auf die Bürgerzusammensetzung auswirkte als in den 30er Jahren. Auslöser war der große Brand vom Mai 1842, der rund ein Viertel der hamburgischen Innenstadt zerstörte. Er hatte zunächst zur Folge, daß viele Familien die Stadt verließen. Diese Entwicklung wurde jedoch dadurch aufgefangen, daß in der folgenden Zeit sehr viele Handwerker von außerhalb nach Hamburg kamen. Der Wiederaufbau versprach gerade für sie Beschäftigung und ein gutes Auskommen. Viele der Handwerker ließen sich dauerhaft in Hamburg nieder und erwarben das Bürgerrecht aus beruflichen Gründen, aber auch weil sie hier heiraten wollten.130 1844 erreichte die Zahl der Bürgeranträge mit 1.729 (1.712 Männer und 17 Frauen) ihren vorläufigen Höhepunkt. Nachdem der Boom von Bürgeranträgen in Folge des Brandes 1844 seinen Höchststand erreicht hatte, gab es in den folgenden drei Jahren einen Rückgang der Zahl der Bürgeranträge pro Jahr, bis 1848 ein Tiefstand von 1.041 Anträgen (1.026 Männer und 15 Frauen) erreicht war.
Die Entwicklung der 30er und 40er Jahre zeigt, daß die Initiativen zu einer Reform des Bürgerrechts mit außerordentlichen Zunahmen der Bürgeranträge in diesen Perioden einhergingen.
Bis 1864 gab es keine weiteren Reformen des Bürgerrechts, doch setzten die Diskussionen um eine erneute Reform schon 1856 ein131, zu einem Zeitpunkt, an dem es abermals zu einem stärkeren Bevölkerungswachstum durch Zuwanderung in den Jahren 1855-1857 gekommen war. Dieser Trend wurde jedoch durch die Wirtschaftskrise Ende 1857 gestoppt. 1857 hatte die Zunahme der Bevölkerung bei 4.000 Personen gelegen, 1858 waren es nur noch 2.200.132
Die Zahl der Bürgeranträge stieg ab 1850 - mit Ausnahme kleinerer Schwankungen 1853 und 1855 - stetig an und erreichte durch einen Schub 1856 und 1857, der mit der Zunahme der Bevölkerung konform ging, 1857 die Zahl von 1.928 Anträgen (1.910 Männer und 18 Frauen). In den Jahren von 1860 bis 1863 stabilisierte sich die Zahl der gesamten Bürgeranträge im Bereich zwischen 1.680 und 1.690 Anträgen. Die Ausweitung des politischen Bürgerrechts 1859 auf alle männlichen, steuerzahlenden Bürger über 25 Jahre133 hatte sich nicht in einer weiteren Steigerung der Bürgerzahlen niedergeschlagen.
Insgesamt läßt sich an der Graphik in Bild 1 erkennen, daß die Zahl der Bürgeranträge zwischen 1811 und 1864, abgesehen von den genannten großen Schwankungen relativ gleichmäßig anstiegen. Der Vergleich mit den von Matti genannten Bevölkerungszahlen von 1811 und 1863 zeigt jedoch, daß die Bürgeranträge stärker zunahmen als die Bevölkerung. Während sich letztere in diesem Zeitraum nahezu verdoppelte, kam es fast zu einer Verdreifachung der jährlichen Bürgeranträge in dieser Zeit, wenn man einen mittleren Wert von ca. 600 Bürgeranträgen zwischen 1811 und 1820 und 1.700 zwischen 1856 und 1864 zugrundelegt.
4.1.3 Quantitative Verteilung der weiblichen Bürgeranträge zwischen 1811 und 1864
Wie sah nun aber die quantitative Entwicklung der weiblichen Bürgeranträge aus? Wie schon erwähnt, handelte es sich bei den Bürgeranträgen, die von Frauen gestellt wurden, nur um einen Bruchteil der gesamten Bürgeranträge. Dies ist jedoch kein Spezifikum des 19. Jahrhunderts.
Auch im Mittelalter war der Anteil der Frauen am Bürgerrecht sehr gering, obwohl sich den Frauen völlig neue wirtschaftliche Tätigkeitsfelder eröffneten. Aus den Eintragungen in den Listen der Neubürger im mittelalterlichen Köln ergab sich beispielsweise, daß zwischen 1356 und 1399 ca. 3% der Neuaufnahmen auf Bürgerinnen entfielen. Im 15. Jahrhundert, daß zugleich den Höhepunkt der Frauenerwerbstätigkeit in Köln darstellte, lag der Anteil bei 0,8% der Neuaufnahmen und im 16. Jahrhundert nur noch bei 0,2%. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts stieg der Anteil der Neubürgerinnen unter den Neuaufnahmen auf 5,7% wobei jedoch 21,7% zusammen mit ihren Ehemännern das Bürgerrecht erwarben134, eine Konstellation, die in Hamburg nicht üblich war.
In Lübeck waren zwischen 1317 und 1355 7.401 Personen zum Bürgerrecht angenommen worden, unter denen sich 100 Frauen befanden.135 Der Wert entspricht mit 1,4% Bürgerinnen unter den Bürgern ungefähr den Werten der Stadt Köln.
Laurent stellte 1841 in seiner Auswertung des ältesten bekannten Bürgerbuchs in Hamburg, das die Bürgerannahmen von 1277 bis 1452 verzeichnete, fest, daß auch Bürgerinnen vorkamen. Er nennt für diesen Zeitraum lediglich 3 Frauen, bei durchschnittlich 70 Neubürgern pro Jahr, ohne anzugeben, ob es sich dabei um alle in dem Buch vorhandenen Frauen handelte.136 Obwohl teilweise in dem Bürgerbuch die Berufe der Bürger vermerkt waren, hat Laurent sie nicht einzelnen Namen zugeordnet, so daß anhand seiner Auswertung nicht festgestellt werden kann, ob das Bürgerrecht für Frauen sich nur auf Kauffrauen erstreckte oder auch auf Angehörige anderer Berufe.
Einen Hinweis auf den Anteil von Frauen an den Gewerbetreibenden in Hamburg im Mittelalter fand Loose in den hamburgischen Kämmereirechnungen von 1350 bis 1400 Für diesen Zeitraum waren von 1288 vermerkten Gewerbetreibenden 76 Frauen, was einem Anteil von 5,9% entspricht. Diese Frauen waren zu über 90% in der Gänsehökerei und Weberei beschäftigt.137 Auskunft darüber, ob und wieviele von ihnen Bürgerin auf ihr Gewerbe waren, geben diese Zahlen jedoch nicht. So gibt es in Hamburg für das Mittelalter nur bruchstückhafte Erkenntnisse, die aussagen, daß Frauen Bürgerinnen wurden, und daß sie erwerbstätig waren.
N
Bild 2: Quantitative Entwicklung der weiblichen Bürgeranträge zwischen 1811 und 1864
Die Graphik in Bild 2 veranschaulicht die Entwicklung der weiblichen Bürgeranträge in Hamburg im 19. Jahrhundert.
Insgesamt zeigt der Verlauf der Kurve ein wesentlich uneinheitlicheres Bild als bei den Männern im gleichen Zeitraum. Da die Zahl der Anträge der Frauen jedoch sehr niedrig ist, wirken sich zufällige Schwankungen bei ihnen viel stärker aus als in der Gesamtentwicklung und können hier nicht berücksichtigt werden. Abgesehen davon gibt es jedoch auch hier wie bei der Entwicklung der männlichen Bürgerantragszahlen einige Jahre, in denen die Zahlen stark von der generellen Entwicklung abweichen. Sie sollen hier zunächst untersucht und mit denen der Männer verglichen werden.
Die erste Auffälligkeit zeigt sich 1834. In den beiden Jahrzehnten zuvor lag die Zahl der Antragstellerinnen zwischen 0 und 5 Frauen jährlich, wobei es 10 Jahre gab, in denen keine Frau das Bürgerrecht beantragte. 1834 waren es plötzlich 14 Frauen. Auch bei den Männern hatte es 1834 ein Hoch der Antragstellungen gegeben, daß sich zum einen durch die gute konjunkturelle Lage Hamburgs in dieser Zeit begründen ließ und zum anderen durch das Inkrafttreten der Bürgerrechtsverordnung von 1833. Aus den Bürgerprotokollen der Antragstellerinnen für 1834 ergibt sich ein eindeutiges Bild. Von den 14 Frauen, die 1834 das Bürgerrecht beantragten, waren 3 ledig und 11 Witwen. Von diesen 11 Witwen wollte eine als Fruchthändlerin erwerbstätig sein und eine als Modehändlerin. 9 Witwen gaben auf die Frage, auf welches Gewerbe sie Bürgerin werden wollen, lediglich "Inhaberin einer Handlung" an. Eine dieser Frauen beantragte am 3. April 1834 das Bürgerrecht und vier am 16. April, gut zwei Wochen nach Inkrafttreten der neuen Bürgerrechtsverordnung, was eine sehr hohe Häufung bei der insgesamt geringen Zahl von Frauen ist. Alles in allem weisen diese Einzelheiten darauf hin, daß die Bürgerrechtsverordnung von 1833, in der ausdrücklich erwähnt wurde, daß auch Frauen, die Handel treiben, verpflichtet sind, das Bürgerrecht zu gewinnen, bei den Witwen auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Diese Annahme wird unterstützt durch die Eintragungen im "Hamburgischen Adressbuch" von 1835: Bei 8 der 9 Witwen, die im Protokoll angegeben hatten, Inhaberin einer Handlung zu sein, findet sich ein Eintrag der Witwe in Verbindung mit dem Geschäft ihres verstorbenen Mannes. In allen 8 Fällen lief die Firma unter dem Namen der Witwe weiter und es war auch ein Bankkonto auf ihren Namen eingetragen.138 Es handelte sich bei diesen Frauen also um Großbürgerswitwen, die die Geschäfte ihrer Männer weiterführten. Lediglich eine der Witwen ließ sich im Adreßbuch nur unter der von ihr angegebenen Wohnung nachweisen, aber nicht unter ihrem Namen oder dem ihres Mannes und konnte deshalb keinem Status zugeordnet werden.139 Daß der hohe Witwenanteil nicht die übliche Verteilung unter den Neubürgerinnen ist, zeigt das nächste Kapitel. An dieser Stelle kann zunächst einmal festgehalten werden, daß sich der Anstieg der Antragstellerinnen 1834 nicht auf die positive wirtschaftliche Situation in Hamburg zu Beginn der 30er Jahre zurückführen läßt, denn bei den oben genannten Witwen handelt es sich nicht um selbständige Geschäftsgründungen. Eine Erklärung bietet nur die Aufnahme der Handelsfrauen als bürgerrechtspflichtige Personen in die Bürgerrechtsverordnung von 1833.
Eine weitere deutliche Schwankung der Antragszahlen läßt sich für die Jahre 1842 bis 1844 feststellen. Seit Beginn der 30er Jahre gab es die generelle Tendenz, daß sich die Zahl der Bürgerinnen erhöhte. 1831 war das letzte Jahr, in dem es gar keinen Bürgerantrag einer Frau gab, danach stieg die Zahl der Antragstellungen langsam an. Nachdem in den Jahren 1840 und 1841 mehr als 10 Frauen jährlich das Bürgerrecht beanspruchten, ging die Zahl 1842 auf 5 Frauen zurück, kletterte 1843 wieder auf 12 und im folgenden Jahr auf 17 Frauen, um dann 1845 noch einmal auf 7 Antragstellungen zurückzufallen. Bei der geringen absoluten Zahl der Anträge kann es sich hier um ein zufälliges Phänomen handeln. Da jedoch diese Schwankungen in die Zeit des großen Brandes fallen, der auch die Zahl der männlichen Antragstellungen beeinflußt hatte, lohnt ein Blick auf die Verteilung der Antragstellungen der Jahre 1842 und 1843.
Vor dem großen Brand gab es 3 Bürgerinnenanträge im Februar. Der nächste Antrag findet sich erst wieder im September 1842 und der letzte der 5 Anträge im Oktober. 1843 gab es insgesamt 12 Gesuche von Frauen zur Erlangung des Bürgerrechts. Davon fielen 2 in die Monate Januar und Februar, der Rest verteilte sich auf die Monate Mai bis Oktober 1843. In dem Zeitraum von Mai 1842 bis April 1843 wurden nur 4 Frauen Bürgerinnen, während im folgenden Jahr bis Mai 1844 21 Frauen das Bürgerrecht beantragten. Aus der in den Protokollen angegebenen Aufenthaltsdauer der Frauen in Hamburg vor Beantragung des Bürgerrechts - sofern sie nicht in Hamburg geboren waren - läßt sich nicht erkennen, daß 1843 und 1844 viele Frauen nach Hamburg kamen, um sich hier selbständig zu machen. Nur drei der 21 Frauen, die von Mai 1843 bis Mai 1844 das Bürgerrecht beantragten, waren nach dem großen Brand nach Hamburg gekommen. Eine dieser Frauen war eine Witwe, die zwar in Göttingen geboren, aber in St. Petersburg verheiratet war. Sie gab an, in St. Petersburg Lack- und Firnißfabrikantin gewesen zu sein, und wollte dieses Geschäft auch in Hamburg ausüben. Im Adreßbuch von 1845 läßt sie sich jedoch nicht nachweisen. Eine weitere Antragstellerin war eine 26jährige ledige Frau aus Friedrichstadt, die nach dem Tod ihrer Eltern nach Hamburg gekommen war, um hier eine holländische Warenhandlung zu eröffnen. Die dritte der Antragstellerinnen, die erst nach dem Brand nach Hamburg kam, tat dies nicht, um einen Handel zu betreiben, sondern um Grundbesitz in der Stadt anzutreten und als Partikulierin zu leben. Eine Entsprechung zu der verstärkten Zunahme von Bürgern im Zuge des Wiederaufbaus und den sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Chancen für Zuwanderer läßt sich bei den Bürgerinnen nicht nachweisen. Wahrscheinlicher ist es, daß sich die Absichten einzelner Frauen, das Bürgerrecht zu beantragen, durch den Brand zeitlich verschoben haben und es so zu einer Verringerung der Anträge 1842 und zu der entsprechenden Erhöhung in den folgenden Jahren kam.
Nach 1846 bis 1863 lag die Zahl der Antragstellungen zwischen 11 und 18 pro Jahr. 1855 erreichte sie mit 21 Anträgen ihren Höhepunkt. Möglich wäre auch hier, wie bei den Männern, ein Zusammenhang mit der guten Konjunktur Hamburgs in dieser Zeit, doch läßt sich dies nicht durch andere Hinweise bekräftigen.
1864 beantragten nur noch 7 Frauen das Bürgerrecht. Zu diesem Zeitpunkt waren die Debatten zur Änderung des Bürgerrechts, die in den Zeitungen der Stadt wiedergegeben wurden, schon abgeschlossen und die Aufhebung des weiblichen Bürgerrechts dürfte allgemein bekannt gewesen sein. In Anbetracht der Kosten des Bürgerrechts und der Tatsache, daß viele der Frauen erwerbstätig waren bevor sie das Bürgerrecht beantragten140, verwundert es, daß sie die Bürgerrechtskosten für den nur noch ein paar Monate relevanten Bürgerinnenstatus noch auf sich genommen haben.
Die abschließende Beurteilung des gesamten Verlaufs der Kurve zeigt deutliche Unterschiede zu der der Männer. Während es bei den Männern ein beständiges Wachstum über den gesamten Zeitraum gab, beginnt bei den Frauen die Zunahme erst in den dreißiger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts. Von da an steigen die Zahlen jedoch deutlich an. Während von 1811 bis 1830 jährlich durchschnittlich 1,2 Frauen das Bürgerrecht beantragten (= 0,14% der gesamten Bürgeranträge in diesem Zeitraum), waren es von 1831 bis 1850 9 Frauen jährlich (= 0,73%) und von 1851 bis 1863 14,7 (= 0,9%).
Auch wenn die Zahl der Bürgerinnen gemessen an der Gesamtzahl der hamburgischen Einwohnerinnen äußerst gering war, so veranschaulichen diese Zahlen doch, daß das Bürgerrecht im Verlaufe des zweiten Drittels des 19. Jahrhunderts für die Frauen an Bedeutung gewann.
Obwohl es Zahlen zum Anteil von Frauen am Bürgerrecht in Bremen gibt, ist ein direkter Vergleich mit der Schwesterstadt nicht möglich, weil dort das Bürgerrecht anders ausgerichtet war. Die Unterscheidung in kleines und großes Bürgerrecht in Bremen entsprach gleichzeitig der Unterscheidung in das Bürgerrecht ohne Handelsfreiheit und mit Handelsfreiheit. Marschalck führt zur Verteilung des Bürgerrechts in Bremen an, daß über 90% der Bürgerrannahmen zwischen 1840 und 1862 auf das kleine Bürgerrecht entfielen und knapp 10% auf das große. Dabei waren etwa 45% der Inhaber des großen Bürgerrechts Frauen, unter den, die das kleine Bürgerrecht erwarben, betrug ihr Anteil ungefähr 50%.141 In Bremen war die Zahl der Bürgerrechtsinhaberinnen also wesentlich höher als in Hamburg. Dies liegt aber nicht daran, daß Frauen in Bremen erheblich mehr Anteil am selbständigen Erwerbsleben hatten als in Hamburg, sondern an einer Besonderheit des bremischen Bürgerrechts. Den größten Teil der ledigen Bürgerinnen in Bremen stellten die Bräute von bremischen Bürgerssöhnen, denn in Bremen war es üblich, daß bei einer Heirat für beide Eheleute nach der Hochzeit der niedere Staatsangehörigkeitsstatus zählte. D. h., daß ein Großbürgerssohn, der eine Bürgerstochter heiratete, darauf Wert legte, daß diese noch vor der Hochzeit das Bürgerrecht beantragte, damit der Großbürgerssohn nicht zum ′Kleinbürger′ wurde. Ein Bürgerssohn, der eine Nichtbürgerin heiratete, wäre dementsprechend, wenn sie anläßlich der Hochzeit nicht das Bürgerrecht erwarb, heimatlos geworden.142 Aus diesem Grund ist die Zahl der Bürgerinnen in beiden Kategorien nicht viel geringer als die der Männer. Sie läßt aber nicht die geringste Aussage zum Bürgerrecht als Grundlage der beruflichen Tätigkeit von Bremer Frauen zu.
Die Analyse der Herkunft, des Familienstands und der Altersstruktur der Hamburger Bürgerinnen kann weiteren Aufschluß darüber geben, welche Frauen das Bürgerrecht in Anspruch nahmen. Hierbei ist jedoch zu beachten, daß nicht in allen Analysen die gesamten 401 Frauen berücksichtigt werden konnten, da die Angaben in den Bürgerprotokollen zu den einzelnen Fragen nicht immer vollständig waren.
4.2 Die soziale Struktur der Bürgerinnen
4.2.1 Familienstand und Herkunft
Wie schon erwähnt, ist es eine in der Literatur weit verbreitete These, daß es sich bei den Frauen, die in Hamburg selbständig das Bürgerrecht erwarben, zum größten Teil um Bürgerswitwen handelte, die die Geschäfte ihrer verstorbenen Männer weiterführten. Diese Annahme korrespondiert mit der sehr hohen Zahl von Witwen unter den alleinstehenden Hamburgerinnen nach der Volkszählung von 1866. Die Auswertung der Bürgerprotokolle hingegen ergibt ein ganz anderes Bild.
N
Bild 3: Verteilung der Bürgerinnen nach dem Familienstand
Die Gesamtverteilung (Bild 3) zeigt, daß der Anteil der ledigen Frauen unter den Bürgerinnen deutlich höher war als der der Witwen und Geschiedenen. Mit 210 von 387 Frauen, die Angaben zum Familienstand machten, stellten die Ledigen 54,3% der Bürgerinnen, die Witwen machten mit 166 Frauen 42,9% aus und die 11 geschiedenen Frauen 2,8%. Dies Ergebnis ist zunächst überraschend und kann genauer untersucht werden, indem es mit der Herkunft der Bürgerinnen verglichen wird.
Da die Zuwanderung von Fremden die gesamte Bürgerrechtsdiskussion des 19. Jahrhunderts beherrschte, ist es interessant zu sehen, woher die Frauen kamen, die in Hamburg das Bürgerrecht erwarben. Die allgemeine Auswertung der Daten (Bild 4) ergibt, daß ein Großteil der Frauen Fremde waren. Für die Berechnung zugrundegelegt wurde die Gebietsverteilung Hamburgs, wie sie seit 1830 vorgenommen wurde. Unterteilt wurde in der Untersuchung der Herkunft in Stadt, Vorstadt (St. Pauli und St. Georg), Landgebiete (32 Vogteien der Geest- und Marschlande, die unter Hamburgs Verwaltung standen)143 und Fremde. Als eigentlich hamburgischer Herkunft können nur die in der Stadt und den Vorstädten geborenen angesehen werden, die Unterteilung der Fremden in diejenigen aus den Landgebieten und andere verdeutlicht jedoch das Einzugsgebiet der Stadt. Das von Lübeck und Hamburg gemeinsam verwaltete Gebiet Bergedorf und das Amt Ritzebüttel wurden als fremd angesehen.
137 Frauen gaben in den Protokollen als Geburtsort Hamburg an und 13 Frauen die Vorstädte. Zusammen machten sie 37,4% der Antragstellerinnen aus. Ihnen gegenüber standen 10 Frauen, die aus den Landgebieten stammten und 241 Frauen, die als Fremde zugezogen waren, zusammen 62,6%. Erstaunlich ist dabei die geringe Zahl derjenigen Frauen, die aus dem städtischen Umland, also den Geest- und Marschlanden, in die Stadt gezogen waren. Sie umfaßten nur 2,5% der Bürgerinnen.
Die Verteilung der Frauen nach ihrem Geburtsort schließt jedoch auch die Frauen ein, die nach Hamburg kamen, um hier zu heiraten, und erst als Witwe selbständig das Bürgerrecht erwarben und gibt deshalb noch keine Auskunft darüber, inwiefern Frauen nach Hamburg kamen, um in der Stadt zu arbeiten. Dies ermöglicht die Unterteilung der Frauen nach Herkunft und Familienstand in Bild 4 .
N
Bild 4: Verteilung der Bürgerinnen nach Herkunft und Familienstand
Unterteilt wurde die Graphik in Ledige, Witwen und Sonstige, um alle Daten verwenden zu können und sichtbar zu machen. Die 11 geschiedenen Frauen wurden dabei unter Sonstige eingeordnet, da ihre geringe Anzahl keine Prognosen zuließ.
Die Verteilung zeigt deutlich, daß fremde ledige Frauen, die nach Hamburg kamen, mit 150 den höchsten Anteil an den Bürgeranträgen stellten. Zusammen mit den 5 ledigen Frauen, die aus dem Landgebiet stammten, machten sie einen Anteil von 73,8% der gesamten ledigen Bürgerinnen und von 64, 3% der gesamten fremden Bürgerinnen aus.
Bei den hamburgstämmigen Frauen, einschließlich derer aus den Vorstädten, ist die Verteilung anders. Von 137 hamburgischen Frauen waren lediglich 45 unverheiratet. Dazu beantragten 10 von 13 Frauen aus den Vorstädten das Bürgerrecht als Ledige. Die ledigen Hamburgerinnen stellten somit 26,2% der gesamten ledigen Bürgerinnen und nur 36,6% der Bürgerinnen, die in der Stadt oder den Vorstädten geboren waren. Unter den 55 ledigen Bürgerinnen aus der Stadt und den Vorstädten waren 26 Bürgerstöchter und 4 Schutzbürgerstöchter.
Die Gesamtverteilung von Bürgerinnen nach Familienstand widerspricht der These grundlegend, daß es sich bei Bürgerinnen ganz überwiegend um Witwen handelt: Nur für die hamburgstämmigen Bürgerinnen muß festgehalten werden, daß hier zwar gut ein Drittel der Bürgerinnen ledig waren, die Mehrheit jedoch von den Witwen gestellt wurde.
Neben den 55 ledigen Frauen aus Hamburg und den Vorstädten, gab es sechs geschiedene Frauen aus Hamburg und fünf, die keine Angabe zum Familienstand machten. Es bleiben 84 Witwen (81 aus Hamburg und drei aus den Vorstädten), die 56% der hamburgstämmigen Bürgerinnen ausmachten. 96 der gesamten 166 Witwen waren Bürgerswitwen, 6 Schutzbürgerswitwen und 5 gaben an, Bürgerstöchter zu sein.144
Zusammengefaßt ergibt sich, daß zwei Drittel der Bürgerinnen zugewanderte Frauen waren, von denen wiederum 61,6% ledig waren. Demgegenüber standen ca. ein Drittel Bürgerinnen, die in Hamburg oder den Vorstädten geboren wurden, wobei hier der größte Teil Witwen waren. Das Bürgerrecht wurde von Hamburgerinnen tatsächlich überwiegend genutzt, wenn sie Witwen waren. Bei den Zugewanderten ist das Verhältnis zwangsläufig anders, da es wahrscheinlich ist, daß die überwiegende Zahl der Frauen, die ihren Geburtsort verließen, dies aus zwei Gründen taten: Zum einen, wenn sie sich in einer anderen Stadt verheiraten wollten und zum anderen, wenn sie für sich selbst ein Auskommen finden mußten und sich an einem anderen Ort mehr Chancen dafür versprachen. Für letzteres spricht auch die relativ häufige Angabe auf die Frage im Protokoll, warum sie ihren Geburtsort verlassen haben, daß sie ein Fortkommen finden, dienen oder konditionieren wollten, also in Dienst gehen, wobei konditionieren sich nicht nur auf eine Anstellung als Bedienstete bezog, sondern generell auf eine Anstellung.145 Eine große Stadt wie Hamburg versprach eine Vielzahl von Arbeitsmöglichkeiten, so daß fast notwendigerweise die Zahl der Ledigen unter den Zugewanderten besonders hoch sein mußte.
Einen weiteren Einblick in die Zusammensetzung der Bürgerinnen, der vor allem hilft, die soziale Situation der Bürgerinnen einzuordnen, geben die von den Bürgerinnen ausgeübten Berufe. Bevor jedoch abschließend die Struktur der ausgeübten Berufe untersucht wird, soll der Blick der Vollständigkeit halber noch auf die Alterstruktur der Bürgerinnen gerichtet werden.
4.2.2 Altersverteilung der Bürgerinnen bei Antragstellung
Da es sich bei Ledigen und Witwen um unterschiedliche soziale Gruppen mit unterschiedlicher Motivation zum Erwerb des Bürgerrechts handelte (bei den einen geht es um die generelle wirtschaftliche Etablierung, bei den anderen entweder um die Übernahme des Geschäfts des Mannes oder um eine späte Selbständigkeit nach dessen Tod), ist es angebracht, die Altersstruktur beider Gruppen getrennt zu betrachten. Geschiedene wurden auch bei dieser Verteilung nicht berücksichtigt, da die Untersuchung der Altersverteilung von 11 Geschiedenen keine allgemeine Aussagen zuläßt. Ebenfalls nicht berücksichtigt werden konnten 19 Frauen, die keine Angabe zum Alter oder zum Familienstand gemacht hatten.
Bei der nach Ledigen und Witwen getrennt vorgenommen Altersanalyse ergibt sich folgende Verteilung:
N
Jahre
Bild 5: Altersverteilung der ledigen Bürgerinnen
N
Jahre
Bild 6: Altersverteilung der verwitweten Bürgerinnen
Bild 5 zeigt die Altersverteilung von ledigen Antragstellerinnen zusammengefaßt in Blöcke von jeweils fünf Jahren, wobei der in der Graphik auf der Abszisse genannte Wert das mittlere Alter des jeweiligen Blocks angibt. Der überwiegende Teil der Alleinstehenden erwarb im Alter von 23 bis 37 Jahren das Bürgerrecht, sie machten mit 127 Frauen 60,5% der ledigen Bürgerinnen aus. Eine Verteilung, die nicht überraschend ist, wenn man davon ausgeht, daß es sich bei ledigen Bürgerinnen um Frauen handelte, die sich nach einigen Jahren abhängiger Arbeit durch wirtschaftliche Selbständigkeit die Grundlage ihrer Versorgung sichern wollten. In der Altersgruppe von 38 bis 52 liegt die Zahl der Anträge bei 56 von 210 Ledigen, was einem Anteil von 26,7% entspricht.146 Diese Altersgruppe umfaßt ebenfalls überwiegend solche Frauen, die vorher unselbständig gearbeitet hatten. Ledige Frauen, die mit 53 Jahren oder später das Bürgerrecht erwarben, taten dies oft, ohne die Absicht ein Geschäft zu betreiben. Unter den 12 in Frage kommenden Frauen lebten 6 "ohne Geschäft", als Grundeigentümerinnen oder als Partikulierinnen von ihrem eigenen Geld.
Die Altersverteilung der Witwen (Bild 6) gestaltet sich erwartungsgemäß anders. Hier liegt der Altersschwerpunkt der Antragstellerinnen zwischen 38 und 57 Jahren, einem Zeitraum, in dem es für viele Witwen wichtig war, noch ein Zubrot zu den Hinterlassenschaften des Mannes zu erwirtschaften oder als Erbin des Geschäfts noch weiter arbeiten zu müssen.
Bei dem wesentlich höheren Anteil der über 52jährigen Witwen im Verhältnis zu den gleichaltrigen ledigen Antragstellerinnen, stellte sich die berufliche Verteilung demgemäß anders dar als bei den Ledigen. Von den 52 Witwen, die 53 Jahre und älter waren, als sie das Bürgerrecht erwarben, taten dies 11, ohne ein Geschäft zu betreiben. Die Bürgerinnen ohne Gewerbe bildeten mit 21,2% unter den über 52jährigen die größte Gruppe.
4.3 Die von den Bürgerinnen betriebenen Gewerbe
Insgesamt betrug der Anteil der Frauen, die das Bürgerrecht nicht aus wirtschaftlichen Gründen erwarben, mit 58 Frauen 14,5% der gesamten weiblichen Bürgeranträge.147 Diese Gruppe unterteilte sich in zwei Einkommensbereiche: 53 gaben an, "ohne Geschäft", als Partikulierin von ihrem eigenen Geld oder von Zinsen zu leben, und 5, daß sie wegen des Erwerbs eines Grundstücks oder als Grundeigentümerin Bürgerin werden wollten. Als Ruheständlerinnen oder Frauen ohne Beruf waren sie jedoch nicht verpflichtet, Bürgerin zu werden. Auch die Bedingung, daß Bürgersfrauen, -witwen oder -töchter als Grundeigentümerinnen Bürgerin sein mußten, gab es im Gegensatz zu den Männern nicht. Dies wurde in den Verhandlungen zur Bürgerrechtsverordnung von 1839 noch einmal festgestellt. Nur fremde Frauen mußten als Grundeigentümerinnen Bürgerin werden. Trotzdem scheint es hier eine gewisse Unsicherheit gegeben zu haben, denn auch bei den Verhandlungen um das Bürgerrecht 1845 mußte diese Ausnahme für bürgersangehörige Frauen erneut unterstrichen werden. Unter den Frauen, die wegen ihres Grundeigentums Bürgerin wurden, befand sich aber nur eine Frau, die eindeutig als Bürgerstochter identifiziert werden konnte. Sie wurde Bürgerin, bevor die Befreiung von der Verpflichtung in der Bürgerrechtsverordnung gesetzlich fixiert wurde.148
Eine Möglichkeit der Erklärung, warum Frauen, die von ihrem eigenen Geld lebten Bürgerinnen wurden, ist die, daß sie das Bürgerrecht aus Prestigegründen erlangten. Denn für sie gab es keinen offensichtlichen Grund, das Bürgerrecht zu erlangen, außer dem, einen bestimmten sozialen Status durch das offiziell erworbene Bürgerrecht zu unterstreichen. Da sie kein Geschäft betrieben, waren sie nicht auf die Aufhebung der Geschlechtskuratel angewiesen.
Die verbleibenden Frauen können nach den ausgeübten Berufen unterschieden werden. Ausgehend von der hohen Zahl der Ledigen und der unterschiedlichen Motivation von Witwen und Ledigen beim Erwerb des Bürgerrechts wurde auch die Untersuchung der Berufsstruktur in Ledige und Witwen unterteilt.
Als Basis für den Vergleich dienen die von den Ledigen als Berufsziel in Zusammenhang mit dem Bürgerrecht angegebenen Erwerbszweige (Bild 7). Sie werden zunächst mit den Berufsfeldern verglichen, in denen die Frauen arbeiteten, bevor sie das Bürgerrecht erwarben (Bild 8). Dies ermöglicht es festzustellen, inwiefern sich mit dem Erwerb des Bürgerrechts auch der ausgeübte Beruf der Frauen und somit eventuell die soziale Stellung änderte, beziehungsweise ob sie den vorher schon ausgeübten Beruf weiterhin als Selbständige betrieben.
Vergleicht man schließlich die von den Witwen mit dem Bürgerrecht betriebenen Geschäfte (Bild 9) mit denen der Ledigen und den Anteil der Witwen, die schon vor der Erlangung des Bürgerrechts den Beruf ausübten, den sie auch als Bürgerin wahrnehmen wollten, ist es möglich, die unterschiedliche Struktur der von den Witwen betriebenen Gewerbe im Vergleich zu den Gewerben der Ledigen herauszuarbeiten und zu zeigen, wie häufig Witwen tatsächlich eine Geschäftsgründung vornahmen, die sich von ihrer vorherigen Tätigkeit unterschied.
Da eine Darstellung von Einzelfällen wenig aussagekräftig ist, wurden die einzelnen Berufe zu Berufsgruppen zusammengefaßt.149 In den Graphiken 7, 8 und 9 bezeichnet die Gruppe ′Nahrung′ den Anteil der Frauen, die im Bereich Nahrungs- und Genußmittel tätig waren, wobei der ganz überwiegende Teil der Frauen damit handelte. Alle handwerklichen Berufe, die mit der Herstellung von Textilien beschäftigt sind, bilden die Gruppe ′Textil/Prod.′, Händlerinnen von Textil- und Bekleidungswaren bilden die Gruppe ′Textil/Handel′. In den Bereich Textilhandel wurden auch Putzgeschäfte eingeordnet, obwohl es hier begriffliche Unklarheiten gibt. Unter einem Putzgeschäft kann sehr wohl auch die Werkstatt einer Putzmacherin verstanden werden. Im allgemeinen war es jedoch üblich, daß die Inhaberinnen von Putzgeschäften nicht mehr die gesamten Arbeiten ausführten, um die Dekorationsgegenstände herzustellen, sondern daß sie Halb- und Fertigprodukte geliefert bekamen und diese nur noch zusammenstellten, anpaßten oder zusammennähten und dann vertrieben.150 Es handelte sich hier also um ein Mischgewerbe, in dem der Verkauf die größere Komponente darstellte.
Alle anderen Berufe, die mit Handel zu tun haben, wurden in der Gruppe ′Handel′ zusammengefaßt, da sie als einzelne Berufsgruppen nicht zahlreich genug waren. In den Bereich ′Handel′ fallen also sowohl Frauen, die eine spezifische Art von Handel angegeben haben, wie z. B. Porzellanhändlerin, als auch solche Frauen, die lediglich angaben, Inhaberin einer Handlung zu sein. Ausgenommen davon wurden die Frauen, die aufgrund der Einträge in den Bürgerprotokollen oder in den Adreßbüchern eindeutig als Großhändlerinnen eingestuft werden konnten. Sie bilden die Gruppe der ′Kauffrauen′.151 In den Bereich ′Reinigung′ fallen alle Frauen, die im Bereich der Textilpflege (Wäscherinnen und Büglerinnen) und der Raumpflege tätig waren. Unter ′Bedienstete′ wurden sowohl solche Frauen eingeordnet, die die Angabe ′zu dienen′ oder Dienstmädchen zu sein machten, als auch Haushälterinnen, Köchinnen und Krankenwärterinnen. Der Bereich ′Gastronomie′ umfaßt Schank-, Speise- und Logiswirtinnen sowie Inhaberinnen von Vergnügungslokalen und Krügerinnen. Unter ′Erziehung′ wurden Lehrerinnen, Schulgehilfinnen und Kindergärtnerinnen zusammengefaßt. ′Inhaberin/Prod.′ steht für die Frauen, die angaben, Inhaberin oder Betreiberin von Fabriken oder anderer produzierender Gewerbe zu sein. ′Ohne Geschäft′ zeigt den schon erwähnten Teil derjenigen, die von eigenem Geld lebten oder als Grundeigentümerinnen Bürgerin wurden. ′Sonstige′ schließlich umfaßt alle Berufsangaben, die nur vereinzelt vorkamen und in vorstehende Gruppierungen nicht eingeordnet werden konnten, wie beispielsweise Inhaberin eines Fuhrgeschäfts, Geldwechslerin, Blumenmacherin oder Friseurin.
4.3.1 Gewerbe der Ledigen vor und nach Erwerb des Bürgerrechts152
Bild 7:Verteilung der Berufe unter den ledigen Bürgerinnen
Bild 8:Verteilung der Berufe unter den Ledigen vor Erwerb des Bürgerrechts
In Bild 7 weist der gesamte Balken den Anteil der Frauen aus, die in dem jeweiligen Beruf nach Erhalt des Bürgerrechts selbständig arbeiten wollten. Der untere Teil (kariert) zeigt darüber hinaus an, wie hoch der Anteil unter den Frauen in dem jeweiligen Gewerbe war, die vorher schon in dieser Branche tätig waren.
Bild 8 zeigt die Verteilung der Berufe, die die Frauen vor Beantragung des Bürgerrechts ausübten. Hier weist der untere Teil in den Balken darauf hin, wieviele der Frauen nach dem Erwerb des Bürgerrechts weiterhin in diesen Bereichen tätig sein wollten. Bei der beruflichen Verteilung der Frauen vor dem Erwerb des Bürgerrechts gibt es jedoch einige Missings, da hier im Gegensatz zu dem Gewerbe, auf das die Frauen Bürgerin werden wollten, teilweise keine oder unspezifische Angaben in den Bürgerprotokollen gemacht wurden, die keinen genauen Aufschluß geben über die Art des erzielten Einkommens, wie z. B. ′bei Onkel in Geschäften′ und ′durch Hände Arbeit′. Bei dieser Auswertung konnten deshalb nur 156 der 210 ledigen Bürgerinnen berücksichtigt werden.153
Der Handel mit Textilprodukten, seien es Bekleidung, Weißwäsche, Putz oder Hüte, war das Gewerbe schlechthin, in dem sich die ledigen Bürgerinnen selbständig machten. 90 Frauen wollten mit Bekleidung und Textilien handeln, wobei 37 von ihnen schon vorher, beispielsweise als Angestellte in einer Modewarenhandlung, in diesem Bereich tätig waren. In der Produktion von Textilien, z.B. als Schneiderin oder Putzmacherin, wollten nur 26 Frauen selbständig tätig sein, von denen vorher schon 18 Frauen in diesem Handwerk gearbeitet hatten. Vergleicht man die Zahlen der Selbständigen dieser beiden Bereiche mit denen der Berufe vor Beantragung des Bürgerrechts, ergibt sich, daß sich hier ein Wechsel von der Produktion von Textilien zum Handel mit Textilien vollzogen hat, denn vor Beantragung des Bürgerrechts hatten noch 42 Frauen in der Textilproduktion gearbeitet, von denen nur 18 in diesem Bereich blieben. Diese 18 Frauen entsprechen denen, die das Bürgerrecht für ein handwerkliches Gewerbe beantragten. Es gab hier also keine Fluktuation aus anderen Berufen zur Herstellung von Bekleidung und Textilien, sondern nur eine Verlagerung von der Produktion zum Handel. Inwiefern jedoch Frauen, die vorher Schneiderin oder Putzmacherin waren und nun ein Modewarengeschäft betrieben, weiterhin selbst für ihren Laden fertigten, läßt sich aus den Angaben in den Bürgerprotokollen nicht erkennen.
Die Verschiebung der Zahlen von der Produktion zum Verkauf deutet zumindest darauf hin, daß sich die Frauen durch den Handel ein sichereres Einkommen versprachen als von der Herstellung. Dies zeigt sich auch darin, daß die 37 Frauen, die schon vorher im Textilhandel tätig waren, auch in diesem Bereich weiter arbeiteten. Der Rest der nach dem Erhalt des Bürgerrechts selbständig im Textilhandel tätigen Bürgerinnen setzte sich überwiegend aus Frauen zusammen, die vorher in der Textilproduktion gearbeitet haben und aus Dienstmädchen, die sich selbständig gemacht haben.
Vor dem Bürgerrecht hatten 33 Frauen als Bedienstete gearbeitet, von denen nur acht Frauen weiterhin in diesem Bereich bleiben wollten. Dabei handelt es sich um Krankenwärterinnen, Haushälterinnen und Köchinnen. Dienstmädchen beantragten das Bürgerrecht, um sich in einem anderen Beruf selbständig zu machen und das war überwiegend der Handel mit Textilien. Sieht man sich die Frauen an, die nach Erhalt des Bürgerrechts als Bedienstete tätig waren, so sind zu den 8, die vorher schon in diesem Bereich gearbeitet hatten, 3 Frauen hinzugekommen, die nach Erhalt des Bürgerrechts als Krankenwärterinnen arbeiten wollten.
Der starke Zuwachs an Einzelhändlerinnen im Textilhandel ist aus zwei Gründen naheliegend. Geht man davon aus, daß sich Bürgerrechtsanwärterinnen selbständig machen wollten, so lag es für Putzarbeiterinnen, Schneiderinnen etc. nahe, sich in diesem Bereich selbständig zu betätigen. Doch auch für die große Zahl der Dienstmädchen bot sich diese Art von Handel an, weil dies ein traditioneller Frauenbereich war und sie es hier als Einzelhändlerinnen überwiegend mit einer weiblichen Kundschaft zu tun hatten. Ein Grund für den generellen Anstieg von Modewarenhändlerinnen muß auch darin gesehen werden, daß sich die Nähmaschine durchsetzte und Einzelhändlerinnen in die Lage versetzte, Maschinennäherinnen Konfektionen fertigen zu lassen, was einen generellen Boom an Modewarengeschäften seit der Mitte des Jahrhunderts zur Folge hatte.154
Obwohl die Betätigung in der Herstellung von Textilien bei den selbständigen Frauen zugunsten des Handels stark zurückging, bildete dieser Bereich dennoch das zweitgrößte Betätigungsfeld nach dem Textilhandel. Die im 19. Jahrhundert vorwiegend von Frauen ausgeübten Berufe waren auch bei den ledigen Bürgerinnen die Hauptbetätigungsfelder.155 Hierbei handelte es sich jedoch nicht um ausgesprochene Erwerbszweige für bürgerliche Mittelstandsfrauen. Die Herkunft der Textilhändlerinnen aus der Textilproduktion und aus dem Bereich der Bediensteten läßt vermuten, daß es sich bei den ledigen Bürgerinnen vielmehr um Frauen aus kleinbürgerlichem Milieu handelte, die sich die Selbständigkeit und das Bürgerrecht mühsam erarbeiten mußten.
Der Handel mit anderen Waren als mit Textilien spielte bei den ledigen Frauen eine eher untergeordnete Rolle, ebenso die Gastronomie und die Wäscherei.
Der Erwerbsbereich, der im 19. Jahrhundert als schicklich für bürgerliche ledige Frauen angesehen wurde, war der Erzieherische.156 Lehrerinnen und Kindergärtnerinnen waren jedoch unter den Bürgerinnen nur vereinzelt zu finden. Während vor dem Erwerb des Bürgerrechts vier Frauen erzieherisch tätig waren, wollten als Bürgerin nur noch drei von ihnen diesen Beruf ausüben. Der Grund für die geringe Anzahl von Lehrerinnen unter den Bürgerinnen, obwohl die Zahl der Lehrerinnen im 19. Jahrhundert ständig stieg, ist darin zu sehen, daß der Lehrerinnenberuf im allgemeinen nicht selbständig ausgeübt wurde und Privatlehrerinnen, sofern man sie als selbständig bezeichnen will, für das Ausüben des Berufs kein Geschäft benötigten. Bürgerrechtspflichtig waren also nur Vorsteherinnen von Schulen und anderen Erziehungseinrichtungen. Dies hatte schon Westphalen in seiner Auslegung der Bürgerrechtspflicht von Frauen festgestellt.157
Die klassische Bürgerin im Sinne der Kauffrau, die Großhandel betreibt, findet sich unter den ledigen Bürgerinnen gar nicht. Geschäftsgründungen oder -übernahmen dieser Größenordnung waren für ledige Frauen in Hamburg nicht möglich. Auch die Bürgerstochter, die (in Ermangelung männlicher Erben) das väterliche Handelshaus weiterführt, ist im Hamburg des 19. Jahrhunderts nicht vertreten. Doch gab es zwei ledige Frauen, die als Leiterinnen oder Inhaberinnen von Produktionsstätten Bürgerin wurden und in dieser Funktion im elterlichen Betrieb tätig waren.158 Das Bild der reichen Bürgerstochter als selbständige Großbürgerin entspricht aber insgesamt nicht der ledigen Bürgerin des 19. Jahrhunderts in Hamburg. Der Mangel an Unternehmensgründungen von Frauen waren im 19. Jahrhundert kein hamburgspezifisches Phänomen. Generell lassen sich unter den uns bekannten Leiterinnen von Handelshäusern oder Produktionsstätten fast ausschließlich Witwen nachweisen.159
Ein Grund für dieses Manko war, daß Kauffrauen in vielen Bereichen gegenüber ihren männlichen ′Kollegen′ benachteiligt waren, auch wenn sie durch die Aufhebung der Geschlechtsvormundschaft rechtlich die gleichen Handelsgeschäfte betreiben konnten wie Männer. So war ihnen grundsätzlich der Zutritt zur Börse verwehrt, was ein großer Nachteil hinsichtlich des Abschlusses größerer Geschäfte war. Auch die Mitgliedschaft in der Kaufmannsvereinigung des "Ehrbaren Kaufmanns" war ihnen nicht gestattet.160 Da diese Organisation jedoch das Selbstverwaltungsorgan des Kaufmannstandes war und die Commerzdeputation personell besetzte, in der über alle politischen und wirtschaftsrechtlichen Fragen von seiten der Kaufleute entschieden und in Senat und Bürgerschaft vorgetragen wurden, waren Frauen aufgrund ihrer schwachen rechtlichen und politischen Stellung nicht mitspracheberechtigt und konnten an offizieller Stelle ihre Interessen nicht vertreten.
Neben den wenigen ledigen Frauen, die als Töchter in den väterlichen Betrieb eintraten, geben die schon erwähnten Frauen, die ohne Geschäft Bürgerin wurden, einen Hinweis auf die Herkunft aus einer finanziell gut gestellten Familie.
Nach dem Erhalt des Bürgerrechts wollten 26 Ledige ohne Geschäft leben, davon hatten 17 schon vorher von ihrem Geld gelebt (Bild 7), 9 Frauen kamen hinzu, die sich als Bürgerin zur Ruhe setzten. Doch gab es auch 3 Frauen, die, bevor sie Bürgerinnen waren, von ihrem Geld gelebt hatten, als Bürgerinnen aber einem Gewerbe nachgehen mußten, was sie als Händlerinnen mit Textilien taten. Diese Frauen repräsentieren das Versorgungsproblem der mittelständischen alleinstehenden Frauen. Das Einkommen der Familie reichte oft nicht, um die ledigen Familienmitglieder oder hinterbliebenen Frauen dauerhaft zu ernähren, sie mußten einen Weg finden, sich zu unterhalten, ohne ihren sozialen Status zu sehr zu belasten. Die Selbständigkeit in einer eigenen Modehandlung war dafür geeigneter, als das Anfertigen von Stick-, Strick- oder Näharbeiten für andere. Denn so sehr selbst gefertigte Handarbeiten als Zierde der bürgerlichen Hausfrau galten und als eine wertvolle Beschäftigung der bürgerlichen Ehefrauen angesehen wurden, weil sie die Regsamkeit der Hausfrau dokumentierte161, so unpassend war es für bürgerliche Frauen, mit solcher Arbeit ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Oft taten sie dies heimlich, weil es nicht standesgemäß war. Dennoch befanden sich in Deutschland unter den Schneiderinnen und Näherinnen, die seit der Durchsetzung der Nähmaschine Konfektionen für Modewarenhandlungen und Kleidermagazine schneiderten, schon in den 40er Jahren viele Töchter und Witwen kleinbürgerlicher und bürgerlicher Herkunft.162
Wieviele der Bürgerinnen, die im Textilhandel vor und nach Erwerb des Bürgerrechts tätig waren, ursprünglich auch aus solchen bürgerlichen Familien kamen und vielleicht über die handwerkliche Arbeit zum Handel kamen, kann anhand der Bürgerprotokolle nicht festgestellt werden. Doch gibt die Tatsache, daß 27 der 55 ledigen hamburgstämmigen Bürgerinnen Bürgerstöchter waren, einen Hinweis darauf, daß hier ein Bedarf an Erwerbsmöglichkeiten vorhanden war. Entgegen der Annahme Baumeisters, Bürgerstöchter seien wie -witwen vom Kleinbürgerrecht befreit, weist der Anteil der nachweisbaren Bürgerstöchter darauf hin, daß sie, nicht nur als Großbürgerinnen das Bürgerrecht erwerben mußten.
Generell muß allerdings die selbständige Erwerbstätigkeit von bürgerlichen Frauen als sozialer Abstieg im Vergleich zur Versorgungsehe mit ihren hausfraulichen Pflichten gewertet werden, denn es handelte sich auch dabei nicht um eine Form der Selbstverwirklichung von unterforderten und gelangweilten Frauen, sondern um eine nicht standesgemäße Notwendigkeit.
Die Eröffnung eines Textilgeschäfts hatte immerhin den Vorteil, daß dieser Bereich einem weiblich geprägten Metier entsprach und die Inhaberinnen überwiegend mit weiblicher Kundschaft zu tun hatten, was den sittlichen Ansprüchen sicherlich entgegenkam. Eine eigene Handlung, dies stellte auch Charlotte Niermann für Bremer Kleinhändlerinnen zwischen 1890 und 1914 fest, war deshalb unter den Erwerbsmöglichkeiten für bürgersangehörige Frauen eine der akzeptabelsten Formen, den Lebensunterhalt zu bestreiten.163
Doch muß für Hamburg während der ersten zwei Drittel des 19. Jahrhunderts festgestellt werden, daß die geringen Zahlen der mit Bürgerrecht selbständig erwerbstätigen Frauen und die Feststellung, daß diese eher dem kleinbürgerlichen denn dem bürgerlichen Spektum zuzurechnen sind, signalisieren, daß in bürgerlichen Kreisen das Umdenken bezüglich der Erwerbsarbeit von höheren Töchtern noch nicht eingesetzt hatte.
4.3.2 Gewerbe der Witwen nach Erwerb des Bürgerrechts
Bild 9: Verteilung der Berufe unter den verwitweten Bürgerinnen
Unter den Witwen (Bild 9) ist der Anteil derer, die nach dem Erwerb des Bürgerrechts ohne Geschäft leben wollten, nur wenig höher als bei den ledigen Bürgerinnen. 26 von 166 Witwen wurden als Ruheständlerinnen oder Grundeigentümerinnen Bürgerin. Aus den Bürgerprotokollen geht hervor, daß 9 schon vorher als Partikuliere oder Grundeigentümerin gelebt hatten.164 Diese Zahl kommt dadurch zustande, daß die Witwen im allgemeinen nicht sofort nach dem Tod des Ehemannes Bürgerin wurden, so daß einige Witwen schon vorher von den Hinterlassenschaften der Männer lebten und demzufolge ihren ′beruflichen′ Status mit dem Bürgerrecht nicht änderten. Andere Witwen waren zunächst auf eigenen Erwerb angewiesen oder hatten schon als Ehefrauen hinzuverdient oder im Geschäft des Mannes mitgearbeitet und erwarben nun als Rentnerinnen, vermutlich aus den schon erörterten Gründen des Status der Bürgerin an sich, das Bürgerrecht.
Abgesehen von den verwitweten Bürgerinnen ohne Geschäft ist die berufliche Verteilung der Witwen eindeutig anders gelagert als die der ledigen Frauen.
Unter den Witwen finden wir als größten Anteil die Kauffrau, also die Form der Selbständigkeit, die als klassisch für Bürgerinnen angesehen wird. Bei 41 der 166 Witwen konnte festgestellt werden, daß es sich um Großhändlerinnen handelte. Auch unter ihnen lassen sich keine eigenen Geschäftsgründungen feststellen. An dem Balken läßt sich ablesen, daß alle Frauen, die als Kauffrauen Bürgerin wurden, auch aus diesem Bereich kamen. Sie hatten entweder angegeben, schon vor Erwerb des Bürgerrechts die Handlung geführt zu haben oder Kaufmannsfrau gewesen zu sein und wurden deshalb in diesen Bereich eingeordnet.
Für die Witwen unter den Bürgerinnen trifft zu, wie schon Christa Möller feststellte, daß die Kauffrau eine berufliche Nische für Witwen gewesen ist.165 Wird jedoch mit dem Kauffrauenstatus der Bürgerinnenstatus gleichgesetzt, so stimmt dieses Urteil nur dann annähernd, wenn lediglich die Gruppe der Witwen auf ihre berufliche Verteilung hin untersucht wird und dabei außer Acht gelassen wird, daß die Witwen nicht den Großteil der Bürgerinnen stellten.
Es bestätigt sich indes auch unter den Witwen die These, daß Kauffrau, Großhändlerin und Besitzerin von Produktionsstätten in Hamburg kein Bereich war, in dem Frauen Geschäftsgründungen vornahmen. Zwar gab es unter den Witwen 13 Inhaberinnen von Produktionsstätten, im Gegensatz zu 2 Frauen, die als Ledige in diesem Bereich tätig waren, doch handelte es sich auch hier um die Weiterführung des familieneigenen Gewerbes. Trotzdem sind insgesamt 54 der 166 Witwen dem Großbürgertum zuzurechnen.
Ennen stellte für die mittelalterlichen Städte fest, daß unter den selbständigen Kauffrauen viele verheiratete Frauen waren.166 Da es in Hamburg für eine selbständig arbeitende Frau verpflichtend gewesen wäre, das Bürgerrecht zu gewinnen, auch wenn sie verheiratet war, muß davon ausgegangen werden, daß es solche Frauen in Hamburg nicht gab. Für verheiratete Frauen war folglich der Beruf der Kauffrau entweder nur als unterstützende Kraft im Handelshaus des Mannes möglich oder als verwitwete Nachfolgerin des Mannes. Der Anlaß für Witwen, das Unternehmen weiterzuführen, war oft der frühe Tod des Mannes, und daß die Kinder noch nicht alt genug waren, um die Firma zu übernehmen. Dieser Umstand war oft durch den großen Altersunterschied von Mann und Frau in der Ehe bedingt. In den seltensten Fällen wurde die Übernahme der Handlung durch die Witwen testamentarisch verfügt. Sie leiteten das Unternehmen, bis die Söhne ihre Ausbildung beendet hatten und vollständig in die Firma eintreten konnten. Die Motive für die Führung des Geschäfts durch die Witwe können zum einen darin liegen, wirtschaftliche Not zu vermeiden, aber auch darin, daß vom Mann Erschaffene für die Nachkommen zu bewahren.167 Bei den Großbürgerswitwen wird letzteres den Ausschlag gegeben haben.
Nach der Zulassung von Juden zum Bürgerrecht 1849, nahmen auch jüdische Frauen das Bürgerrecht in Anspruch. Sie wurden überwiegend als Witwe von Kaufleuten Bürgerin, wie z. B. Marianne Jonassohn am 1.8.1849, Julie Gumpel am 8.8.1849 und Fanny Warburg am 14.8.1850.168 Von 1849 bis 1864 wurden insgesamt 15 jüdische Frauen Bürgerin,169 davon waren 13 Witwen, eine ledig und eine machte keine Angaben zum Familienstand.
Neben den schon genannten Bereichen lassen sich noch der allgemeine Handel, der Textilhandel und die Gastronomie als Gewerbe ausmachen, in denen Witwen vermehrt tätig waren.
Unter den Handel treibenden Witwen konnten die meisten lediglich als Bürgerswitwe identifiziert werden, ohne daß ihnen ein Großhandel nachgewiesen werden konnte. Diese Frauen lassen aus zwei Gründen keine eindeutige soziale Zuordnung zu. Es könnte sich auch bei ihnen um Großbürgerswitwen handeln, was aber anhand der Eintragungen in den Adreßbüchern nicht nachgewiesen werden konnte. Aber selbst wenn es sich um Kleinbürgerswitwen handelte, so ist der Umstand, daß sie kein Bankkonto führten und keine Waren auf Transit deklarierten - die Gründe für den Erwerb des großen Bürgerrechts - noch kein Hinweis darauf, wie sie finanziell gestellt waren. Hier kann es sich durchaus um eine Spannweite von Kleinsthandel, der gerade das Nötigste zum Leben abwarf, bis zu florierendem Einzelhandel, der seinen Inhaberinnen einen bürgerlichen Lebensstatus erlaubte, drehen.
Doch gab es unter den Witwen auch einige, die trotz fortgeschrittenen Alters noch auf einen eigenen Verdienst angewiesen waren, so zwei Huthändlerinnen im Alter von 70 und 64 Jahren, die vor und nach dem Erwerb des Bürgerrechts vom Huthandel lebten. Sie sind, zusammen mit den Witwen, die als Wirtinnen die Wirtschaft der Männer weiterführten, sich als Logiswirtin ein Zubrot verdienten und denen, die als Näherinnen, Schneiderinnen, Haushälterinnen etc. gearbeitet hatten und als Bürgerinnen selbständig in verschiedenen Bereichen tätig waren, nicht den wohlhabenderen Schichten zuzuordnen. Auch Lehrerinnen und Kindergärtnerinnen, obwohl sie vermutlich aus wohlhabenderen Familien oder Beamtenhaushalten stammten, die ihnen die nötige Bildung hatten zukommen lassen, erzielten nur einen sehr geringen Verdienst. Diese Witwen stellten ein Drittel der verwitweten Bürgerinnen, zuzüglich der 19 handeltreibenden Witwen, deren wirtschaftlicher Status ungewiß ist.
So stellt sich das Bild der Hamburger Bürgerin im 19. Jahrhundert wesentlich vielschichtiger dar als vermutet. Es handelte sich keineswegs nur um Frauen aus der Oberschicht. Im Gegenteil, der überwiegende Teil der Bürgerinnen ist dem kleinbürgerlichen Spektrum zuzurechnen. Ein Ergebnis, das nicht zuletzt wegen der hohen Kosten für das Bürgerrecht überraschend ist. Gleichzeitig zeigt die absolut geringe Zahl von Bürgerinnen aber auch an, daß das Bürgerrecht von Frauen nicht entsprechend den Versorgungsbedürfnissen genutzt wurde.
Zwar hat Lily Braun für die Wende zum 20ten Jahrhunderts darauf hingewiesen, daß nach den Statistiken des Berliner Hilfsvereins für weibliche Angestellte 66% der Verkäuferinnen aus bürgerlichen Haushalten kamen170, doch muß für Hamburg bis in die 60er Jahre des 19. Jahrhunderts festgehalten werden, daß ein Großteil der ledigen Bürgerinnen, die sich im Textilhandel selbständig machten, aus Dienstbotenverhältnissen oder aus der Textilherstellung kamen und dementsprechend überwiegend dem kleinbürgerlichen Milieu zuzurechnen sind. Bei den Witwen gab es zwar einen großen Anteil an Großbürgerswitwen, die die Geschäfte des Mannes weiterführten, doch ist auch hier die Zahl derjenigen Witwen insgesamt höher, die als Nichtbürgersangehörige das Bürgerrecht erwarben, um für ihren eigenen Lebensunterhalt zu arbeiten. Im ganzen entspricht die berufliche Verteilung der hamburgischen Bürgerinnen zwischen 1811 und 1864 also nicht dem Bürgerinnenbild in der Forschung.
Die niedrige Gesamtzahl von 401 Bürgerinnen läßt allerdings vermuten, daß es sich bei den Bürgerinnen nicht um alle Frauen in Hamburg handelte, die selbständig ein Geschäft betrieben. Dies ist darauf zurückzuführen, daß ein Teil der Frauen auf Namen und Bürgerrecht des Mannes Handel trieben, vielleicht sogar als Einzelhändlerinnen gar nicht verpflichtet waren, als Bürgersfrauen eigenständig das Bürgerrecht zu erwerben. Hinzu kommen die Witwen, die zumindest seit 1845 eindeutig vom persönlichen Bürgerrecht befreit waren, egal ob sie ein Geschäft als Erbe weiterführten oder gründeten, sofern sie keine großbürgerlichen Rechte in Anspruch nehmen wollten.
Legt man die Ergebnisse der Volkszählung von 1867 und der darin enthaltenen Statistik über das Verhältnis von Beruf und Stand171 zugrunde, ergeben sich sehr unterschiedliche Verhältnismäßigkeiten. Danach waren im Dezember 1867 in der Stadt und den Vorstädten folgende Frauen im Vergleich zu Bürgerinnen mit gleichem Gewerbe selbständig beruflich tätig172:
15 Schiffsreederinnen und Kauffrauen, die Großhandel betrieben. Demgegenüber gab es zwischen 1811 und 1864 41 Bürgerinnen, denen als Kauffrau oder Handelsfrau in verschiedenen Bereichen entweder das große Bürgerrecht nachgewiesen werden konnte oder ein Großhandel mit Waren, und die somit in die Kategorie Kauffrauen fielen, zuzüglich 3 Frauen, die als Schiffsreederinnen das Bürgerrecht erlangten. Es ergibt sich ein Verhältnis zu den 15 Kauffrauen und Schiffsreederinnen 1867, das, in Anbetracht der Zeitspanne und der sich vergrößernden Stadt, darauf hinweist, daß Kauffrauen (Handelsfrauen), wie im Gesetz gefordert, das Bürgerrecht beantragten.
In der Gruppe der Einzelhändlerinnen, die vom Handel mit Textilien lebten, sind die Zahlen nicht mehr so eindeutig. Bei der Volkszählung gaben 246 Frauen an, selbständig im Handel mit Manufaktur-, Tuch- und holländischen Waren tätig zu sein. In den Bürgerprotokollen finden sich 110 Frauen173, die in diesen Bereich fallen und nicht dem Großhandel zuzurechnen waren. Da es in der Statistik der Steuerdeputation keine eigene Kategorie für Putz-, Modewaren-, Kindergarderobe- und Wäschehändlerinnen gibt, ist anzunehmen, daß sie unter den Manufaktur-, Tuch-, und holländische Warenhändlerinnen berücksichtigt worden waren, so wie sie auch hier in den Bereich Textilhandel eingeordnet wurden. Den 110 Bürgerinnen in dieser Gruppe stehen 246 Frauen in der Volkszählung gegenüber.
Berücksichtigt man hier das Wachstum der Stadt und die Tatsache, daß es seit 1865 die Gewerbefreiheit gab und diese zu einem verstärkten Andrang in den selbständigen Textilhandel von Frauen geführt haben kann174, sowie die Witwen, die trotz eigenen Geschäfts nicht zum Bürgerrecht verpflichtet waren, liegen die genannten Zahlen im Bereich des Textilhandels zwischen den Bürgerinnen und der Statistik 1867 nicht weit auseinander. Hinzu kommt, daß es bis zur Aufhebung des Bürgerrechts immer eine Anzahl von Frauen gegeben haben wird, die aus Kostengründen ohne Bürgerrecht ein Geschäft betrieben oder die Geschäfte als verheiratete Frauen über den Namen des Mannes laufen ließen. Eine Verpflichtung zum Bürgerrecht läßt sich hier durchaus nachweisen.
Anders hingegen gestaltet sich das Bild, wenn die selbständig in der Produktion und Bearbeitung von Textilien arbeitenden Frauen berücksichtigt werden. Während zwischen 1811 und 1864 nur 9 Putzarbeiterinnen bzw. Putzmacherinnen das Bürgerrecht beantragten, arbeiteten 1867 611 Frauen selbständig in diesem Gewerbe. Ebenfalls 9 Bürgerinnen waren als Schneiderinnen Bürgerin geworden, 1867 gaben aber 1863 Frauen an, selbständig in diesem Handwerk zu arbeiten.
Bürgerinnen, die als Wäscherin oder Plätterin selbständig tätig waren, standen nach der Volkszählung 1867 sogar 2443 selbständige Frauen (einschließlich Bleicherinnen) in diesem Bereich gegenüber. Von einer Verpflichtung zum Bürgerrecht vor 1864 für diese Frauen kann daher anhand der Zahlen nicht ausgegangen werden. Diese Annahme wird unterstützt durch die Anzahl der Obst- und Gemüsehändlerinnen. 1867 gab es von diesen 233 Selbständige, aber nur 6 Frauen beantragten für das gleiche Gewerbe zwischen 1811 und 1864 das Bürgerrecht.
Auch bei den Wirtinnen sind die zahlenmäßigen Unterschiede zwischen Bürgerinnen, von denen 26 als Speisewirtin, Schankwirtin oder Inhaberin einer Restauration das Bürgerrecht beantragten und solchen die 1867 in diesem Bereich selbständig waren (322), zu groß, als daß man von einer Bürgerrechtspflicht bis 1864 von allen selbständigen Frauen sprechen könnte.
Insgesamt zeigen die Zahlen, daß es sich bei der Verpflichtung von Frauen zum Bürgerrecht nicht um alle handelte, die ein eigenes Gewerbe betrieben. Gemeint waren tatsächlich nur Handelsfrauen. Der Begriff beschränkte sich jedoch nicht auf Kauffrauen, die im Großhandelsbereich tätig waren, sondern den Zahlen nach auf alle, die als Ledige ein festes Geschäft betrieben. Unklar ist jedoch, warum sich für Wirtinnen, die auch feste Lokale hatten, die Verpflichung zum Bürgerrecht anhand des Vergleichs mit den Zahlen der Statistik von 1867 nicht nachweisen ließ. Zwar waren Bürgerswitwen als Wirtinnen seit 1845 ausdrücklich vom Bürgerrechtserwerb befreit, doch ist davon auszugehen, daß es sich bei der Differenz zwischen 26 Bürgerinnen bis 1864 und 322 selbständigen Wirtinnen 1867 nicht ausschließlich um Witwen handelte, sondern daß viele von ihnen bis 1864 das Bürgerrecht hätten erwerben müssen.
Es ergibt sich aus den Zahlen jedoch auch, daß viele Frauen Bürgerin wurden, die innerhalb der Gruppe von Frauen, die die gleichen Gewerbe wie sie ausübten, als Bürgerin nur eine kleine Minderheit waren. Vorstellbar wäre, daß sie in ihrem Erwerbszweig zu den wenigen gehörten, die ein festes Geschäft betrieben, während die meisten Büglerinnen, Näherinnen und Wäscherinnen etc. ihre Arbeit zu Hause oder bei den Kunden durchführten. Doch selbst wenn sie ein eigenes Geschäft führten, hätte für die meisten von ihnen, z.B. für Wäscherinnen und Büglerinnen, aufgrund ihres zu vermutenden niedrigen Einkommens, seit 1837 die Erlangung der Schutzverwandtschaft genügt, sofern sie keine Gehilfen beschäftigten.
Ebenfalls vorstellbar, aber bei der Höhe der Kosten für das Bürgerrecht fraglich ist es, daß bei diesen Frauen der ideelle Wert, also der Status als Bürgerin, sie dazu bewegt haben könnte, daß Bürgerrecht zu gewinnen. Da nicht nachgewiesen werden konnte, daß die Erlangung des Bürgerrechts automatisch zur Befreiung von der Geschlechtsvormundschaft führte, dies aber - auch wegen der Äußerungen Bueks - nicht ganz von der Hand zu weisen ist, könnte dies für Frauen der Grund gewesen sein, daß Bürgerrecht zu erwerben.
Auf die erstaunlich geringe Zahl von Handwerkerinnen, vor allem Schneiderinnen mit eigenem Geschäft im Vergleich zu der hohen Zahl von selbständig arbeitenden Schneiderinnen 1867 muß im Zusammenhang mit einer möglichen Ausgrenzung von Frauen in den selbständigen Gewerben, d.h. eine Verhinderung des Erwerbs des Bürgerrechts, gerechnet werden, die bisher noch nicht berücksichtigt wurde, weil es für sie nur Anhaltspunkte, jedoch keine eindeutigen Belege gibt.
4.3.3 Mögliche Ausgrenzung von Frauen aus dem Bereich selbständiger Tätigkeit
In der bisherigen Darstellung war die Sichtweise auf die Möglichkeiten für erwerbstätige Frauen, die das Bürgerrecht ihnen gewährte, beschränkt. Lediglich die Darstellung der mit den Kosten für das Bürgerrecht verbundenen Schwierigkeiten des Erwerbs fanden Berücksichtigung. Das Bürgergeld zu beschaffen, ist besonders nach der Auswertung der Bürgerprotokolle als Problem zu bewerten, denn viele ledige Frauen arbeiteten zunächst handwerklich, bevor sie sich als Inhaberin eines Textilwarengeschäfts niederließen. Doch nicht nur die Kosten konnten Frauen am Erwerb des Bürgerrechts hindern.
Das Bürgerrecht wurde für viele Gewerbe nur nach Genehmigung durch die Ämter ausgesprochen. Denn bei den Gewerben, für die Ämter oder Brüderschaften existierten, stand die Entscheidung über die Erlangung des Bürgerrechts nicht der Wedde zu, sondern den zuständigen Ämtern.
Da bei den weiblichen Bürgeranträgen der Handel die überragende Form der selbständigen Erwerbstätigkeit war, mußte zumeist das Krameramt seine Einwilligung zum Bürgerwerden der Frauen geben. Aus den Bürgerprotokollen geht hervor, daß die Wedde in 17 Fällen Verwarnungen aussprach, die sich darauf bezogen, daß die Zulassung zum Bürgerrecht nur nach erfolgter Zustimmung des Amtes als genehmigt anzusehen sei. Bei den Frauen handelte es sich überwiegend um Textilhändlerinnen. Eine der Frauen wollte als Bürgerswitwe die Spiegelfabrik ihres Mannes weiterführen und benötigte dazu die Einwilligung des Tischleramts.175
Es ist zu vermuten, daß diese Frauen es (aus Unkenntnis) versäumt hatten, die Genehmigung bei Anmeldung zum Bürgerrecht vorzulegen, denn im allgemeinen mußten sich diejenigen, die zum Bürgerrecht zugelassen werden wollten, zunächst die Genehmigung des Amtes beschaffen. Diese Regelung zieht - aus der Sicht der Forschung - jedoch ein Problem nach sich, da nicht mehr feststellbar ist, wieviele Frauen gar nicht erst das Bürgerrecht beantragten, weil ihnen das zuständige Amt die Zustimmung verweigerte.
Dies kann sowohl bei den Händlerinnen der Fall gewesen sein, muß aber vor allem bei Schneiderinnen, die als selbständige Schneiderinnen in einem Laden arbeiten wollten, vermutet werden.
In Kapitel 2.2.2 wurde darauf hingewiesen, daß Handwerkerinnen nur dann als bürgerrechtspflichtig angesehen werden konnten, wenn sie ihr Handwerk in einem festen Geschäft ausüben wollten, also eine Werkstatt hatten, nicht aber, wenn sie ihre Arbeiten in den Häusern der Kunden ausführten. Die Auswertung der Bürgerprotokolle hat gezeigt, daß es im betrachteten Zeitraum nur 9 Schneiderinnen gab, die als Schneiderin das Bürgerrecht beantragten. Darunter waren zwei Fälle, in denen das Bürgerrecht nicht oder nicht ohne Einschränkung gewährt wurde.
In einem Fall wurde eine Frau, die Schneiderin gelernt hatte und als Bürgerin selbständig als Putzmacherin arbeiten wollte, darauf hingewiesen, daß sie im Falle der Ausübung des Schneiderhandwerks das Bürgerrecht verlieren würde.176
In einem weiteren Fall wurde eine Schneiderin, die auch nach Erwerb des Bürgerrechts als Schneiderin arbeiten wollte, abgewiesen.177 Obwohl also der Anteil der Schneiderinnen unter den Bürgerinnen sehr gering war, wurde eine von ihnen nicht zugelassen und eine nur mit Verwarnung.
In den Bürgerprotokollen wurden die Abweisungen der Antragsteller(innen) nicht begründet, doch liegt bei der Schneiderin die Vermutung nahe, daß sie aus dem gleichen Grund abgelehnt wurde, aus dem auch der oben genannten Schneiderin mit Verlust des Bürgerrechts bei Ausübung des Handwerks gedroht wurde: die Konkurrenzangst der Ämter.
Das Stellen von Bedingungen seitens der Ämter an die Bürgerrechtsantragsteller war zulässig und erklärt sich daraus, daß oft nicht der in Zukunft auszuübende Beruf darüber entschied, ob jemand zum Bürgerrecht zugelassen wurde, sondern der erlernte Beruf. Denn hatte der Bewerber oder die Bewerberin ein Handwerk erlernt, auch wenn sie darin nicht arbeiten wollten, so hatte das entsprechende Amt das Recht über Zulassung und Ablehnung zu entscheiden, wie es auch schon im Fall des Tischlergesellen in Kapitel 2.3.2 deutlich geworden ist.
Das Handwerk war im gesamten 19. Jahrhundert permanent bedroht, seine Privilegien zu verlieren, und kämpfte dagegen an. Denn auch wenn in den 20er und 30er Jahren des 19. Jahrhunderts das Hamburger Handwerk zu großen Teilen seine privilegierte Stellung wiederherstellen konnte, war es nur eine Frage der Zeit, wann sich die Gewerbefreiheit in ganz Deutschland durchsetzen würde.
Auf der einen Seite war es nicht zuletzt durch die Zunftprivilegien möglich, daß, bedingt durch die geringe Bezahlung der Gesellen, Ehefrauen vielfach mitarbeiten mußten und die Töchter nicht bis zur Heirat versorgt werden konnten. Auf der anderen Seite wollten die Zünfte verhindern, daß Frauenarbeit zu Konkurrenz des Handwerks vor allem im Textilbereich wurde.
Das zunehmende Eindringen von Frauen in die Arbeitswelt führte auch in Hamburg zwangsläufig in den von Frauen ausgeführten handwerklichen Berufen zu Auseinandersetzungen mit den Zünften. So gab es schon 1817 Klagen der Schneider beim Senat gegen die unzünftigen Kleidermacherinnen, die berechtigt waren, Frauenkleider herzustellen und dafür auch weibliche Hilfskräfte einsetzen durften.178 1819 wurden Beschwerden über das Verhalten der Zunftmeister an den Toren der Stadt laut. Die Zünfte besaßen das Recht, Torvisitationen durchzuführen, um illegale Arbeiter aus der Stadt fernzuhalten. Die Kritik richtete sich jedoch dagegen, daß sich die Meister wie Zöllner verhielten und sogar Leibesvisitationen vornehmen würden "... und die Arbeitsbeutel der Frauenzimmer durchsuchten".179
Da Frauen vor allem in zwei Handwerken, nämlich der Putzmacherei und der Schneiderei, tätig waren und die Putzmacherei ein Gewerbe war, das nahezu ausschließlich von Frauen betrieben wurde, waren es vor allem die Schneider, die in Deutschland gegen die Frauenarbeit vorgingen. Schildt geht davon aus, daß der Widerstand der Schneider gegen das Eindringen weiblicher Arbeitskräfte im 19. Jahrhunderts nicht gegen das weibliche Geschlecht gerichtet war, sondern allein auf die Überlegungen zur Überfüllung von Gewerben und der damit in Verbindung stehenden Verarmung vieler Handwerker zurückzuführen sei.180 Die Argumentation der Schneiderinnungen läßt hier aber anderes vermuten. Hätten sie sich nur gegen die Überfüllung gewehrt, hätten sie ihre Argumentation auf die Kritik der Gewerbefreiheit oder die Zulassung unzünftiger Arbeiter beschränken können. Ihre Argumentation richtete sich jedoch gegen die Frauen und wurde mit der leidenden Qualität der Arbeit, also des Ansehens der Schneider insgesamt, begründet. So berichtet Gerhard, daß in Preußen seitens der Schneiderinnungen gegen die "..."Pfuscherei", das heißt den "selbständigen Betrieb der Schneiderei durch Frauenpersonen"..."181 interveniert wurde. In dem 1848 in Frankfurt tagenden Handwerkerparlament wurde unter anderem gefordert, die Arbeit der Frauen zu beschränken, " aus Sorge um den letzten Rest an Tüchtigkeit und Wohlstand".182 In Hamburg gab es 1839 laut den Statistiken Neddermeyers 1352 Schneider und 301 unzünftige Schneiderinnen sowie 1038 Näherinnen.183
Die Putzmacherinnen - von denen es 1839 in Hamburg 78 gab184 - standen weniger im Kreuzfeuer der zünftigen Kritik, weil es sich bei ihrem Gewerbe um ein rein weibliches Geschäft handelte, da sie für die von ihnen hergestellten Accessoirs eine rein weibliche Kundschaft hatten, die aus der "Putzsucht" der Frauen entstand und deshalb bei den männlichen Handwerkern nicht als Bedrohung empfunden wurde.185
Vor diesem Hintergrund ist zu vermuten, daß es vor allem bei Frauen, die sich als Handwerkerin mit einem eigenen Geschäft selbständig machen wollten, aber auch in Fällen, wo das Krameramt zuständig war, gar nicht erst zu Bürgeranträgen gekommen ist, weil die Ämter ihre Zustimmung verweigerten.
4.4 Verlassen des hamburgischen Nexus
4.4.1 Aufgabe des Bürgerrechts
Wer die hamburgische Staatsangehörigkeit aufgeben wollte, mußte sich mit einer förmlichen Bitte um Entlassung an den Senat wenden. Falls der Antragsteller oder die Antragstellerin in einen Staat ziehen wollte, in dem keine Freizügigkeit herrschte, und sofern der Senat keine Bedenken gegen die Entlassung aus dem hamburgischen Staat hatte, übernahm er die erforderlichen Schritte, um den Übertritt in die neue Staatsangehörigkeit zu ermöglichen.
Wie beim Erwerb des Bürgerrechts mußten die betreffenden Bürgerinnen und Bürger auch bei der freiwilligen Aufgabe des Bürgerrechts diese Absicht in Form einer Anzeige im "Hamburgischen Correspondenten" öffentlich machen, um anderen, vor Verlassen des hamburgischen Gebiets, Gelegenheit zu geben, eventuelle Forderungen gegen sie durchsetzen zu können. Denn mit der Aufgabe des Bürgerrechts oder des Staatsangehörigkeitsstatus an sich ging das Verlassen des hamburgischen Gebiets einher. Einen anderen Grund für die freiwillige Aufgabe des Bürgerrechts konnte es nicht geben, da es keine Möglichkeit gab, den Status des Bürgers gegen einen niedrigeren Status, z.B. den des Schutzverwandten einzutauschen und dafür das Bürgergeld zurückerstattet zu bekommen. Hatte also jemand das Bürgerrecht erlangt, um sich selbständig zu machen, und war damit gescheitert, konnte er sich nicht über die Rückgabe des Bürgergeldes sanieren. In der Bürgerrechtsverordnung von 1845 wurde darauf hingewiesen, daß alle Bürger und Bürgerinnen, die entlassen werden wollten, den Bürgerbrief abzugeben hätten und daß jeder aus dem hamburgischen Nexus Entlassene mit sofortiger Wirkung als Fremder angesehen und der Fremdenpolizei unterstellt würde.186 Letzteres ergab sich aus den Heimatrechtsverordnungen von 1837 und 1843, wonach der Verlust des Bürgerrechts den Verlust des Heimatrechts, also der Staatsangehörigkeit, nach sich zog.187
Da es nicht selten vorkam, daß hamburgische Staatsangehörige, die den Nexus verlassen wollten, schon seit längerer Zeit nicht mehr in Hamburg wohnten, konnte das Verfahren der Entlassung abgekürzt werden. In diesem Fall reichte es, wenn die Antragsteller einen Bevollmächtigten ernannten, der alle ihre Angelegenheiten regelte und der als Selbstschuldner für alle schon vorhandenen Forderungen gegen den zu Entlassenden haftete. Hierbei handelte es sich größten Teils um Steuerschulden. Neben der Annoncierung des geplanten Verlassens des Nexus mußte dementsprechend eine Bescheinigung der Steuerdeputation beigebracht werden, daß alle Steuerschulden seitens des oder der zu Entlassenden oder dem jeweiligen Bevollmächtigten beglichen waren.188
Während die Gründe für Männer, den hamburgischen Staat zu verlassen, überwiegend in der Chance gesehen werden müssen, woanders ein besseres Auskommen durch ihre Arbeit zu finden oder ihren geschäftlichen Erfolg auszubauen, ist es unwahrscheinlich, daß Frauen die gleichen Gründe für die freiwillige Aufgabe der Staatsangehörigkeit hatten. Frauenarbeit an sich war zwar in den industrialisierten Gebieten vor allem in den Manufakturen zu einer Alltäglichkeit geworden, die auch zu einer Wanderung von Frauen in die industriellen Zentren führte, doch waren Frauen als selbständig Arbeitende keine Alltäglichkeit. Es dürfte für sie weitaus schwieriger gewesen sein, sich geschäftliche Kontakte und einen Kundenstamm aufzubauen. Die Niederlassung in einer anderen Stadt, um dort ein neues oder weiteres Geschäft zu eröffnen, kann deshalb für sie nicht der vorwiegende Grund für die Aufgabe der hamburgischen Staatsangehörigkeit gewesen sein.
4.4.2 Gründe für die Aufgabe des Bürgerrechts von Frauen zwischen 1834 und 1865
Aus dem Anstieg der gesamten Einwohnerzahlen Hamburgs im 19. Jahrhundert ist ersichtlich, daß die Zahl der Entlassungen aus der hamburgischen Staatsangehörigkeit sehr viel niedriger sein mußte als die der Zuwanderer und Bürgeranträge. In den Jahren zwischen 1834 und 1865 lag sie zwischen 11 und 65 Entlassungen jährlich. Der Anteil der Frauen ist auch hier nicht sehr hoch, aber höher als bei den Bürgeranträgen. Von 1834 bis zum 20. Februar 1865 wurden rund 1000 Entlassungsanträge bewilligt, davon betrafen 38 Frauen.189
Abgelehnte Entlassungsgesuche waren nicht sehr häufig und betrafen zum größten Teil Bürgerssöhne, die ihren Militärdienst noch nicht abgeleistet hatten und deshalb zunächst nicht entlassen wurden. Von den 40 abgelehnten Entlassungsgesuchen zwischen 1851 und 1865 betraf keines eine erwachsene Frau. Lediglich in einem Fall 1860 war eine minderjährige Bürgerstochter betroffen, deren Vater, ein Schuhmachermeister, sie zur Adoption zu ihrem Onkel schicken wollte, weil dieser sie besser versorgen könnte.190
Unter den bewilligten Entlassungsgesuchen von Frauen zwischen 1834 und 1865 befand sich keine Bürgerin, die zum Zeitpunkt ihres Austritts aus der Staatsangehörigkeit selbständig das Bürgerrecht erworben hatte.
Den Hauptteil der Frauen, die die Staatsangehörigkeit aufgeben wollten, stellten Bürgerswitwen und Bürgerstöchter. Bei einigen ledigen Frauen und Witwen war nicht ersichtlich, ob es sich um Angehörige Hamburger Bürger oder um Schutzverwandte handelte. Unter den Entlassungsanträgen befand sich lediglich 1858 der einer geschiedenen Frau. Sie war jedoch nicht in Hamburg verheiratet gewesen, sondern in Hannover und war nach der Scheidung zu ihren Eltern nach Hamburg zurückgekehrt.
Bis auf wenige Ausnahmen verließen die ledigen Frauen und Bürgerstöchter Hamburg, weil sie sich in einer anderen Stadt verheiraten wollten. Nach dem Gesetz von 1845 verloren Bürgerstöchter generell ihren Status, wenn sie sich im Ausland verheirateten. Dennoch gab es in manchen Staaten Schwierigkeiten mit der Anerkennung, so daß ihnen der formelle Austritt aus der hamburgischen Staatsangehörigkeit bescheinigt werden mußte. 1854 begründete eine Bürgerstochter ihren formellen Antrag damit, daß sie zwar wisse, daß eine Heirat ins Ausland den Verlust ihres Rechtes nach sich ziehe, daß dies aber in ihrem Falle nicht ausreichend sei. Sie wolle sich in Reichenbach in Böhmen verheiraten. Um dort das Aufgebot bestellen zu können und um die Mitgift steuerfrei einführen zu dürfen, benötige sie eine offizielle Bescheinigung über ihren Austritt aus dem Staatsangehörigkeitsverhältnis.191
Auffällig hoch war der Anteil der Frauen (Witwen wie Ledige), die nach Frankfurt a. M. heirateten. Unter diesen Frauen gab es sowohl Fälle, die, bevor sie heiraten konnten, die hamburgische Staatsangehörigkeit aufgeben mußten als auch solche, die erst im nachhinein aus dem hamburgischen Nexus austraten.
So bat 1841 eine Hamburger Bürgerswitwe, die in Frankfurt a. M. erneut geheiratet hatte, um den Austritt aus dem Nexus, damit das Frankfurter Bürger - und Schreinermeistersrecht ihres Mannes auf sie ausgeweitet werden konnte. 1847 wünschte eine Frau, die ein Jahr zuvor einen Frankfurter Bürger geheiratet hatte, ihre Entlassung, damit sie in den Frankfurter Nexus eintreten konnte. Ebenso 1852, als eine in Frankfurt verheiratete Hamburgerin austrat, um Frankfurter Bürgerin werden zu können. Im gleichen Jahr stellte jedoch auch ein Bürger als väterlicher Vormund für seine Tochter, die mit einem Frankfurter Bürger verlobt, aber noch nicht verheiratet war, den Antrag auf Entlassung. Er begründete dies in seinem Gesuch beim Hamburger Senat:
"Es ist nun entweder nothwendig oder es wird doch entschieden gewünscht, daß auch meine Tochter Frankfurter Bürgerin werde."192
Die Aufgabe des hamburgischen Nexus war demnach nicht zwingend, um in Frankfurt einen Bürger heiraten zu können. Lediglich wenn die Frau Frankfurter Bürgerin werden wollte, mußte sie die hamburgische Staatsangehörigkeit nachweislich aufgeben. Dies konnte aber auch, wie in den oben angeführten Fällen, nach der Hochzeit geschehen.
In einem Protokollauszug des Frankfurter Senats aus dem Jahre 1834 ergibt sich bezüglich der Heirat einer Hamburgerin mit einem Frankfurter Bürger, daß die Aufgabe des Nexus nicht in direktem Zusammenhang mit der Heirat stand, sondern mit dem Bürgerrecht: Der Verlobte der Braut hatte für sie ein Bürgerrechtsgesuch eingereicht und daraufhin stellte der Senat fest:
"Würde Johanna Caroline Hedwig Stumpfeld aus Hamburg ihre Entlassung aus dem Bürgerverband daselbst beibringen, so soll ihr bei Eheschließung des hiesigen Bürgers und Handelsmannes Johann Michael Walther das hiesige Bürgerrecht (...) ertheilt sein."193
Der Austritt aus dem hamburgischen Nexus bei einer Heirat in Frankfurt a. M. war demnach nur vonnöten, wenn sie als Bürgersfrau auch die Rechte einer Frankfurter Bürgerin beanspruchen wollte, was im wesentlichen im Falle der Witwenschaft von Bedeutung gewesen sein wird.
Unter den ledigen Frauen, die nicht wegen einer Heirat die hamburgische Staatsangehörigkeit aufgaben, verließen einige aus gesundheitlichen Gründen Hamburg und andere, um an einem anderen Ort, an dem es ihnen besser gefiel, zu leben. Nur eine Frau gab ihre Staatsangehörigkeit auf, um anderswo beruflich tätig zu sein. Die Hamburger Bürgerstochter Auguste Dorothea Imhorst hielt sich seit ihrer Kindheit nicht mehr in Hamburg auf und lebte 1854 in Bremerhaven. Dennoch besaß sie die hamburgische Staatsangehörigkeit, da sie weder im Ausland verheiratet noch offiziell in einen anderen Staat übergesiedelt war.194 Der Status der Bürgerstochter hätte ihr den Erwerb des selbständigen Bürgerrechts in Hamburg finanziell sehr erleichtert. Gleichwohl hatte sie sich in Bremerhaven niedergelassen und wollte dort eine Mädchenschule eröffnen. Um dies tun zu können, mußte sie Einwohnerin, aber nicht Bürgerin Bremens werden, denn für die Stadtgemeinde Bremerhaven galt nicht das bremische Bürgerrecht mit Handlungsfreiheit als Voraussetzung zu selbständiger Ausübung eines Gewerbes, sondern die Aufnahme als bremische Staatsgenossin und in deren Folge die Aufnahme als Gemeindegenossin in Bremerhaven.195
Auch unter den Witwen war die (erneute) Heirat ein häufiger Grund, die hamburgische Staatsangehörigkeit aufzugeben, aber bei ihnen kam noch ein weiterer hinzu, der im allgemeinen Witwen mit Kindern betraf. Sie verließen Hamburg, weil sie bei ihren Verwandten leben wollten. Dort sahen sie für sich und ihre Kinder bessere Versorgungschancen. Ein besonders interessantes Beispiel ist in diesem Zusammenhang die Bürgerswitwe Elise Henriette Dorothea Raynal.196 Ihr Fall verdeutlicht das Dilemma, in dem Bürgerswitwen steckten, wenn es um die Frage der eigenen Versorgung ging und um die Abhängigkeit von der Familie. Frau Raynal war 1804 in Rostock geboren und mit dem Bürger Martin Alexander Raynal aus der Vorstadt St. Georg in Hamburg verheiratet gewesen. Im Juni 1843 beantragte sie als 39jährige Bürgerswitwe ihre eigene und die Entlassung ihrer Kinder aus dem hamburgischen Nexus, weil sie mit ihren Kindern nach Altona zu Verwandten ziehen wollte. Sie hoffte, dort besser für ihre Kinder sorgen zu können und sich selbst zu beschäftigen. Dem Entlassungsgesuch wurde stattgegeben. Gut zehn Jahre später, am 4. Januar 1854 beantragte Frau Raynal selbständig das Bürgerrecht in Hamburg.
Aus dem Bürgerprotokoll erfahren wir, daß Frau Raynal zum Zeitpunkt des Bürgerrechtsantrags 7 Kinder im Alter von 11 bis 20 Jahren hatte. Als sie aus dem hamburgischen Nexus austrat, war das älteste der Kinder ca. 10 Jahre alt und das jüngste noch nicht einmal ein Jahr. Sie war somit dringend auf Hilfe von außen angewiesen, wenn sie auch noch für ihren Lebensunterhalt sorgen mußte. Ebenfalls aus dem Bürgerprotokoll ist ersichtlich, daß Frau Raynal das Bürgerrecht beantragte, um als Vorsteherin eine Mädchenschule zu leiten. Auf die Frage im Protokoll, bei welchem "Brodt- und Lehrherren" sie gewesen sei, also welches Gewerbe sie ausgeübt habe, gab sie Schullehrerin zu Protokoll und legte eine Schulkonzession vor. 1855 war sie im Hamburgischen Adreßbuch mit dem Vermerk Töchterschule eingetragen.197 Aus diesen Angaben ergibt sich, daß es sich bei Elise Raynal um eine relativ gebildete Frau gehandelt haben muß, die mit ihrer Ausbildung in der Lage war, sich zu ernähren und dies auch tat. Die Aussage im Entlassungsgesuch 1843, daß sie sich in Altona beschäftigen wolle und die Angabe, daß sie als Schullehrerin gearbeitet hatte198, weisen darauf hin, daß sie auf eigenen Verdienst angewiesen war und gleichzeitig die Hilfe der Verwandten bei der Aufsicht der Kinder benötigte, um einer Beschäftigung nachgehen zu können. Sie war daher gezwungen, ihr Zuhause und gleichzeitig ihre Staatsangehörigkeit aufzugeben, um sich und die Kinder versorgen zu können. Auch die Tatsache, daß sie nach zehn Jahren, als die Kinder in einem Alter waren, in dem sie nicht mehr ständig beaufsichtigt werden mußten oder die älteren Geschwister sich um die jüngeren kümmern konnten, nach Hamburg zurückkehrte, um sich hier mit fast 50 Jahren erneut zu etablieren und dafür die Zahlung der Bürgerrechtskosten auf sich zu nehmen bereit war, deutet darauf hin, daß das Verlassen Hamburgs für sie ein notwendiges Übel gewesen war. Denn sie hatte durch ihre Entlassung den Status der Bürgerswitwe aufgegeben, galt nun als Fremde und mußte bei ihrer Zulassung zum Bürgerrecht das volle Bürgergeld in Höhe von 80 Mk (zuzüglich der Gebühren für Stempel, Eid etc. ergab das 100 Mk 12 Sh) tragen199, was nach der Verordnung von 1845 für verheiratete Antragsteller mit Kindern oder solche, die aus einer früheren Ehe Kinder hatten, vorgesehen war. Eine Wiederaufnahme in den Staat unter Anerkennung ihres früheren Bürgerswitwenstatus war rechtlich nicht vorgesehen. Wäre dem so gewesen, hätte sie nur 25 Mk Bürgergeld zahlen müssen. So jedoch war es eine sehr teure Rückkehr nach Hamburg, um hier ihren Beruf auszuüben.
Der Fall einer gebürtigen Bremerin, die mit einem Hamburger verheiratet war, zeigt, daß bei der Rückkehr von ehemaligen Bremerinnen in die bremische Staatsangehörigkeit ihr vormaliger Status anerkannt wurde.
Emma Schmiedell war, als ihr Mann krank wurde und in Bremen im Krankenhaus lag, ebenfalls nach Bremen gegangen, um bei ihm zu sein. Nachdem ihr Mann gestorben war, stellte sie fest, daß er weniger hinterlassen hatte als angenommen. Daraufhin entschied sie sich, ganz in Bremen zu bleiben, weil sie dort Hilfe von Verwandten und Freunden bekommen konnte. Das Bremer Bürgerrecht ohne Handlungsfreiheit, das bremische Bürgerkinder erbten, hatte sie, als sie nach Hamburg heiratete, verloren. Nachdem sie sich wieder in Bremen niedergelassen hatte, wurde ihr vom Senat zuerkannt, daß ihr ehemaliges Bürgerinnenrecht restituiert werde, wenn sie aus dem hamburgischen Staat austrete. Lediglich die Söhne, die ja Hamburger waren und in Bremen keine Rechte besaßen, mußten das Recht, als bremische Bürgerssöhne anerkannt zu werden, erwerben.200
Romina Schmitters These, daß das günstigere Bürgerrecht in Bremen eine aus dem Mittelalter stammende Konzession an die wirtschaftlich im Verhältnis zu Männern schlechter gestellten Frauen gewesen sei, bestätigt sich auch im Falle der Rückkehr von ehemaligen Bremer Bürgerinnen, während die Verhältnisse in Hamburg die Annahme stützen, daß es seitens Senat und Bürgerschaft kein Gespür gegenüber der schwierigen Situation von ledigen Frauen oder Witwen gab.
Die Aufgabe der Staatsangehörigkeit und des Bürgerswitwenstatus wurde vielfach dadurch ausgelöst, daß die Männer den Frauen nicht genug hinterlassen hatten, und die Witwen dementsprechend auf die finanzielle Unterstützung oder, wenn sie einer Arbeit nachgingen, zumindest auf Unterstützung bei der Erziehung der Kinder angewiesen waren. Aber nicht jede Witwe, die mit ihren Kindern lebte, hatte die mütterliche Vormundschaft für ihre Kinder. In einigen Fällen oblag diese der Vormundschaftsdeputation. Wollte eine solche Witwe Hamburg verlassen, weil sie mit ihren Kindern bei Verwandten unterkommen konnte oder sich anderswo ein besseres Auskommen versprach, mußte die Vormundschaftsdeputation ihr Einverständnis für den Übergang der Kinder in eine fremde Staatsangehörigkeit geben. Dabei ging es nicht nur darum, den Nachweis zu erbringen, daß die Übernahme der Vormundschaft durch die entsprechende Behörde des fremden Staates gewährleistet war, die Deputation hatte sich auch zu versichern, daß den Kindern durch den Eintritt in ein anderes Staatsangehörigkeitsverhältnis keine Nachteile entstanden.
So gab es im Falle der Bürgerswitwe Juliane Eulalie Therese Braun, die 1840 die Entlassung von sich und ihren minderjährigen Kindern aus der hamburgischen Staatsangehörigkeit beantragte201, zunächst Einwände der Vormundschaftsdeputation. Frau Braun lebte mit ihren beiden Kindern schon seit einiger Zeit in Stralsund bei Verwandten und wollte nun dort ihren festen Wohnsitz nehmen, weil es für sie und ihre Kinder einfacher war, wenn sie die Unterstützung der Verwandten hatten. Die Vormundschaftsdeputation hatte grundsätzlich nichts gegen den Austritt, wies jedoch darauf hin, daß eines der Kinder ein Junge sei, der bei Eintritt in die preußische Staatsangehörigkeit womöglich der dortigen Militärpflicht unterliegen würde. Da die preußische Militärpflicht sehr viel "lästiger" sei, habe die Deputation Bedenken gegenüber seinem Austritt. Da sie selbst nicht in der Lage sei, zu beurteilen, ob der Junge als nicht in Preußen Geborener und einziger Sohn seiner Mutter überhaupt zum preußischen Militär eingezogen werden würde, bat die Deputation den Senat, "auf diplomatischem Wege die geeigneten Erkundigungen einzuziehen".202 Dieser Bitte kam der Senat nach und nachdem die Bedenken der Deputation ausgeräumt waren, konnte die Witwe im März 1841 mit ihren Kindern den Nexus verlassen.
Nicht immer war es jedoch die Versorgung, sei es in der Ehe oder bei Verwandten, die den Ausschlag gab, Hamburg zu verlassen. Im Falle der ledigen Jeannette Ross führte die Höhe der Steuern, die die Stadt Hamburg von ihr erhob, zum Austritt aus dem hamburgischen Staat.
Nach dem Tod ihrer Mutter war Jeannette Ross von der Steuerdeputation selbständig versteuert worden, weil sie als Bürgerstochter galt. Ihre Mutter hatte 1843 nach dem Tode ihres Mannes den hamburgischen Nexus verlassen, um auf ihrem Besitz Krähenberg in Pinneberg zu leben.203 Aus der Stellungnahme der Steuerdeputation geht hervor, daß auch Jeannette Ross sich überwiegend hinter Altona aufhielt, vermutlich ebenfalls in Pinneberg. Trotzdem hatte sie der hamburgische Staat nach dem Tod der Mutter voll versteuert, denn sie besaß eine Wohnung in Hamburg und hatte dementsprechend einen ständigen Wohnsitz hier. Jeannette Ross selbst war jedoch der Meinung, daß man sie in Hamburg nicht voll versteuern könne, sondern allenfalls die Summe, die sie hier verbrauche und die sich auf ca. 5000 Mk (!) pro Jahr belief, da sie nicht hamburgische Staatsangehörige sei und selten hier lebe. Zum Beweis legte sie ihre Familienverhältnisse dar.
Sie wurde 1812 in England geboren und kam 1820 mit ihrem Vater nach Hamburg. Obwohl ihr Vater Hamburger Bürger war, verstand sie sich selbst als englische Staatsangehörige, da sie nie persönlich in den hamburgischen Nexus eingetreten war. Die Steuerdeputation beurteilte die Lage jedoch anders. Sie sah Frau Ross als Bürgerstochter an, denn ihr Vater war Hamburger Bürger geworden, als sie noch minderjährig war. Als ihre Mutter aus dem hamburgischen Nexus austrat, hatte sie nicht um den Austritt ihrer - 1843 schon erwachsenen - Tochter nachgesucht. Folglich sei Jeannette Ross als Staatsangehörige anzusehen, die nicht nur die Rechte solcher wahrnehmen könne, sondern auch die Pflichten der Steuerzahlung zu tragen habe.
Für Frau Ross bedeutete dies, daß sie nicht nur an dem Ort in Holstein, wo sie überwiegend lebte, versteuert wurde, sondern auch in Hamburg. Während sie in einem Schreiben an den Senat vom 9. April 1861 seine Entscheidung bezüglich ihrer Staatsangehörigkeit zur Kenntnis nahm, erklärte sie auch, daß die Staatsangehörigkeit für sie keine Vorteile habe. Da sie von ihrem ererbten Geld lebe, käme für sie das Recht auf selbständigen Erwerb des Bürgerrechts, um ein Gewerbe ausüben zu können ebensowenig in Frage, wie die Inanspruchnahme sozialer Versorgungseinrichtungen. Aus diesem Grunde sei die Staatsangehörigkeit für sie, so sehr sie sich auch der Stadt verbunden fühle, nicht tragbar. Wenn der Senat ihr nicht einen Teil der Steuern erlassenen könne, müsse sie den Nexus verlassen204, was sie dann auch tat.
Fälle wie der von Jeannette Ross, die ein sehr hohes Vermögen hatte und folglich wirklich nicht auf die Vorteile des weiblichen Bürgerrechts angewiesen war, sind Einzelfälle. In diesem Zusammenhang ist es aber erstaunlich, wieviele Frauen selbständig das Bürgerrecht beantragten, obwohl sie von ihrem eigenen Geld lebten.
Die Gründe für das Verlassen des Nexus von Frauen lagen unterdessen vorherrschend im Versorgtsein. Sei es als Ehefrau im Falle der Bürgerstöchter oder durch die Aufnahme bei Verwandten im Falle der Bürgerswitwen.
Frauen, die persönlich das hamburgische Bürgerrecht erworben hatten, um sich eine selbständige Existenz aufzubauen, gaben zwischen 1834 und 1865 ihr Bürgerrecht nicht auf. Dies unterstützt die These, daß die Handlungen der Frauen sehr stark versorgungsorientiert waren, und daß Bürgerinnen, die sich durch ein eigenes Geschäft ernährten, nicht wie Männer Standorte wechselten, um besser voran zu kommen. Die berufliche Verteilung hat gezeigt, daß die Zahl der Gewerbe, die von Frauen eigenständig ausgeübt wurden, sehr begrenzt war und sich hier wie bei der unselbständigen Erwerbsarbeit von Frauen im 19. Jahrhundert überspitzt auf den Bereich Textil reduzieren läßt, sieht man von den durch die Witwen übernommenen großen Handelsgeschäften ab.
Witwen, die nicht die Geschäfte der Männer übernahmen, sahen für sich oft bessere Chancen, wenn sie bei Verwandten unterkommen konnten, besonders, wenn sie Kinder hatten.
5 Die Aufhebung des weiblichen Bürgerrechts 1864
Die Kosten für das hamburgische Bürgerrecht zeigen ebenso wie die gesetzliche Entwicklung, daß es in Hamburg um die Mitte des 19 Jahrhunderts keine Sensibilität seitens des Senats für die Problematik von unverheirateten Frauen, die gerade in kleinbürgerlichen und bürgerlichen Verhältnissen im 19. Jahrhundert mehr und mehr auf eine eigene berufliche Existenz angewiesen waren, gab. Zwar war dem Senat die Lage der unverheirateten Bürgerstöchter bekannt, wie die generelle Stellungnahme von Oberalten und Senat im Falle des Tischlergesellen, der als Arbeitsmann das Bürgerrecht bekam, um eine Bürgerstochter ehelichen und versorgen zu können, gezeigt hat, doch schlug sich die Situation nicht dahingehend nieder, daß den Frauen generell und nicht nur den Bürgerstöchtern und -witwen von Seiten der Stadt der Zugang zu selbständigem Gewerbe finanziell erleichtert wurde. Die Einsicht, daß ledige Frauen sich auch in den bürgerlichen Schichten selbst versorgen mußten, anstatt eine Versorgungsehe einzugehen, hatte sich noch nicht durchgesetzt. Die Auswertung der Bürgerprotokolle hat jedoch auch gezeigt, daß sich unter den ledigen Frauen, die das Bürgerrecht als Chance nutzten, sehr viele Frauen befanden, die dem kleinbürgerlichen Spektrum zuzuordenen sind: Frauen, deren Familien möglicherweise als kleine Kaufleute oder Handwerker ihr Brot verdienten. Ausgehend von der Berufsverteilung der Frauen vor Erwerb des Bürgerrechts und der Tatsache, daß ein wesentlicher Teil von ihnen nicht aus Hamburg kam, ist zu vermuten, daß sich unter den ledigen Bürgerinnen nur wenige befanden, die aus einem bürgerlichen Milieu stammten.
Dieses Ergebnis stimmt mit der These überein, die A. Kühne schon 1859 aus dem sich darstellenden Erfahrungshintergrund aufstellte. Jeder in der Gesellschaft kenne sie, die Tanten, Cousinen, Schwägerinnen, die unversorgt den eigenen Familien eher eine Last denn eine Hilfe seien. Der Mittelstand habe es aber noch nicht über sich gebracht, die Arbeitsteilung, wie sie in der arbeitenden und in der kleinbürgerlichen Klasse zwischen Mann und Frau üblich sei, anzunehmen, um sich selbst von dem Problem der unversorgten Frauen zu befreien und den Frauen die Möglichkeit zu geben, ihr Leben in einen würdevollen Rahmen zu stellen, der noch dazu ihre Heiratschancen vergrößern würde. Denn nicht zuletzt würden bürgerliche Männer deshalb so spät heiraten, weil sie nicht auf finanzielle Unterstützung der Frauen rechnen könnten und sich so vor der Ehe erst vollständig beruflich etablieren müßten.205
Für den bürgerlichen Mittelstand war noch immer die Ehe die adäquate Versorgung der eigenen Töchter. Lediglich der Lehrerinnenberuf, für den die Frauen jedoch nur das Bürgerrecht benötigten, wenn sie eine Schule leiteten, wurde akzeptiert. Daraus folgt, daß das Bürgerrecht im 19. Jahrhundert als berufliche Basis, sieht man von den Großbürgerswitwen ab, fast ausschließlich von den Frauen genutzt wurde, die im allgemeinen nicht mit dem Bürgerrecht in Verbindung gebracht werden: ledige Frauen aus kleinbürgerlichen Verhältnissen.
Weder die Darstellung der rechtlichen Entwicklung noch die der wirtschaftlichen Bedeutung konnte bisher vermitteln, inwieweit die Eigenständigkeit von Frauen, ihre selbständige Versorgung und das weibliche Bürgerrecht als Anspruch in den Köpfen der Hamburgerinnen und Hamburger vorhanden war.
Diese Frage stellt sich nicht nur vor dem Hintergrund der ökonomischen Bedeutung des weiblichen Bürgerrechts, sondern auch in bezug auf die Problematik der politischen Partizipation von Frauen innerhalb der Verhandlungen um die Aufhebung. Eine Möglichkeit, dies zumindest im Ansatz festzustellen, bietet der Blick auf die demokratische Bewegung der 1848er Zeit und die sich in der gleichen Zeit entwickelnde frühe Frauenbewegung.
5.1 Die gesellschaftspolitische Präsenz und Akzeptanz des weiblichen Bürgerrechts
Im Verlaufe des 19. Jahrhunderts hatte sich in Hamburg gezeigt, daß die wirtschaftliche Struktur und die politischen Bedingungen der Stadt nicht mehr als modern angesehen werden konnten und den Bedürfnissen der Zeit entgegenstanden. Während der Revolutionszeit von 1848/49 gab es demzufolge sowohl Bestrebungen, die äußeren wirtschaftlichen Strukturen zu ändern, was vor allem die Abschaffung des Zunftwesens und die Proklamation der Gewerbefreiheit betraf, als auch solche, die Verfassung zu reformieren und die Form der politischen Mitbestimmung zu demokratisieren.
Diese allgemeine Aufbruchstimmung veranlaßte auch Frauen dazu, die politische Integration zu fordern und auf die wirtschaftliche Situation der Frauen aufmerksam zu machen.
Bekanntestes Beispiel dafür ist auf nationaler Ebene Louise Otto, die in ihrer Frauenzeitung unter dem Motto "Dem Reich der Freiheit werb′ ich Bürgerinnen" für die Rechte und Sorgen der Frauen eintrat. Sie propagierte deren wirtschaftliche Gleichstellung und kritisierte die Ignoranz der demokratischen Bewegung gegenüber weiblichen Rechten.206
Bei der Frankfurter Nationalversammlung wurden Frauen als Zuschauer zugelassen. Daß die Frauen auf diese Weise als Teil der politisch interessierten und motivierten Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen wurden, führte jedoch nicht dazu, eine mögliche Beteiligung der Frauen an den politischen und staatsbürgerlichen Rechten und Pflichten auch nur im Ansatz zu diskutieren, was Louise Otto in ihrem Aufsatz "Die Freiheit ist unteilbar" zu der Feststellung veranlaßte: "Wo sie [die nach Freiheit, d. h. Demokratie strebenden Männer] das Volk meinen, da zählen die Frauen nicht mit".207
Das Ziel der politischen Partizipation durch den Erhalt voller staatsbürgerlicher Rechte war bei Louise Otto schon 1849 in der Agitation verankert, doch entsprach sie damit nicht dem allgemeinen Selbstverständnis der deutschen Frauen, nicht einmal dem der aktiven Frauen. Trotzdem ergibt sich im Zusammenhang mit der Bedeutung des Bürgerrechts für Frauen die Frage, ob die demokratische Bewegung der Revolution sich auch auf das Selbstverständnis Hamburger Bürgerinnen auswirkte.
Die meisten Frauen, die sich um die Mitte des 19. Jahrhunderts in öffentlichen Belangen engagierten, beschränkten ihr Engagement auf anerkannte weibliche Fähigkeiten. In Hamburg wurde dies in zwei Bereichen besonders deutlich: Zum einen durch die Art der Einbindung von Frauen in die sich um die Mitte des 19. Jahrhunderts bildenden Bürgervereine und zum anderen bei der Arbeit der selbständig von Frauen ins Leben gerufenen Initiativen. Bei beiden lassen sich jedoch Ansätze der Einbeziehung von Frauen in staatsbürgerliche Belange feststellen.
5.1.1 Hamburger Bürgervereine
In einer wirtschaftlich florierenden und ständig wachsenden Stadt wie Hamburg, in der der Anteil der Bürger ohne eigenen Grund und Boden immer höher wurde, bedeutete dies, daß die absolute bürgerliche Beteiligung an politischen Entscheidungen der Stadt äußerst gering war. 1848 lebten nach einer amtlichen Aufstellung 93.000 erwachsene Einwohner im hamburgischen Stadtgebiet (ohne Vorstädte) von denen 27.000 das Bürgerrecht besaßen. Die Anzahl der in der Stadt zur Verfügung stehenden Grundstücke belief sich auf ca. 7.000. Da jedoch ein Teil der Bürger mehrere Grundstücke besaß, aber nur eine Stimme hatte, das Stimmrecht von Bürgern, deren Grundstück verschuldet war, ruhte und Frauen, auch wenn sie Grundeigentümerinnen waren, generell die politische Partizipation verwehrt war, blieben letztlich 3.000 - 4.000 erbgesessene Bürger übrig, die das Recht der politischen Partizipation in Anspruch nehmen konnten. An den Konventen selbst nahmen aber nur 200 bis 300 erbgesessene Bürger teil, die über die Angelegenheiten aller Hamburger Einwohner und der der Landgebiete (ca. 42.000) entschieden, ohne von den Einwohnern, ja nicht einmal von den nicht erbgesessenen Bürgern dafür legitimiert zu sein.208
Um die Interessen der Bürger wahrzunehmen, bildeten sich Bürgervereine, die zumeist lokal begrenzt waren und für ihren Stadtteil versuchten, Probleme zu diskutieren und zu beheben. Sie standen mit dem Ziel, "Verbesserungen" innerhalb des Systems durchzusetzen, sprich Reformen zu erwirken, in der Tradition des sich seit der Aufklärung ausweitenden Vereinswesens in Hamburg.209 Einige der in den 40er Jahren gegründeten Bürgervereine traten für die Einbeziehung größerer Teile der Bevölkerung in den politischen Entscheidungsprozeß ein. Als erster politisch motivierter Verein etablierte sich 1843 der "St.-Pauli-Bürgerverein", der unter anderem zum Ziel hatte, auf gesetzlichem Wege politische Bürgerinteressen als Reformen durchzusetzen.210 Weitaus konkreter war der am 3.8.1848 gegründete "Hamburger Bürgerverein".
Dessen Mitgliederschaft setzte sich überwiegend aus dem unteren Mittelstand und Handwerkern zusammen. Ziel war es, auf eine neue Verfassung hinzuarbeiten, die "...die Teilnahme jedes Hamburger Bürgers am Staatsregimente, am Richteramte, die Möglichkeit zu allen Staatsämtern zu gelangen, und völlige Gleichheit der Besteuerung für alle..." gewährleistete, für ein "... freies, politisch und moralisch gebildetes Staatsbürgertum".211
Obwohl sich die Forderung der Teilnahme jedes Bürgers, wie allgemein in Deutschland, nur auf die männlichen Bürger bezogen, gab es in Hamburg den Ansatz, Frauen wenigstens innerhalb eines Bürgervereins zu politischen Fragen Stellung nehmen zu lassen.
Der Hamburger Bürgerverein hatte 1848 in Erwägung gezogen, auch Frauen zu den politischen Versammlungen zuzulassen, was bedeutet hätte, sie als verantwortungstragende Bürgerinnen anzuerkennen, auch wenn sie kein Wahlrecht hatten. Während der Debatte zu diesem Thema auf dem Stiftungsfest des Vereins am 27. August 1848 gingen die Meinungen über die Beteiligung der Frauen an den Versammlungen auseinander. Als zwei Wochen später der Antrag auf Zulassung abgestimmt wurde, konnten sich die fortschrittlichen Kräfte nicht durchsetzen. Der Antrag wurde abgelehnt212 und eine Chance der zumindest internen politischen Partizipation, d.h. eine Möglichkeit für Frauen, ihrem politischen Verlangen innerhalb politisch aktiver Organisationen Ausdruck zu verleihen oder zumindest an den Geschehnissen der Tagespolitik teilzunehmen, war vertan. Dies kritisierte auch Emilie Wüstenfeld, eine der aktivsten Hamburger Frauen des 19. Jahrhunderts:
"Während andere Städte, wie Leipzig, Frankfurt usw., die die Angelegenheiten des Vaterlandes doch wenigstens in Gegenwart der Frauen verhandeln und diesen deshalb die Tribünen freudig anweisen, hält man bei uns in Hamburg jede derartige Maßregel für höchst überflüssig, wenn nicht gar töricht."213
Die wenigen fortschrittlichen Bürger konnten sich gegen die, in bezug auf die Rolle der Frau in der Gesellschaft, konservativen Kräfte unter den Liberalen nicht durchsetzen.
Die Beteiligung der Bürgersfrauen am Vereinsleben beschränkte sich somit weiterhin auf soziales und geselliges Engagement. Frauen waren als Ausrichterinnen wohltätiger Veranstaltungen gern gesehen und wurden bei sozialen Unternehmungen wie der Einrichtung von Bürgerkindergärten integriert.214
Nachdem die Reformversuche Hamburger Bürger vom Senat abgewehrt wurden, verebbte die politische Ausdrucksfähigkeit der Vereine. Der "St.-Pauli-Bürgerverein" erlegte sich selbst einen rein sozialen Charakter auf. Anfang Oktober 1849 forderte der Vizepräses, wegen der momentanen politischen Situation den politischen Charakter des Vereins aufzugeben, und die Generalversammlung beschloß zwei Wochen später einen reinen Unterhaltungscharakter des Vereins.215 Die Bürgervereine waren als reformpolitisches Forum auch für die männlichen Bürger vorerst verstummt. Der "Hamburger Bürgerverein" überlebte, ebenso wie andere in dieser Zeit entstandenen Vereine, diese Phase nicht.216
Bürgervereine hatten sich nicht als Basis erwiesen, auf der Bürgerinnen ihre Anliegen vorbringen konnten. Dies verwundert nicht, da ein öffentliches Engagement der Frauen um die Mitte des 19. Jahrhunderts als nicht dem Weiblichen entsprechend angesehen wurde, und eine durch Männer bewirkte Integration von Frauen in politische Zirkel bedeutet hätte, daß die Mehrheit der Vereinsmitglieder schon ein Bewußtsein für Frauenfragen entwickelt haben müßte. Frauen hingen, bezüglich ihrer Teilnahme an den politischen Versammlungen des Bürgervereins, von der Entscheidung der Männer ab.
5.1.2 Bürgerliche Rechte und weibliches Engagement in Hamburg um 1850
Doch es gab auch in Hamburg Frauen, die im Rahmen reformerischer Entwicklungen für die Emanzipation des weiblichen Geschlechts eintraten.
Es sind vor allem drei Namen und eine öffentliche Einrichtung, die um die Mitte des 19. Jahrhunderts mit weiblicher Öffentlichkeit in Hamburg in Verbindung gebracht werden: Amalie Sieveking (1794-1859), Charlotte Paulsen (1798-1862), Emilie Wüstenfeld (1817-1874) und die "Hamburger Hochschule für das weibliche Geschlecht" (1850-1852).
Für die Frage nach dem politischen Bewußtsein in Verbindung mit dem Bürgerrecht der Frauen in dieser Zeit ist Amalie Sieveking nur insofern von Bedeutung, als sie den Typus der engagierten bürgerlichen Frau ihrer Zeit verkörpert. Sie stand für die Frauen, denen es bewußt war, daß gerade bürgerliche Frauen neue Tätigkeitsfelder brauchten und dafür auch in die Öffentlichkeit treten mußten. Emanzipation bedeutete für sie, die politische Aktivitäten ablehnte, obwohl sie eine politische Meinung hatte, das Engagement von Frauen im sozialen Bereich.217
Seit den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts leitete Amalie Sieveking den von ihr ins Leben gerufenen "Weiblichen Verein zur Armen- und Krankenpflege". Er war das Ergebnis der Erfahrungen, die sie durch ihren Hospitaldienst während der Choleraepidemie in Hamburg 1831 gemacht hatte.218 Ihr Engagement, das sehr stark religiös geprägt war, machte sie zur Begründerin der konfessionellen Wohlfahrtspflege in Verbindung mit weiblicher Vereinstätigkeit. Sicherlich bestimmte Amalie Sievekings eigener Lebensweg ihr Eintreten für die Betätigung von Frauen außerhalb des häuslichen Bereichs. Als Kaufmanns- und Senatorentochter gehörte sie der typischen Hamburger Oberschicht an und hätte eigentlich ein sorgenfreies Leben führen sollen und können. Doch ihre Eltern starben, als sie noch ein Kind war, und das Vermögen ihres Vaters war in der wirtschaftlichen Krisenzeit der französischen Besatzung verloren gegangen. Dies führte dazu, daß Amalie Sieveking darauf angewiesen war, sich zum Teil selbst zu ernähren, ein Schicksal, das sonst eher Mittelstandstöchter traf. Neben einer kleinen Rente aus dem Fond für Senatorentöchter verdiente sie sich ihren Unterhalt durch Stickarbeiten.219
Trotz der eigenen Erfahrung, sich selbst versorgen zu müssen, beschränkten sich Amalie Sievekings Forderungen auf die ehrenamtliche Arbeit von Frauen in der Armen- und Jugendfürsorge sowie der Krankenpflege. Die Problematik der wirtschaftlichen Unabhängigkeit von bürgerlichen Frauen thematisierte sie nicht.
Anders motiviert war Charlotte Paulsen, geb. Thornton, die wie Amalie Sieveking aus großbürgerlichen Kreisen stammte und ebenfalls in der Wohlfahrtspflege engagiert war. Zwar hatte auch ihre Familie finanziell unter der ′Franzosenzeit′ gelitten, aber dadurch, daß ihre Eltern noch lebten und ihre Kontakte nutzten, konnte Charlottes Existenz gesichert werden, indem sie den 20 Jahre älteren Makler Paulsen heiratete. Erst in relativ hohem Alter begann sie, sich mit dem Lebenssinn und -zweck der bürgerlichen Frauen auseinanderzusetzen und die Jugend- und Armenpflege als Betätigungsfeld für Frauen wahrzunehmen. 1844 wandte sie sich deshalb an Amalie Sieveking, um mit ihr gemeinsam zu arbeiten, aber diese lehnte die Zusammenarbeit ab, weil Charlotte Paulsen ihr als zu "freisinnig" erschien220, was sich sowohl auf Paulsens politische Haltung bezogen haben kann wie auch auf ihr religiöses Engagement. Erst durch die Gründung des unkonfessionellen Pestalozzistifts zur Erziehung verwahrloster Kinder 1847 in Billwerder bot sich für Charlotte Paulsen die Möglichkeit der aktiven Wohltätigkeitsarbeit. Gleichzeitig war sie in der religiösen Reformbewegung der deutsch-katholischen Gemeinde aktiv, die 1846 auch in Hamburg gegründet worden war.221
Innerhalb der deutsch-katholischen Gemeinde hatten sich Charlotte Paulsen und Emilie Wüstenfeld kennengelernt und gründeten 1849 schließlich den "Frauenverein zur Unterstützung der Armenpflege", der sich wesentlich von Amalie Sievekings Verein unterschied.
Während Amalie Sieveking Almosen als Unterstützung der Armen begriff, richtete sich der Verein von Paulsen und Wüstenfeld auf die Hilfe zur Selbsthilfe. Die gleichzeitige Verbreitung christlicher Weltanschauungen war nicht Gegenstand des Vereins. Auch unter den Mitgliedern sollte es möglichst unkonventionell zugehen und Standesschranken der Aktiven untereinander überwunden werden. Das Engagement im sozialen Bereich bot den Frauen die Möglichkeit, öffentlich aktiv zu werden. Es war eine Art Ersatzberuf für Frauen, die aus finanziell gesicherten Verhältnissen kamen. Für solche, die trotz der eigenen Erwerbstätigkeit noch Zeit für die Versorgung der Armen fanden, wie die Witwe Havemann, die ihre holländische Warenhandlung zur Verfügung stellte, um von den Frauen gefertigte Wäsche zur finanziellen Unterstützung des Vereins in ihrem Geschäft zu verkaufen222, war es eine zusätzliche Belastung aus sozialem Verantwortungsbewußtsein.
Das Beispiel der Frau Havemann, die Marie Kortmann in der Biographie über Emilie Wüstenfeld als selbst "in bescheidensten Verhältnissen"223 lebend beschrieb, läßt vermuten, daß die Schwierigkeiten der Selbstversorgung von Ledigen und Witwen bei den aktiven bürgerlichen Frauen bekannt waren.
Auch die mit der Gewinnung des Bürgerrechts in Verbindung stehenden Probleme waren den Frauen des Vereins vertraut, denn Kortmann berichtet:
"Manchem in wilder Ehe lebenden Paar wurde das Geld für die Erwerbung des Bürgerrechts gegeben, ohne das die Eheschließung nicht möglich war.(...) ein Mann erhielt eine Anstellung und hat sich, Bürger geworden, mit einer Person verbunden, mit der er in wilder Ehe lebte, worauf er durch Verwendung der Vorstandsfrau die Bürgeruniform erhielt. Im Bezirk Stadtdeich unter der Vorstandsfrau Amalie Schoppe (...) unterstützte der Verein ein im tiefsten Elend in wilder Ehe lebendes Paar, schenkte dem Mann das Geld zum Bürgerwerden, worauf Herr Prediger Regedanz sie gratis traute."224
Die Gegebenheit, daß sich innerhalb des Vereins Mitglieder befanden, die sich selbst versorgen mußten, sowie die Bestrebungen des Vereins, das Bürgerrecht für diejenigen zu ermöglichen, die auf Grund ihres geringen Einkommens nicht in der Lage waren, die Kosten dafür aufzubringen, folglich nicht heiraten konnten, weisen darauf hin, daß die generelle Problematik der Bürgerrechtsgewinnung auch für Frauen bekannt gewesen sein muß. Es findet sich jedoch kein Hinweis darauf, daß ledigen Frauen dazu verholfen wurde, das Bürgerrecht für eine Existenzgründung zu erwerben.
Doch die Struktur und die Dissidenten der deutsch-katholischen Gemeinde an sich trugen ihren Teil zur Ausprägung des sozialen und politischen Bewußtseins der Frauen bei.
Es war vor allem Johannes Ronge, der hoch verehrte Prediger der freireligiösen Bewegung, der die Frauen zur Mitarbeit aufrief und sie motivierte, aktiv in den Diskurs um die sozialen Belange einzutreten. Er propagierte besonders die Bildung von Frauenvereinen, die den Deutschkatholizismus unterstützen sollten. Diese entwickelten sich zu einer kollektiven Bewegung, wobei der 1846 von Emilie Wüstenfeld und Bertha Traun gegründete Frauenverein, der die Deutschkatholiken in Hamburg unterstützte, besonders aktiv war.225
Die freien deutsch-katholischen Gemeinden zeichneten sich jedoch auch intern als besonders demokratisch im Vergleich zu anderen Vereinigungen aus.
In den freireligiösen Gemeinden existierte das aktive Wahlrecht für Frauen, was in den meisten Gemeinden zunächst jedoch auf die alleinstehenden weiblichen Mitglieder und Frauen, die ohne ihren Ehemann Mitglied der Gemeinde waren, beschränkt war. Verheiratete Paare hatten nur eine Stimme und es kam dem Mann zu, sie bei Gemeindeangelegenheiten in die Waagschale zu werfen. Natürlich war das Frauenwahlrecht auch in den freien Gemeinden keine Selbstverständlichkeit. Vor allem im Süden Deutschlands stieß es auf Kritik und wurde in vielen Gemeinden zeitweise wieder abgeschafft, konnte sich aber später in den meisten Gemeinden durchsetzen und wurde vielerorts auch auf die Frauen ausgeweitet, deren Männer ebenfalls Gemeindemitglieder waren. Während der Schlesischen Synode 1850 wurde nach einer schwierigen Diskussion den Frauen auch das passive Wahlrecht für alle Gemeindeämter zuerkannt.226
Diese Haltung der freien Gemeinden führte auch dazu, daß die von den Frauen gegründeten und organisierten Hilfsvereine zur Unterstützung der Gemeinden eine praktische Übung der Initiatorinnen in Demokratie waren.227 Die Gemeindearbeit stellte somit eine "ideale Plattform für den Beginn der Frauenemanzipation" dar.228
Die Aktivitäten und Ansprüche blieben dementsprechend nicht auf das Gemeindeleben beschränkt. Die von den Frauen im Zusammenhang mit den Gemeinden begründeteten Vereine waren der erste Schritt zur Übertragung der Ansprüche in den gesellschaftlich-öffentlichen Raum.
5.1.3 Die Hamburger Frauenhochschule
Aus der Gemeinde und vor allem der Aktivität ihrer weiblichen Mitglieder ging 1850 die "Hamburger Hochschule für das weibliche Geschlecht" hervor, wesentlich gefördert durch Emilie Wüstenfeld. Sie war eine der aktivsten Hamburger Frauen, die sowohl den Frauenhilfsverein der deutsch-katholischen Gemeinde mitbegründet hatte als auch den "Frauenverein zur Unterstützung der Armenpflege". Sie war es vor allem, die den Anspruch auf Emanzipation der Frauen in Hamburg auf verschiedenen Ebenen umzusetzen versuchte.
Geboren wurde sie als Marie Emilie Capelle in Hannover, war aber 1841 als 24jährige zusammen mit ihrem Mann, dem Kaufmann Julius Wüstenfeld, nach Hamburg gekommen und lebte hier bis zu ihrem Tod 1874.
Beeinflußt durch die Konzepte der deutsch-katholischen Gemeinden und bestärkt durch die moralische Unterstützung Johannes Ronges und die pädagogischen Initiativen Friedrich und Karl Fröbels entwickelte sie mit Berta Traun den Plan, eine "Hochschule für das weibliche Geschlecht" in Hamburg zu schaffen. Emilie Wüstenfeld sorgte dafür, daß Karl Fröbel, der in Zürich mit der Verwirklichung einer solchen Hochschule gescheitert war, zusammen mit seiner Frau Johanna, geb. Küstner, nach Hamburg kam. Gleichzeitig wurde der "Hamburger Bildungsverein deutscher Frauen" gegründet, der durch Spendeneinnahmen und Aktienverkauf die finanzielle Absicherung der Schule garantieren sollte.229
Die Hochschule eröffnete am 1. Januar 1850 den Lehrbetrieb. Der Stundenplan veranschaulicht die Intention der Pädagogen. Neben schulischen Fächern wie Geschichte, Englisch, Zeichnen, französische Schriftsteller und deutsche Dichter wurde auch Physik sowie astronomische und politische Geographie gelehrt, Lernstoff, der für Mädchen oder in diesem Fall Frauen nicht üblich war. Zusätzlich war der Unterricht praktisch ausgerichtet.230 Im angrenzenden Kindergarten wurden die Frauen praktisch in Erziehung unterwiesen, was die theoretische Erziehungslehre unterstützte. Karl Fröbel selbst bezeichnete die Schule, auch wenn sie Hochschule genannt wurde, als eine Ausbildungstätte für Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen.231 Damit deckte sie das Feld ab, daß ihr innerhalb der gesellschaftlichen Verhältnisse und dem Selbstverständnis der engagierten Frauen möglich war. Sie schuf zum einen eine bessere Allgemeinbildung für alle Frauen und ermöglichte zum anderen denen, die nicht heirateten, ein Art Berufsausbildung.
Denn so fortschrittlich Emilie Wüstenfeld und die anderen Frauen der Hochschule in ihrer Zeit auch waren und so groß das Engagement, das sie in den vielfältigsten Vereinigungen entfalteten, so eng waren doch die Grenzen der gesellschaftlichen Akzeptanz, in denen sich die öffentlich aktiven Frauen damals bewegten. Daher war es auch Emilie Wüstenfelds vorrangiges Ziel, die Bildung der Frauen zu verbessern, um den generellen Ansprüchen als Hausfrau und Mutter besser gerecht zu werden. Sie schloß darin allerdings ein, daß Frauen sich mit politischen Fragen auseinandersetzen sollten, um ihrer Rolle als Hausmutter und unterhaltende Gastgeberin gerecht werden zu können, und sie hoffte darauf, daß die Zeit den Frauen weitere Entfaltungsmöglichkeiten bringen würde.232
Die Hamburger Frauenhochschule war aber von der personellen Besetzung her eng an die deutsch-katholische Gemeinde angelehnt. Viele durch die Ziele der niedergeschlagenen Revolution beeinflußte Personen fanden sich in ihr ein, um neue sozialpolitische Wege zu gehen. Zu ihnen gehörte z.B. Theodor Althaus, der nur kurze Zeit als Lehrer an der konfessionsfreien Schule der Gemeinde agieren konnte, weil der Hamburger Senat ihm das Bürgerrecht verweigerte und er die Stadt verlassen mußte. Althaus hatte wegen Hochverrats im Gefängnis gesessen und der Senat sah sich aus politischen Gründen nicht in der Lage, ihm in Hamburg die Ausübung eines Berufs zu gestatten.
Am bekanntesten unter den Akteuren der Hochschule ist jedoch Malwida von Meysenbug, die zunächst als Schülerin an die Hochschule kam, doch schon nach kurzer Zeit die Pension leitete und in verschiedenen Gremien der freien Gemeinde saß. Sie gehörte zu den Frauen, die am stärksten von den Idealen der Revolution geprägt waren und die 1848 in Frankfurt die Debatten des Vorparlaments in der Pauslkirche verfolgt hatte. Diese Ideale versuchte sie, innerhalb der Hochschule zu leben und veranschaulichte dies eindringlich und sehr persönlich in ihren Memoiren.233 Malwida von Meysenbug war mit Theodor Althaus befreundet und mit Carl Volkhausen, den sie, wie Althaus, aus Detmold kannte und der, weil er in Lippe keine Lehrerlaubnis mehr erhielt, nach Althaus die Hamburger Gemeindeschule leitete. Auch in Hamburg schloß Malwida von Meysenbug schnell Freundschaften, vor allem mit Emilie Wüstenfeld, aber auch mit dem Lehrer Anton Rée, einem Demokraten, der in Hamburg für die Gleichberechtigung der Juden stritt, im Rahmen der revolutionären Bewegung 1848 Mitglied der Konstituante gewesen war und zu Beginn der 1860er Jahre, als die Gewerbefreiheit und das Bürgerrecht verhandelt wurden, Mitglied der Bürgerschaft war.234 Alle diese Beziehungen waren geprägt durch eine gemeinsame humanistische Grundhaltung, gepaart mit dem Bestreben, die soziale Situation, sowohl in bezug auf Religions- und Klassenunterschiede wie auch in bezug auf die Teilnahme von Frauen im öffentlichen Leben, zu verbessern. Twellmann berichtet, daß die deutsch-katholische Gemeinde sogar das politische Bürgerrecht für Frauen in Hamburg forderte, gibt jedoch keine Quelle an.235
Die Hamburger Frauenhochschule galt im 19. Jahrhundert und gilt noch heute in der Forschung als eine der Errungenschaften der frühen Frauenbewegung. Mit Fortschreiten der Einflüsse der Reaktion auch in Hamburg wurde die Kritik an der Hochschule immer größer und die finanzielle Basis der Schule immer brüchiger. Der Vorstand entschloß sich schließlich das Projekt ′freiwillig′ aufzugeben, bevor es von staatlicher Seite unterbunden wurde, "... um zu beweisen, daß die Schließung der Schule nicht die Folge eines falschen Prinzips war, sondern der ungenügenden materiellen Mittel."236
Trotz der Niederlage verstand Malwida von Meysenbug die Hochschule als Ausgangspunkt für die Emanzipation der Frauen und drückt dies in dem wohl am häufigsten zitierten Abschnitt ihrer Memoiren so aus:
"Der Gedanke, die Frau zur völligen Freiheit der geistigen Entwicklung, der ökonomischen Unabhändigkeit und zum Besitz der bürgerlichen Rechte zu führen, war in die Bahn zur Verwirklichung getreten; dieser Gedanke konnte nicht wieder sterben."237
Wie alle reformerischen Bewegungen war auch die Frauenbewegung von dem konservativen politischen Klima betroffen und konnte sich im folgenden Jahrzehnt nicht stabilisieren und weiterentwickeln. Erst 1865 wurde die verbandspolitische Organisation der Frauenbewegung durch die Gründung des "Allgemeinen Deutschen Frauenvereins" in Angriff genommen. Die Frauenbewegung setzte 1865 da an, wo sie zu Beginn der 50er Jahre steckengeblieben war. Im Vordergrund stand die Verbesserung der Ausbildungs- und Erwerbschancen von mittelständischen Frauen. Politische Partizipation war zu diesem Zeitpunkt noch nicht Gegenstand der Emanzipationsbestrebungen.238
Es bleibt für die abschließende Untersuchung der Diskussion um die Aufhebung des weiblichen Bürgerrechts festzuhalten, daß weibliche Berufstätigkeit und Ausbildung von mittelständischen Frauen durchaus ein Thema in der Hamburger Bewegung war, daß sich der Spielraum jedoch eng an den standesgemäßen Tätigkeiten orientierte. Ein erneuter Vorstoß wurde 1860 in Hamburg von Johanna Goldschmidt vorgenommen, die den "Fröbelverein" gründete, in dem Mädchen aus dem Mittelstand zur Kindergärtnerin ausgebildet wurden.239
Das Bürgerrecht wurde zwar schon in den 1840er Jahren als für junge Paare schwer zu nehmende Hürde wahrgenommen, daß es aber auch als Ausgangspunkt für selbständige Arbeit von Frauen begriffen wurde, konnte nicht nachgewiesen werden. Die Entwicklung der Frauenbewegung und Frauenvereine in Hamburg war weder organisatorisch noch inhaltlich so weit entwickelt, daß aktive Einflußnahme auf die sozial- und wirtschaftspolitischen Aktivitäten von Senat und Bürgerschaft zur Erreichung ihrer Ziele eine Rolle spielte. Die Frauenbewegung beschränkte sich auf privates Engagement zur Entwicklung und Ausführung ihrer Projekte und hoffte auf Spenden, um sie durchführen zu können. Sie setzte darauf, daß sich durch diese Aktivitäten das Bewußtsein für weibliche Probleme in der Gesellschaft schärfte.
5.2 Frauen, politisches Bürgerrecht und Gewerbefreiheit
5.2.1 Allgemeine Diskussion um die Gewerbefreiheit und das Bürgerrecht
Bestrebungen zur Einführung der Gewerbefreiheit oder einer Gewerbeordnung, die die Privilegien der Ämter verringert, hatte es in Hamburg schon seit den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts gegeben. Der Gesellenstreik von 1791 löste die Frage nach der Berechtigung der Zünfte aus, so daß die ′Patriotische Gesellschaft′240 eine Preisfrage ausschrieb, ob die Zünfte abzuschaffen seien oder nicht.
Während der ′Franzosenzeit′ gab es dann die Gewerbefreiheit, weil das Ausserkraftsetzen der hamburgischen Verfassung gleichzeitig die Aufhebung der Ämter und Brüderschaften zur Folge hatte. Als Hamburg nach dem Abzug der Franzosen zu seiner Verfassung zurückkehrte, wurde die Gewerbefreiheit Schritt für Schritt eingeschränkt. Befürworter der Zünfte in der Bürgerschaft stellten sich den gewerbefreiheitlichen Bestrebungen der Großkaufmannschaft entgegen, so daß bei Erlaß des "General-Reglements für die hamburgischen Aemter und Brüderschaften" 1835 wieder 38 vom Rat anerkannte Ämter und Brüderschaften existierten.241
Das erneute Einsetzen des "Kampfes um die Gewerbefreiheit", wie Kwiet sich ausdrückte, fand 1861 auf zwei Ebenen statt.
Zum einen forderte der Antrag Dr. Gallois′ in der Bürgerschaft die Aufhebung der Zünfte. In zwei sich daran anlehnenden Untersuchungen durch die von der Patriotischen Gesellschaft ernannte "Commission zur Untersuchung der Gewerbeverhältnisse in Hamburg" und den "Ausschuß zur Prüfung einiger die Gewerbefrage betreffenden Anträge" wurde die Frage der Zeitgemäßheit der Zünfte detailliert untersucht.242 Zum anderen erließ der Senat am 27. Februar 1861 ein Dekret, in dem er Senator Gossler und Syndikus Merck beauftratge, kommissarisch zu beraten, unter welchen Bedingungen Fremde in Hamburg ein Gewerbe treiben können, ohne in den städtischen Nexus treten zu müssen.243 Diese Überlegungen zur Gewerbefreiheit und Freizügigkeit führten dazu, daß nicht nur ein Gewerbegesetz erlassen wurde, sondern auch das Bürgerrecht vollständig revidiert wurde.
Der 1861 eingesetzte Ausschuß zur Erörterung der Frage der Gewerbefreiheit und eines Gewerbegesetzes sprach sich im Juni 1861 für die Einführung eines Gewerbegesetzes aus. Nachdem ein Gesetzentwurf ausgearbeitet war, wurde im Oktober 1861 beschlossen, den Gesetzentwurf zur Mitgenehmigung dem Senat vorzulegen und gleichzeitig den Senat zu ersuchen, die durch die Zünfte beschränkten Gewerbe im Sinne der Gewerbefreiheit zu revidieren und in diesem Zusammenhang die Frage der Entschädigung der Realgerechtsame zu diskutieren. Schließlich forderte er auch, die schon lange erwogene Revision des Bürgerrechts zeitgleich mit dem Gewerbegesetz in Angriff zu nehmen.244
Zwar hatte es schon am 24. April 1856 einen Beschluß über die Revision der Verordnungen über das Bürgerrecht von 1845 wie über das Heimatrecht und die Schutzverwandtschaft von 1843 gegeben, doch waren diese Revisionen bisher nicht in Angriff genommen worden. Erst in Zusammenhang mit der Vorlage eines Gewerbegesetzentwurfs erschien die Reform unumgänglich. Sie war eine prophylaktische Maßnahme, um eventuellen Armutsproblemen, die sich nach Einführung von Gewerbefreiheit und Freizügigkeit ergeben könnten, zu begegnen und die Fürsorgepflicht des hamburgischen Staates zu begrenzen.
Bei den Berichterstattungen des Ausschusses über den Gesetzentwurf in der Bürgerschaft seit Februar 1862 wurde der wesentliche Paragraph des Gewerbegesetzes, in dem der Umfang der Gewerbefreiheit bestimmt wurde, so vorgestellt, wie er auch in der endgültigen Fassung formuliert wurde.
"Der selbständige Betrieb eines oder mehrerer Gewerbe steht ohne Unterschied des Geschlechtes jedem volljährigen oder für volljährig erklärten Angehörigen des Hamburgischen Staates ohne Beschränkung in der Wahl des Ortes frei, mit Vorbehalt der Bestimmungen in den §§ 3 und 4."245
Dabei beziehen sich die §§ 3 und 4 auf Gewerbe, für die eine polizeiliche Genehmigung erforderlich war, wie dem Hausierhandel oder dem Betreiben einer Schenkwirtschaft und auf Berufe, deren Betreiber eine andere Konzession benötigten, wie Ärzte und Hebammen, Makler, Notare, Advokaten und Vorsteher von Lehr- und Erziehungsanstalten.
Otto F. Nagel brachte zusätzlich den Antrag ein, auch in das Gesetz zur Gewerbefreiheit die Bürgerrechtspflicht der Gewerbetreibenden aufzunehmen. Danach wäre die Ausübung eines oder mehrerer Gewerbe, ohne Beschränkung des Ortes und unabhängig vom Geschlecht, jedem zugestanden worden, der das hamburgische Bürgerrecht erworben hatte.246
Diese Form der Gewerbefreiheit hätte die Bürgerrechtspflicht von Frauen nicht beeinflußt. Sie wurde beispielsweise in Bremen praktiziert, wo auch nach Einführung der Gewerbefreiheit die Verpflichtung zum Bürgerrecht bestehen blieb. Lediglich das große Bürgerrecht, also das Bürgerrecht mit Handelsfreiheit, wurde abgeschafft. Es konnte sich danach in Bremen nach Aufhebung der gewerblichen Privilegien 1861 jeder zu einem Gewerbe niederlassen, er mußte dazu aber das Bürgerrecht gewinnen. In Bremen existierte dementsprechend nach Einführung der Gewerbefreiheit nur noch eine Form des Gemeindebürgerrechts, dessen Erwerb für Nichtbremer allerdings teurer war als für heimatberechtigte Bremer. Frauen mußten ebenso wie Männer weiterhin das Bürgerrecht erwerben.247
In Lübeck wurde die Verpflichtung zum Bürgerrecht mit Einführung eines Gewerbegesetzes ebenfalls nicht aufgegeben. Für das Betreiben eines Geschäfts war nach dem Gesetz über Staatsangehörigkeit, Staatsbürgerrecht und Schutzgenossenschaft weiterhin entweder das Bürgerrecht notwendig oder, bei Nichtstaatsangehörigen, die Schutzgenossenschaft, die der hamburgischen Schutzverwandtschaft entsprach. Art. 7 des Gesetzes berechtigte jedoch nur männliche volljährige Staatsangehörige zum Staatsbürgerrecht, so daß davon auszugehen ist, daß Frauen zum selbständigen Erwerb die Schutzgenossenschaft gewinnen mußten.248
Hamburg ging einen anderen Weg. Der Antrag von Nagel wurde abgelehnt und die Fassung des Gesetzentwurfs, in der es keinen Verweis auf die Bürgerrechtspflicht gab, wurde angenommen. Gleichzeitig wurde beschlossen, mit der Gewerbefreiheit die Bedingungen der Staatsangehörigkeit und die Betreibung von Gewerben durch Nichtstaatsangehörige neu festzulegen.249
Diese Entwicklung wurde in der Bremer Presse gelobt. Dort sah man durch die Loslösung des Bürgerrechts von wirtschaftlichen Rechten die Chance für eine starke wirtschaftliche Belebung Hamburgs gegeben, während die Bremer Entscheidung, auch nach Aufhebung der Zünfte von jedem Selbständigen das Bürgerrecht zu verlangen, als "kurzsichtig" bewertet wurde.250 Dieser ′Sonderweg′ Hamburgs führte schließlich zur Aufhebung des weiblichen Bürgerrechts.
Parallel zu den Debatten um Gewerbefreiheit und Bürgerrecht in Hamburg wurde ein Gesetz über den Erwerb von Grundeigentum verhandelt und 1863 erlassen. Es billigte den Erwerb von Grundstücken nicht mehr nur Bürgern zu, sondern allen Angehörigen der Staaten des Deutschen Bundes.251
Bei den Verhandlungen zum Bürgerrecht standen also noch die Verpflichtung des Erwerbs beim Heiraten und zur Ausübung politischer Rechte als Gegenstand des Bürgerrechts zur Debatte. Der ausgearbeitete Gesetzentwurf wurde erst im Januar und Februar 1864 in der Bürgerschaft diskutiert. Grund dafür war, daß die Einführung eines Gewerbegesetzes mittlerweile zu einem Gesetzespaket angewachsen war, denn es mußte bei der Aufhebung der zünftigen Privilegien die Entschädigung der Inhaber von Realgerechtigkeiten, also den Ämtern, deren Anzahl begrenzt war und die von ihren Inhabern teuer erkauft worden waren, in einem externen Gesetz geregelt werden. Das Gesetz über die Staatsangehörigkeit und das Bürgerrecht wurde deshalb erst spät verhandelt.
Die Änderung des Bürgerrechts führte dabei zu heftigen Diskussionen. Es war aber nicht die Abtrennung der wirtschaftlichen Rechte vom Bürgerrecht, die zu unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Bürgerschaft führte. Die von Baumeister, dem Berichterstatter des Ausschusses, am 27.1.1864 vorgetragene Ansicht, daß mit der Loslösung der wirtschaftlichen und sozialen Aspekte vom Bürgerrechtserwerb das Bürgerrecht auf seinen "wahren Inhalt: die politischen Rechte und Pflichten" reduziert würde, weil weder die Eheschließung noch die Ausübung eines Gewerbes in "innerem Zusammenhang" mit dem Bürgerrecht stünden, wurde allgemein anerkannt.252
Scharfe Auseinandersetzungen verursachte hingegen die Frage des Umfangs der politischen Beteiligung der Bewohner Hamburgs.
So forderte Rée für die demokratische Partei, daß, bei einer Reduzierung des Bürgerrechts, das Gemeindebürgerrecht vom Staatsbürgerrecht getrennt werden müsse und jeder Staatsangehörige gegen eine Stempelgebühr von 1 Mk zum Bürgereid und zur Ausübung politischer Rechte berechtigt sein solle. Er wurde von Kramer unterstützt, der es als eine Zumutung empfand, daß der Erwerb der Staatsangehörigkeit teurer sein sollte als bisher der Erwerb des kleinen Bürgerrechts und daß jemand, bevor er Bürger werden könnte, fünf Jahre in der Stadt gelebt haben müsste. Laut Verfassung vergingen dann nocheinmal drei Jahre bis er wählbar wäre, also erst nach acht Jahren für die Ausführung von bestimmten Ämtern zur Verfügung stände. Zusammen mit der Einkommensgrenze von 3000 Mk für die Bürgerrechtspflicht würde dies auf eine Führung Hamburgs durch ein Patriziat hinauslaufen, und die politischen Rechte würden "verkümmern".253
Rée und Kramer bezogen sich damit auf den §8 des vom Senat vorgelegten Gesetzentwurfs, der vorsah, daß alle Bürger, die ein jährliches Einkommen von 3000 Mk oder mehr zu versteuern hatten, verpflichtet waren, das Bürgerrecht zu gewinnen, während allen anderen Männern die Entscheidung frei stand. Der Senat begründete sein Vorgehen damit, daß eine generell freiwillige Entscheidung Bürger zu werden und an politischen Entscheidungen sowie der Ausführung öffentlicher Ämter teilzunehmen, ohne dazu verpflichtet zu sein, dazu führen könne, daß es einen Mangel an Männern gäbe, die sich dieser Verantwortung stellen würden. Während für kleine Einkommensgruppen der Erwerb des Bürgerrechts eine finanzielle Bürde sei, sei es für die hohen Einkommensklassen keine Belastung und könne somit als "Zwangspflicht" eingeführt werden.254
In der Bürgerschaft gab es verschiedene Anträge zur Änderung des Paragraphen, so den von Hertz, die Einkommensgrenze für den Zwang zum Bürgerrechtserwerb auf 500 Mk herunterzusetzen und den von Vivié, jeden, der ein Einkommen versteuert, zum Bürgerrecht zu verpflichten. Dies hätte bedeutet, daß der Kreis der Wähler dem entsprochen hätte, der auch seit der neuen Verfassung wahlberechtigt war. Baumeister dagegen bezeichnete es als "ungerecht und inconsequent", alle Männer zum Bürgerrecht zu zwingen, denn die Verfassung verpflichte zwar zur Annahme der Wahl und zur Ausübung von Ehrenämtern, aber es herrschte keine Wahlpflicht. Jeder könnte nach dem neuen Gesetz Bürger und damit Wähler werden, wenn er es wünschte.255 Der Bürgerschaftsausschuß beantragte am 3.2.1864, auch wegen der unterschiedlichen Haltung der Bürgerschaftsmitglieder, den Paragraphen nicht in das Gesetz aufzunehmen und gesetzlich über diese Frage erst zu entscheiden, wenn sich durch die "Erfahrungen über die Wirksamkeit des Gesetzes ein Bedürfnis ergeben hat".0 Dieser Antrag wurde in der Bürgerschaft angenommen, jedoch vom Senat nicht akzeptiert.
Letztlich setzte sich der Senat mit der Aufnahme des §8 durch, doch nicht ohne eine vorausgegangene heftige Auseinandersetzung um diesen Paragraphen.
Die Bestimmung und die Kosten für den Erwerb des Bürgerrechts mit Hinblick auf die Anzahl der wahlberechtigten Hamburger Bürger waren die Streitpunkte des neuen Gesetzes, die bis in den September 1864 für Diskussionen sorgten. Nicht nur zwischen den konservativen, liberalen und demokratischen Mitgliedern der Bürgerschaft, sondern auch in den Bürgervereinen und in der Presse.1
Sowohl der "St. Pauli Bürgerverein" als auch der "Grundeigentümerverein" wandten sich in Anzeigen an die Mitbürger, sich gegen das Gesetz zu wehren, denn die Vorschläge des Senats führten in "die politische Unmündigkeit der minderbegüterten Classen"2, was dem Wesen des hamburgischen Staats widersprechen und das Bürgertum schwächen würde. Es müsste also durch Gegenwehr der Mittelstand geschützt werden. Gleichzeitig forderten beide Vereine, die im Gewerbegesetz verankerte Freizügigkeit und Gewerbefreiheit für Fremde zu verhindern, denn auch sie trüge zum Verfall des Bürgertums bei. Es gelte die "Conservirung der bestehenden guten bürgerlichen Verhältnisse"3 zu ermöglichen und sich deshalb gegen Zwangsbürgerpflicht für Reiche und Freizügigkeit und Gewerbefreiheit für Fremde zu wehren.
Die Ablehnung des Eindringens Fremder in die bürgerliche Welt und der gleichzeitige Versuch die Interessen des bürgerlichen Mittelstandes durchzusetzen sowie seine politische Einflußnahme zu sichern, zeigen deutlich, wie einseitig das bürgerliche Gesellschaftsbild in den 60er Jahren war. Die Gefahr der politischen Ausgrenzung, die die Bürgervereine sahen, verstanden sie nur als eine Gefahr für das Bürgertum; an einer generellen politischen Partizipation aller erwachsenen Staatsangehörigen oder zumindest aller männlichen erwachsenen Staatsangehörigen, war nur wenigen gelegen.
Das Bürgertum sah seinen, in den zehnjährigen Auseinandersetzungen um die Verfassung Hamburgs mühsam errungenen, politischen Einfluß in Gefahr und ebenso seine wirtschaftliche Stellung.
Für die inhaltliche Befassung mit Frauenbelangen blieb bei dieser Auseinandersetzung kein Platz, weder in bezug auf das politische Bürgerrecht noch in der Frage der Gewerbefreiheit, obwohl ihnen die ohne zu zögern zugebilligt wurde.
5.2.2 Frauenspezifische Aspekte der Verhandlungen um Gewerbefreiheit und Bürgerrecht
Im Gegensatz zu den scharfen generellen Debatten um die Bürgerrechtspflicht und die Ermöglichung des Bürgerrechts für mittlere Schichten, um auch sie an der politischen Entscheidung teilhaben zu lassen, wurde dem weiblichen Bürgerrecht während der Verhandlungen keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt.
Vor dem Hintergrund, daß die emanzipatorischen Bestrebungen der Frauen - besonders im Zusammenhang mit der Frauenhochschule - nach 1852 zum Stillstand kamen und die Frauenbewegung sich weder organisatorisch noch inhaltlich in den 50er Jahren weiterentwickeln konnte, ist es nicht verwunderlich, daß die Abschaffung des weiblichen Bürgerrechts im Rahmen der Bürgerrechtsänderung 1864 fast nebenbei konstatiert wurde.
Das gesellschaftspolitische Klima war auch in den 60er Jahren, nach Inkrafttreten der neuen Hamburgischen Verfassung, die die politische Mitbestimmung bei der Wahl der Bürgerschaft auf alle männlichen Bürger über 25 Jahre ausweitete, die ein Einkommen versteuerten und zum Zeitpunkt der Wahl nicht mit den Steuern im Rückstand waren4, nicht auf frauenpolitische Belange ausgerichtet.
Nachdem sich Senat und Bürgerschaft darauf geeinigt hatten, den Grundstückserwerb, die Verheiratung und das Recht auf selbständigen Erwerb außerhalb der Bürgerrechtspflicht zu regeln, lag es sehr schnell nahe, den Frauen das Recht auf Erwerb des Bürgerrechts generell abzuerkennen.
Der Umgang mit den Frauenrechten innerhalb der Erörterung des Gewerbegesetzes und des Bürgerrechtsgesetzes zeigen, daß die Entscheidungen zu den Gesetzen lapidar gefällt und nicht hinterfragt wurden. Dies wurde ebenso deutlich in der politischen Auseinandersetzung mit dem von Baumeister 1862 eingebrachten Gesetzentwurf zur Aufhebung der Geschlechtskuratel, der insofern im Zusammenhang mit der Gewerbefreiheit von Frauen gesehen werden muß, als daß beide ein Schritt zur rechtlichen Gleichstellung der Frau in der Gesellschaft waren.
In den Aufzeichnungen des Ausschusses zu den Beratungen um die Staatsangehörigkeit und das Bürgerrecht läßt sich kein Hinweis darauf finden, daß die Frage des Bürgerrechts für Frauen erörtert wurde, bevor es zu einer ersten Fassung des entsprechenden Paragraphen kam.
Im Gegensatz zum letztlich erlassenen Gesetz war in den ersten Gesetzentwürfen noch ein eigener Paragraph für Frauen vorgesehen, in dem es hieß:
"Frauenzimmer sind zum Erwerbe des Bürgerrechts weder verpflichtet noch berechtigt. Sie haben, wie desgleichen alle Nichtbürger, diejenigen Erklärungen welche "auf Bürger Eid" erfordert werden "an Eides Statt" abzugeben."5
Im abschließenden Gesetz jedoch wurden die Aspekte der Gewerbefreiheit und die damit verbundenen Änderungen der Staatsangehörigkeitsverhältnisse in einem Paragraphen zum Ausdruck gebracht.
"Zur Betreibung eines selbständigen Geschäfts und zur Schließung der Ehe ist der Erwerb des Bürgerrechts nicht erforderlich. Alle Nichthamburger so wie Frauenzimmer, welchen letzteren das Bürgerrecht nicht mehr ertheilt wird, haben die Erklärungen, welche gesetzlicher Vorschrift zufolge auf "Bürger-Eid" erfordert werden, "an Eides Statt" abzugeben."6
Die Erklärung "an Eides Statt" bezog sich auf einzelne Berufe, deren Ausübung auch nach Einführung der Gewerbefreiheit eine Eidesleistung gegenüber dem Staat voraussetzten. Dazu gehörten u. a. die Inhaber(innen) von Kommissions- und Nachweisungskontoirs und die Dienstbotenvermietung sowie deren Aufsicht im Gesindebüro.7 Berufe also, die oft von Frauen selbständig ausgeführt wurden.
Hamburg hatte schon immer darauf Wert gelegt, daß auch Frauen als Bürgerinnen den Bürgereid ablegten, mit dem sie ebenso wie die Männer die Anerkennung und Achtung der Regeln der bürgerlichen Gesellschaft auszudrücken hatten und der implizierte, daß sie ein Teil dieser Gesellschaft waren, die sich von den bloßen Einwohnern abhob.
Nun, da sie keine Bürgerinnen mehr sein konnten, wurde von ihnen zwar noch verlangt, durch die eidesstattliche Erklärung die Regeln der Gesellschaft anzuerkennen, aber auch ehemalige potentielle Bürgerinnen - bezogen auf ihre Herkunft und ihr Einkommen - wurden nicht mehr als eidfähiges, also vollwertiges Mitglied des Bürgertums erachtet.
Die Motive des Senats hinsichtlich der Gestaltung des §6 verdeutlichen die gesamte Haltung gegenüber den Frauen. Darin heißt es:
"Als eine Folge dieser Erweiterung der den Staatsangehörigen zustehenden Befugnisse [selbständiger Erwerb, Verheiratung, Freizügigkeit], ergeben sich die in § 6 in Betreff der Frauenzimmer und der Schutzverwandten enthaltenen Bestimmungen. Dieselben, welche zur Ausübung politischer Rechte nicht befugt sind, werden künftig schon als Staatsangehörige dieselben Befugnisse genießen, die sie jetzt erst durch die Erwerbung des Bürgerrechts, beziehungsweise der Schutzverwandtschaft erlangen. Es wird somit die Erwerbung des Bürgerrechts abseiten der Frauen und die Verleihung der Schutzverwandtschaft künftig als überflüssig wegfallen."8
Dies symbolisiert die Stellung aller Frauen in der Stadt. Sie waren lediglich Staatsangehörige wie alle anderen Nichtbürger auch.
Edith Ennen hat darauf hingewiesen, daß es sich bei dem Bürgerrecht für Frauen nicht um eine emanzipatorische Errungenschaft der Frauen im Mittelalter handelte, die sie sich erstritten, sondern es wurde ihnen wie den Männern gewährt, weil es als eine korporative Freiheit der Stadtbürger empfunden wurde; als Gegenstück zu Leibeigenschaft und feudaler Ordnung.9 Das Bürgerrecht für Frauen war demnach ein Nebenprodukt der städtischen Freiheiten und des städtischen Selbstbewußtseins und wurde den Frauen ′traditionell′ bis in das 19. Jahrhundert verliehen. Der damit verbundene Status des Bürgers als Teil der bürgerlichen Gemeinschaft, um den in der Debatte um §8 des Bürgerrechtsgesetzes gerungen wurde, wurde für Frauen nicht als Aspekt angesehen, den es zu berücksichtigen galt.
Während der Senat eher als konservatives Element der Gesetzgebung betrachtet werden muß, gab es in der Bürgerschaft seit 1859 fortschrittlichere Kräfte, aber auch sie gestanden den Frauen nicht mehr Aufmerksamkeit zu als der Senat. Im Gegenteil, als schließlich der §6 des Gesetzentwurfs in der Bürgerschaft verhandelt wurde, wurde der das Bürgerrecht der Frauen betreffende Teil angenommen, ohne von irgendeinem Mitglied der Bürgerschaft mit einer Stellungnahme bedacht worden zu sein.
Auch Mitglieder der Bürgerschaft, die sich mit der Situation von Frauen befaßten, wie der Lehrer Anton Rée, der mit Malvida von Meysenbug und Emilie Wüstenfeld befreundet war, oder der Richter Hermann Baumeister, der 1862 den Gesetzentwurf zur Aufhebung der Geschlechtskuratel eingebracht hatte, stellten die Abschaffung des Bürgerrechts für Frauen nicht in Frage. Ebensowenig hinterfragten sie die Auswirkungen der politischen und rechtlichen Einflußlosigkeit von Frauen auf ihre Stellung als selbständige Gewerbetreibende nach Einführung der Gewerbefreiheit.
Von außen gab es keine nachweisbaren Reaktionen auf die Abschaffung des Bürgerrechts für Frauen. Die Frauenbewegung war zu diesem Zeitpunkt, wie schon erwähnt, weder inhaltlich noch organisatorisch in der Lage, sich mit den Fragen politischer Partizipation auseinanderzusetzen. Ebensowenig wurde dieses Thema in der Presse aufgegriffen.
In den Akten findet sich ebenfalls kein Hinweis darauf, daß einzelne Frauen, vor allem solche, die schon das Bürgerrecht besaßen, sich an Senat oder Bürgerschaft wandten. Weder in bezug auf eine mögliche politische Partizipation noch in Hinsicht einer Entschädigung, obwohl sie für das Bürgerrecht teuer bezahlt hatten und ihnen dafür ab 1865 keine besonderen Rechte blieben, während für die Männer, die vor 1865 das Bürgerrecht erwarben, dieses immer noch den Schlüssel zur politischen Teilhabe am Staatsleben bildete.
Alle männlichen Bürger, die vor der Gesetzesänderung Bürger wurden, waren nach Inkrafttreten des neuen Bürgerrechtsgesetzes gleichberechtigt mit den neuen Bürgern, die das politische Bürgerrecht erwarben. Insofern standen ihnen, auch wenn sie das Bürgerrecht aus wirtschaftlichen Gründen erworben hatten, weiterhin spezielle Rechte zu, die sie von den anderen Staatsangehörigen unterschieden.
Für Frauen jedoch, die das Bürgerrecht erworben hatten, um wirtschaftliche Rechte wahrnehmen zu können, war das Bürgerrecht jetzt wertlos. Im Gegensatz zu den Inhabern von Realgerechtigkeiten, die ebenfalls für ein Privileg bezahlt hatten, daß ihnen nach dem Gewerbegesetz nicht mehr zustand, wurde eine eventuelle Entschädigung für Bürgerinnen nach Aufhebung des weiblichen Bürgerrechts während der Verhandlungen nicht in Betracht gezogen.
Im Gegenteil, die letzte Frau, die in Hamburg Bürgerin wurde, wurde zwar vor Inkrafttreten des Gesetzes am 1. Februar 1865, aber nach der Publikation des Gesetzes, noch zur Bürgerin angenommen.
Hamburgs letzte Bürgerin war die Bürgerswitwe Emma Magdalena Flügger, geb. Böhme.10 Sie erhielt am 16. November 1864 das Bürgerrecht zugesprochen, neun Tage nachdem das neue Bürgerrechtsgesetz verabschiedet und veröffentlicht war. Ausgehend von der Gegebenheit, daß die Witwe Flügger als Nachfolgerin ihres Mannes Hermann Friedrich Flügger in der Lack- und Firnißfabrik und Lager von Joach. Dan. Flügger tätig war11, ist es wahrscheinlich, daß die Kosten für das Bürgerrecht für sie keine schwer aufzubringende Bürde war. Es stellt sich aber trotzdem die Frage, warum die Verwaltung es zu diesem Zeitpunkt nicht ablehnte, noch Frauen zuzulassen, da ihnen das Bürgerrecht nur noch für den kurzen Zeitraum von 3 Monaten von Nutzen war.
Dieser Zeitraum hätte, angesichts der rechtlichen Entwicklung und der Erfahrung, daß Bürgerswitwen auch zuvor oft erst mit zeitlicher Verzögerung, wenn sie die Firma schon leiteten, das Bürgerrecht beantragten, zweifellos auch ohne offiziellen Bürgerinnenstatus überbrückt werden können. Leider ist nicht nachvollziehbar, ob es sich bei der Zulassung der Witwe Flügger um den persönlichen Wunsch handelte, trotz der in Kürze inkraftretenden Gewerbefreiheit und Aufhebung des weiblichen Bürgerrechts noch Bürgerin zu werden, oder ob es eine pragmatische Entscheidung der Verwaltung war, die, da das Gesetz noch nicht inkraftgetreten war, auf die Einnahme des Bürgergeldes nicht verzichten wollte.
Beide Varianten sind möglich. Während die erste darauf hinweisen würde, daß der Bürgerinnenstatus für die Frauen und Witwen mehr als nur eine rechtliche Befugnis, nämlich auch einen ideellen Wert, darstellte, unterstützt die zweite Variante den bisher entstandenen Eindruck, daß das weibliche Bürgerrecht und seine Aufhebung nicht als ein wichtiger Bestandteil der Staatsangehörigkeitsformen zur Kenntnis genommen wurde und dementsprechend auch in Einzelfällen nicht beachtet wurde.
Die Änderung, die die Aufhebung des Bürgerrechts für Frauen mit sich brachte, war keine materielle, sondern eine ideelle. Das neue, auf das politische Bürgerrecht beschränkte Gesetz, verwies die Frauen in der Gesellschaft an den Platz, an dem sie ohnedies standen. Sie waren auch als Bürgerinnen nie ein vollwertiges Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft gewesen. Allerdings gab es bis zur neuen Verfassung auch viele männliche Bürger, die nicht als wahre Bürger anerkannt waren, weil sie keine politischen Rechte besaßen. Als Folge der demokratischen Bewegung wurden die politischen Rechte der männlichen Bevölkerung Hamburgs erweitert und dadurch ein größerer Teil der männlichen Bevölkerung in die bürgerliche Gesellschaft integriert.
Der so ausgedrückte Wille zur Modernisierung der politischen Verhältnisse des Staates setzte sich jedoch nicht in einer Bereitschaft zur Liberalisierung weiblicher Rechte durch. Dies verdeutlicht nicht nur die fehlende Beschäftigung mit dem weiblichen Bürgerrecht, sondern zeigt sich auch in der für die rechtliche Situation von Frauen wesentlichen Diskussion um die Aufhebung der Geschlechtskuratel, die 1863 in der Bürgerschaft anstand.
Hermann Baumeister hatte am 10.9.1862 den Gesetzentwurf zur Aufhebung einiger Beschränkungen der Handlungsfreiheit als selbständigen Antrag eingebracht.12 Er veröffentlichte den Gesetzentwurf und seine Motive unter dem Titel "Die Mündigkeit unserer Jungfrauen und Wittwen".13 Es ging ihm hier also nicht um eine generelle rechtliche Gleichstellung der Frau, sondern nur um die Rechtsfähigkeit von Frauen, die entweder als Witwe oder als Ledige in der Lage sein sollten, sich selbst um ihre Rechtsgeschäfte zu kümmern. Dementsprechend lautete der erste Paragraph des Gesetzentwurfs, daß die Geschlechtsvormundschaft aufgehoben sei.
"Volljährige unverheiratete Personen weiblichen Geschlechts und Wittwen bedürfen weder wenn sie vor gerichtlichen oder anderen Behörden auftreten, noch auch zur Vollziehung von Rechtsgeschäften, mögen diese eine Veräußerung oder die Eingehung einer Verpflichtung betreffen, der Mitwirkung oder Zustimmung eines männlichen Beistandes."14
Abgesehen davon, daß dieser Gesetzentwurf alle unverheirateten Frauen von der Geschlechtsvormundschaft befreite, auch solche, die nicht im Berufsleben standen, hätte dieses Gesetz gerade in bezug auf die Einführung der Gewerbefreiheit für Frauen eine große Erleichterung mit sich gebracht. Denn sie wären nicht mehr nur bezüglich des Ankaufs und Verkaufs von Waren oder Rohstoffen von der Geschlechtsvormundschaft befreit gewesen, sondern hätten gerade auch ihre geschäftlichen Interessen vor Gericht selbst wahrnehmen können. Die Einführung dieses Gesetzes zusammen mit der Gewerbefreiheit wäre ein erster wesentlicher Schritt zur generellen rechtlichen und politischen Gleichstellung von Frauen in der Gesellschaft gewesen.
Soweit kam es jedoch nicht. Obwohl Baumeisters Gesetzentwurf im Art. 2 betonte, daß das Rechtsverhältnis zwischen Ehemann und Ehefrau davon nicht berührt sei, konnten sich die Bügerschaftsmitglieder mit dem Gesetz nicht anfreunden.
Hauptstreitpunkte waren zum einen die Überzeugung einiger Bürgerschaftsmitglieder, daß die Frauen Vermögens- und Rechtsgeschäften ohne Kurator nicht gewachsen wären und ständig Gefahr liefen, übervorteilt zu werden. Zum anderen störten sich die Abgeordneten aber vornehmlich an der Fassung der Artikel über die rechtliche Stellung der Ehefrau. Wenngleich die in Art. 3 des Gesetzentwurfs aufgehobene Beschränkung der Verbindlichkeiten, die aus von Frauen eingegangenen Interzessionen und Bürgschaften entstanden, laut Art. 4 nur dann auf Ehefrauen ausgeweitet wurde, wenn sie selbständig einen Handel betrieben, waren die Bürgerschaftsmitglieder von der Eindeutigkeit dieser Paragraphen nicht überzeugt.15
Aber es gab auch andere Stimmen, wie die von Dr. Sutor vorgetragene Ansicht, daß die Verabschiedung des Gesetzes nicht nur eine rechtliche Frage sei, sondern auch eine sittliche. Das Gesetz wäre
"nichts als eine Überhebung des männlichen Geschlechts, die Frauen bevormunden, ihnen die selbständige Disposition absprechen zu wollen."16
Nachdem in drei Bürgerschaftssitzungen das Gesetz zur Aufhebung der Geschlechtsvormundschaft für Ledige und Witwen verhandelt worden war, setzten sich die Gesetzesbefürworter durch, und das Gesetz wurde in der ersten Lesung mit Änderungen des Wortlauts, aber nicht des Inhalts der Artikel 3 und 4, am 4. März 1863 angenommen.17
Zu Beginn der zweiten Beratung des Gesetzes am 6. Mai 1863 kam es unerwartet wieder zu einer Grundsatzdiskussion darüber, ob die Aufhebung der Handelsbeschränkung den Frauen zuzumuten sei. Der "Hamburgische Correspondent" bezeichnete diese erneuten generellen Stellungnahmen als vom "Standpunkte der Hamburgischen Lebenserfahrung aus" vorgetragen.18 Der Abgeordnete Eichholz betonte sehr stark die Auffassung des Schutzes der Frauen durch die Geschlechtsvormundschaft und führte an, daß keiner "sein köstliches Kleinod" einem "führerlosen Schiffe" anvertrauen möchte und deshalb Baumeisters Argument, daß die Frauen zu ehren seien, indem die Handlungsbeschränkung aufgehoben werde, nicht greife.19 Unterstützt wurde er darin von dem Bürgerschaftsmitglied Schön, der davon ausging, daß für mittellose Frauen ein Kurator sowieso keine Rolle spielte, daß aber sich etwas besser stehende Frauen durch die Aufhebung der Kuratel Gefahren ausgesetzt seien, weil "ihre Gutmüthigkeit sie in Verlüste bringen würde". Für reiche Frauen schließlich werde das Gesetz nur Nachteile bringen, da dann die Ehemänner dazu übergehen würden, "ihnen testamentarisch Verwalter für ihr Vermögen setzen zu müssen".20
Das geringe Vertrauen, daß Schön in die Fähigkeiten der Frauen hatte und die Überzeugung, daß auch die Ehemänner dieses Vertrauen in ihre Frauen nicht hatten, fiel in der Bürgerschaft auf fruchtbaren Boden. Als das Bürgerschaftsmitglied Schwartze erneut den Antrag einbrachte, das Gesetz zu einer gründlichen Auseinandersetzung an einen Ausschuß zurückzuweisen, hatte er damit Erfolg. 94 der Bürgerschaftsmitglieder stimmten für diese Eingabe und nur 66 dagegen21, obwohl der gleiche Antrag Schwartzes während der ersten Lesung schon einmal abgelehnt worden war.22
Nachdem der Gesetzentwurf zur Beschäftigung an den Ausschuß zurückverwiesen wurde, verschwand er sechs Jahre aus dem Tätigkeitsbereich und der Erinnerung der Bürgerschaft. Erst im Januar 1869 kam es zu einer Anfrage in der Bürgerschaft von Dr. Gerson, warum der Ausschuß seit 1863 keinen Bericht erstattet habe. Baumeister führte als Entschuldigung an, daß von den ursprünglich sieben Mitgliedern des Ausschusses nur noch drei da seien. Daraufhin wurde der Ausschuß aufgestockt. Im Mai legte er den Gesetzentwurf erneut vor. Diesmal wurde er angenommen und an den Senat zur Mitgenehmigung überwiesen.23 Es dauerte jedoch noch ein weiteres Jahr, bis das Gesetz am 1.7.1870 in Kraft trat.
Da sich die rechtliche Situation der Frauen 1864 nicht geändert hatte, bleiben als Auswirkungen der Aufhebung des Bürgerrechts und der Einführung der Gewerbefreiheit nur wirtschaftliche Aspekte.
Die wirtschaftlichen Rechte der Frauen wurden durch die Gewerbefreiheit erweitert. Die Gewerbefreiheit ermöglichte theoretisch auch denjenigen Frauen ein selbständiges Gewerbe, die es vorher möglicherweise wegen der hohen Kosten für das Bürgerrecht nicht ausübten oder denen die Etablierung eines Geschäfts von seiten der Ämter untersagt worden war.
Trotz dieser Ausweitung der Befugnisse von Frauen im Wirtschaftsleben war auch der Umgang mit den weiblichen Rechten in Zuge der Gestaltung des Gewerbegesetzes inhaltlich nicht sehr tiefgehend, und dies wurde von Baumeister im Ausschußbericht, wenngleich ohne eine kritische Intention, auch so erläutert.
Da Hamburg mit seiner Entscheidung, Gewerbefreiheit und Freizügigkeit einzuführen, nicht an der Spitze wirtschaftsliberaler Tendenzen in Deutschland stand, sondern die Einführung der Gewerbefreiheit eher eine zwangsläufige Reaktion auf die Entwicklung in anderen deutschen Ländern war, wurden sozialpolitische und moralische Fragen relativ wenig diskutiert. So kam die Einführung der Gewerbefreiheit für das weibliche Geschlecht nicht nach einer Auseinandersetzung mit der Situation von Frauen in den Gewerben zustande, sondern war lediglich eine Reaktion auf die gesetzlichen Regelungen in anderen Staaten. Ebenso selbstverständlich wie den Frauen das Bürgerrecht mit der Begründung aberkannt wurde, daß alle ihnen bisher zustehenden Rechte nun durch die Gewerbefreiheit zugänglich waren, wurde die Gewerbefreiheit auf Frauen ausgeweitet, ohne eventuell entstehende Behinderungen der Frauen durch die gewerblichen Korporationen trotz Einführung der Gewerbefreiheit zu diskutieren.
Im Ausschußbericht vom Dezember 1861, der im Februar und März 1862 in der Bürgerschaft von Baumeister vorgetragen wurde, heißt es zur Gewerbefreiheit von Frauen:
"Zunächst wird in Übereinstimmung mit den meisten neueren Gesetzen ausgesprochen, daß der gewerblichen Thätigkeit auch des weiblichen Geschlechts kein gesetzliches Hindernis im Weg stehen soll. Unser Institut der Bürgerinnen und das Vorrecht der Meisterwittwen bezeugt schon, daß diese Gleichstellung nicht ohne practische Wichtigkeit ist. Die Zukunft mag darüber entscheiden, ob und welche unter den bisher zünftigen Gewerben sich auch für die weiblichen Kunstfertigkeiten eigenen; jedenfalls darf am wenigsten in einer Großstadt dem weiblichen Geschlecht irgend ein Weg zu rechtlichem Erwerb durch selbstständige Arbeit verschlossen sein."24
Damit sprach Baumeister einen Punkt an, der in der folgenden Debatte ohne Diskussion akzeptiert wurde, nämlich daß die Zukunft zeigen müsse, welche Gewerbe sich für Frauen eigneten. Dabei ging es in den folgenden Jahren aber keineswegs darum, welche handwerklichen Fähigkeiten die Frauen hatten, sondern auf welche Weise sie sich gegen die organisierten Männer durchsetzen konnten.
Die Einführung der Gewerbefreiheit hatte allen Einwohnern den Vorteil gebracht, daß sie nicht mehr das Bürgerrecht erwerben mußten, um ′bürgerliche Nahrung′ betreiben zu können. Während die Ämter, denen die Frauen nicht angehören durften, vorher über ihr Vetorecht bei der Aufnahme zum Bürgerrecht auch die Zahl der weiblichen Handlungen und Handwerksgeschäfte begrenzen konnten, wurde dieses Privileg mit der Gewerbefreiheit aufgehoben. Für Frauen kam hinzu, daß sie theoretisch mit Einsetzen der Gewerbefreiheit auch handwerkliche Gewerbe betreiben konnten, die ihnen bis dato durch die Privilegien der Zünfte versperrt waren.
Es kann im Rahmen dieser Arbeit nicht auf die einzelnen Bestimmungen der Innungen und Vereinigungen eingegangen werden. Die detaillierte Untersuchung der Stellung der Frauen Hamburger Innungen und Korporationen in Hamburg am Ende des 19. Jahrhunderts ist ein eigenständiges Thema, daß mit dem Bürgerrecht nicht in direktem Zusammenhang steht. Deshalb soll hier abschließend nur kurz auf diesen Komplex eingegangen werden, um zu verdeutlichen, daß die Einführung der Gewerbefreiheit, ohne politische und rechtliche Gleichstellung der Frauen, nicht ihre völlige wirtschaftliche Gleichstellung beinhaltete.
Das Gewerbegesetz sah vor, daß die ehemaligen Ämter sich entweder auflösen mußten oder in eine Korporation umwandeln konnten. Die Mitgliedschaft in einer Korporation durfte jedoch nicht verpflichtend sein. Die Bildung von Genossenschaften im Rahmen des Vereinsrechts war zulässig, aber auch für diese galt, daß sie keine Ansprüche zur ausschließlichen Ausübung bestimmter Handwerke oder Handelsformen hatten und daß auch hier die Mitgliedschaft nur freiwillig sein konnte.25
Nachdem ein interemistischer Gewerbeausschuß, wie im Gesetz vorgesehen, die Überwachung und Förderung der Gewerbebetriebe übernommen hatte, wurde 1872 eine Gewerbekammer ins Leben gerufen. Sie setzte sich aus 15 Mitgliedern zusammen, die von den in 15 Gruppen eingeteilten Gewerben gestellt wurden und hatte zum Ziel, die Interessen der hamburgischen Gewerbetreibenden zu vertreten. Wählbar in die Gewerbekammer war nur, wer als Bürger auch das allgemeine Wahlrecht hatte.26
Doch schon der Zutritt zu den Vereinen und Innungen der Gewerbetreibenden war für Frauen nicht zulässig. Trotzdem wurden vereinzelt auch die Interessen der von Frauen geführten Betriebe einbezogen. So verfügte z.B. der "Hamburg-Altonaische Buchdrucker Prinzipal Verein" in seinen Statuten von 1872, daß von Firmen, deren Besitzerin eine Frau war, legitimierte Geschäftsführer als Mitglied in den Verein aufgenommen werden konnten.27
Mit der Frage der Innungsfähigkeit von Frauen war auch die Frage der Ausbildung weiblicher Lehrlinge verbunden, denn sie hatten in den Innungen keine Lobby, so daß ihre Ausbildungszeiten sehr oft kürzer waren als die der männlichen Lehrlinge, weil sie oft nicht zu fähigen Handwerkerinnen ausgebildet, sondern als billige Arbeitskräfte eingesetzt wurden. In Deutschland setzte die Auseinandersetzung mit der Ausbildung weiblicher Lehrlinge, der Meisterfähigkeit von Frauen im Handwerk und ihrem Zutritt zu den Innungen erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein.28
Aber auch Kauffrauen waren, wie schon erwähnt, nicht gleichberechtigt, obwohl der Kaufmannsstand unabhängig von Ämtern bestand. So waren sie weiterhin vom Besuch der Börse ausgeschlossen und konnten ferner nicht Mitglied in der Vereinigung des "Ehrbaren Kaufmanns" werden. Der Ausschluß des weiblichen Geschlechts von der Börse auch im ersten Deutschen Börsengesetz 1896 ging dabei nach Einschätzung von Zeitgenossinnen auf Berlin und Hamburg zurück. Für das Börsengesetz waren alle Börsenordnungen der deutschen Staaten herangezogen wurden. Dabei sahen nur zwei der 27 großen deutsche Börsenplätze den Ausschluß von Frauen explizit vor - ausgerechnet die als liberal geltenden Städte Hamburg und Berlin. In den Motiven zum Börsengesetz von 1896 wurde darauf hingewiesen, daß der Ausschluß von Frauen auf die Verordnungen in Berlin und Hamburg zurückgeht.29
6 Schlussbetrachtung und Ausblick
Die Auswertung der Bürgerprotokolle hat ergeben, daß der Anteil der Frauen unter den Bürgern Hamburgs äußerst gering war und daß schon von daher die Bedeutung des Bürgerrechts für Frauen nicht überschätzt werden darf. Es zeichnete sich jedoch im Verlaufe des Jahrhunderts ab, daß die Zahl der Bürgerinnen seit den 1830er Jahren kontinuierlich anstieg. Dies ist sowohl auf die Festschreibung der Bürgerrechtspflicht von Frauen in den Gesetzen von 1833 und 1845 zurückzuführen als auch auf die größer werdende Zahl von unverheirateten Frauen, die auf den Erwerb eines eigenen Einkommens angewiesen waren. Es darf hinsichtlich der niedrigen Bürgerinnenzahlen allerdings nicht unberücksichtigt bleiben, daß durch die Ablehnungsmöglichkeit der Ämter ein Teil der zum Bürgerrecht gewillten Frauen gar nicht erst das Bürgerrecht beantragte und aus diesem Grunde kein eigenes Geschäft betrieb oder dies ohne die Legitimation durch das Bürgerrecht tat. Ebenso im Dunkeln bleibt die Zahl der verheirateten Hamburgerinnen, die als Kleinhändlerinnen auf den Namen des Mannes ihr Geschäft betrieben, auch wenn eigentlich sie das Geschäft leiteten.
Die Bürgerin, wie sie sich in den Bürgerprotokollen des 19. Jahrhunderts fand, entspricht nicht dem in der Forschung angenommenen Bürgerinnenbild. Es ist nicht die Bürgerswitwe, die den Großteil der Bürgerinnen im 19. Jahrhundert ausmacht. Zwar konnten für die hamburgstämmigen Bürgerinnen mehr Witwen als Ledige festgestellt werden, doch ergab das Gesamtbild, daß mehr als die Hälfte der Bürgerinnen ledig waren. Hinzu kommt, daß es sich bei den Bürgerinnen nicht überwiegend um hamburgstämmige Frauen handelte, sondern um zugewanderte Frauen. Dies betraf unter den Witwen vor allem Frauen, die nach Hamburg kamen, um hier zu heiraten, doch war gerade unter den fremden Frauen, die das Bürgerrecht beantragten, der Anteil der Ledigen mit fast zwei Dritteln besonders hoch.
Auch die Gewerbe, auf die die Frauen das Bürgerrecht beantragten, entsprechen als Folge der wesentlich vielschichtigeren Zusammensetzung der Bürgerinnen nicht der erwarteten Zusammensetzung.
Es konnten insgesamt 41 Kauffrauen und 15 Inhaberinnen von Fabriken und anderen produzierenden Gewerben ausgemacht werden. Dabei handelte es sich um 54 Witwen, die die Geschäfte ihrer Männer weiterführten und 2 Töchter, die im elterlichen Betrieb tätig wurden. Doch stellten diese - als typisch angenommenen - Bürgerinnen nur 14% der gesamten Bürgerinnen. Firmengründungen größeren Umfangs konnten nicht nachgewiesen werden.
Der Haupterwerbszweig, in dem sich die hamburgischen Bürgerinnen selbständig machten, war der Einzelhandel mit Textilprodukten, als Modewarenhändlerin, holländische Warenhändlerin oder Inhaberin von Putzgeschäften. Die meisten dieser Frauen kamen aus handwerklichen Berufen und hatten vorher als Näherin, Schneiderin oder Putzmacherin gearbeitet. Danach sind sie eher dem kleinbürgerlichen als dem bürgerlichen Spektrum zuzurechnen.
Obwohl der Versorgungsengpaß von unverheirateten Frauen aus bürgerlichem Milieu bekannt war und sich sowohl in den Begründungen der Frauen, die den hamburgischen Nexus verließen, widerspiegelte als auch in den Aktivitäten der Frauen der frühen Frauenbewegung in Hamburg, konnte eine verstärkte Inanspruchnahme des Bürgerrechts durch bürgerliche Frauen, die sich mit einem Handel den Lebensunterhalt finanzierten, nicht festgestellt werden. In diesem Zusammenhang wurde das Bürgerrecht nicht als Chance erkannt. Die Gründe dafür sind in den engen Grenzen zu sehen, die den bürgerlichen unverheirateten Frauen bezüglich des Berufs gesetzt wurden. Eine Betätigung im Erziehungswesen war nahezu die einzige anerkannte Form der Berufstätigkeit. Dies wurde auch von den öffentlich aktiven Frauen so bewertet. Sich mit einem eigenen Geschäft selbständig zu machen, war ein sozialer Abstieg. Sofern dies trotzdem erwogen wurde, boten sich die Textilwarengeschäfte hierfür am ehesten an, weil sie eine Ausweitung weiblicher Tätigkeitsbereiche in die Öffentlichkeit darstellten und die Kunden dieser Läden überwiegend Frauen gewesen sein dürften.
Nicht erklärbar war der Bürgerrechtserwerb solcher Frauen, die als Wäscherinnen, Plätterinnen oder Näherinnen arbeiten wollten. Für sie war, zumindest seit Wiedereinführung der Schutzverwandtschaft, diese als rechtliche Grundlage voll ausreichend.
Die mögliche Begründung, daß diese Frauen das Bürgerrecht gewannen, um von der Geschlechtsvormundschaft befreit zu sein, konnte weder eindeutig bestätigt noch widerlegt werden. Buek ging davon aus, daß die Befreiung von der Geschlechtskuratel in direktem Zusammenhang mit dem Bürgerrecht zu sehen ist. Diese Annahme bestätigte sich jedoch in den anderen Quellen nicht. Es scheint wahrscheinlicher, daß die Befreiung von der Geschlechtskuratel und der Bürgerrechtserwerb immer gemeinsam sichtbar werden, weil selbständige Handelsfrauen Bürgerin werden mußten, die Rechtsfähigkeit der Frauen im Geschäftsleben aber durch ihren Status als Händlerin und nicht durch den der Bürgerin entstand.
Erstaunlich ist, daß immerhin 53 Frauen das Bürgerrecht erwarben, obwohl sie nicht beruflich tätig sein wollten. Es ist anzunehmen, daß sie das Bürgerrecht gewannen, um ihre gesellschaftliche Stellung durch die offizielle Aufnahme in die bürgerliche Gesellschaft als Bürgerin zu unterstreichen.
Es bleibt jedoch fraglich, inwiefern die Bürgerinnen tatsächlich als Teil der bürgerlichen Gesellschaft akzeptiert wurden. Die Verhandlungen um die Bürgerrechtsänderung im Zusammenhang mit Einführung der Gewerbefreiheit haben gezeigt, daß es sich hierbei nur um ein subjektives Empfinden gehandelt haben kann, denn nachdem die ökonomischen Rechte vom Bürgerrecht gelöst waren, war die Aufhebung des weiblichen Bürgerrechts für Bürgerschaft und Senat eine logische Konsequenz, während bei der Auseinandersetzung um den Anteil der männlichen Bürger an der Gesellschaft nach Loslösung der wirtschaftlichen Rechte vom Bürgerrecht, immer auch die Frage des Zerfalls der bürgerlichen Gesellschaft eine Rolle gespielt hatte. Daraus ist zu schließen, daß die bürgerlichen Frauen weder vor noch nach der Aufhebung des weiblichen Bürgerrechts als Teil des Bürgerstaates begriffen wurden, sondern daß die Möglichkeit, Bürgerin zu werden, lediglich ein traditionelles Recht war, dem bezüglich der gesellschaftlichen Stellung und Integration wenig Beachtung geschenkt wurde.
Wirtschaftlich brachte die Aufhebung des Bürgerrechts den Frauen keine Nachteile. Alle ihnen durch den Erwerb des Bürgerrechts zugestandenen Rechte konnten von den Frauen ab Februar 1865 auch ohne das Bürgerrecht wahrgenommen werden.
Der Erwerb von Grundeigentum war für Bürgerstöchter und Bürgersfrauen, im Gegensatz zu Bürgerssöhnen, von jeher nicht an den persönlichen Besitz des Bürgerrechts gebunden gewesen, auch wenn in den Bürgerprotokollen von einigen Frauen als Grund für den Erwerb des Bürgerrechts die Zuschreibung eines Grundstücks angegeben wurde. Mit dem Grundeigentumsgesetz von 1863 stand dann schließlich allen volljährigen Angehörigen des Deutschen Bundes, unabhängig von Geschlecht und Staatsangehörigkeit, in Hamburg der Erwerb von Grundeigentum zu.
So stand bei der - wegen der Einführung von Gewerbefreiheit und Freizügigkeit notwendig gewordenen - Bürgerrechtsänderung 1864 für Frauen nur noch das Recht zu selbständigem Betreiben von Handelsgeschäften zur Disposition. Dieses Recht wurde aber nach §2 des Gewerbegesetzes jetzt jedem volljährigen hamburgischen Staatsangehörigen zugesprochen. Das Bürgerrecht hatte sich auf ein reines Recht der politischen Partizipation reduziert und war deshalb, wie der Senat es in den Motiven zum Gesetzentwurf ausführte, für Frauen "überflüssig" geworden.
Ausgehend von den rein wirtschaftlichen Rechten, die das Bürgerrecht den Frauen seit dem Mittelalter ermöglichte, haben sich die Chancen der Frauen auf eine selbständige ökonomische Existenz mit Einführung der Gewerbefreiheit und Aufhebung des Bürgerrechtszwangs erhöht. Was für das Mittelalter als ein Fortschritt in der Stellung der Frauen gewertet wurde, nämlich die Möglichkeit in den freien Städten als Bürgerinnen selbständig tätig zu sein, muß für das 19. Jahrhundert, in dem der wirtschaftliche Liberalismus gepredigt wurde, für eine Stadt wie Hamburg als anachronistisch angesehen werden. Die freie Wahl des Gewerbes und des Gewerbestandorts für alle Staatsangehörigen und nicht nur für die Bürger war eine notwendige Konsequenz der wirtschaftlichen Entwicklung im neunzehnten Jahrhundert.
Für die Einwohnerinnen Hamburgs - wie auch für die Einwohner - bedeutete dies, daß die nicht unerheblichen Kosten für den Erwerb des Bürgerrechts wegfielen. Diese waren für die Frauen sogar noch höher gewesen als für die Männer, denn dadurch, daß sie nicht gemeinsam mit den Männern in der Ratsstube vereidigt werden durften, verursachten sie einen höheren Verwaltungsaufwand, für den sie eine zusätzliche Gebühr zu entrichten hatten. Generell waren die Kosten des Erwerbs des Bürgerrechts für viele nicht oder nur schwer bezahlbar, was sich in der Zahl der sogenannten wilden Ehen niederschlug, aber auch in der Anzahl der Bürger und Bürgerinnen im Verhältnis zu der gesamten Einwohnerzahl Hamburgs. Zwar galt das geringere Bürgergeld für Bürgersangehörige auch für Bürgerstöchter und Bürgerswitwen, im Gegensatz zum Bremer Bürgerrecht war jedoch das Bürgergeld für fremde Frauen und Frauen, deren Väter oder Männer nicht Bürger der Stadt waren, nicht geringer als für Männer. Obwohl Senat und Bürgerschaft die Probleme unverheirateter Frauen bekannt waren und sie auch wußten, daß die Kosten des Bürgerrechts in Bremen für Frauen um ein Drittel geringer war als für Männer, erwogen sie während der Bürgerrechtsreformen 1833 und 1845 nie, den Frauen den Zugang zum Bürgerrecht über eine Verringerung der Kosten zu erleichtern.
Erst mit der Einführung des Gewerbegesetzes hatten mehr Frauen die Möglichkeit, sich eine selbständige wirtschaftliche Existenz zu schaffen, trotzdem bleiben sie in der Praxis gegenüber den Männern benachteiligt. Ihre rechtliche und politische Stellung ermöglichte es ihnen bis in das 20. Jahrhundert nicht, in den wirtschaftlichen Vereinigungen ihre Interessen zu vertreten.
Die Ausweitung des Bürgerrechts auf eine politische Partizipation der Frauen hatte zu keiner Zeit der Verhandlungen um das neue Bürgerrechtsgesetz 1864 eine Rolle gespielt - weder innerhalb der Bürgerschaft noch in der Öffentlichkeit.
Der Kampf der Frauen um das Frauenstimmrecht setzte verstärkt erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein.
1902 wurde in Hamburg der "Deutsche Verein für Frauenstimmrecht" als erster deutscher Frauenstimmrechtsverein gegründet. Dies lag aber nicht an der Hamburger Frauenbewegung an sich, sondern an dem Sachverhalt, daß im hamburgischen Vereinsrecht die Frage der politischen Vereinigungen von Frauen nicht eindeutig geklärt war, während in den meisten Staaten des Deutschen Reichs die Bildung politischer Frauenvereine und Aktivitäten verboten war.30
Im Rahmen der Frauenstimmrechtsbewegung kam es in Hamburg erst 1917 zu der öffentlichen Forderung nach dem Bürgerrecht für Frauen in Form einer Petition. 1915 hatte sich der "Stadtbund Hamburgischer Frauenvereine" konstituiert, der seine Aufgabe in der Öffentlichkeitsarbeit sah, um die Interessen der Mitgliedsvereine durch Petitionen, Versammlungen und Pressemitteilungen öffentlich zu machen. Geprägt durch den Krieg waren die Themen des Stadtbundes überwiegend auf die politischen und sozialen Dimensionen des Krieges ausgerichtet, so in den vom Verein veranstalteten "Vaterländischen Abenden". Dem Stadtbund gehörten bei der ersten Mitgliederversammlung im Dezember 1916 44 bürgerliche Frauenvereine an, sein Vorsitz wurde von Emma Ender geführt.31
1917 gab es reichsweite Tendenzen, das Wahlrecht zu demokratisieren. Auch der Hamburger Senat zog die Demokratisierung des Wahlrechts, das immer noch an das Bürgerrecht gekoppelt war, in Betracht. Dies nahm der Stadtbund zum Anlaß, durch ein Gesuch bei Senat und Bürgerschaft das weibliche Bürgerrecht zu fordern, denn für die anstehenden Aufgaben bedürfe es auch der Frauen, von denen viele nach dem Krieg auf eigenen Füßen stehen und sich im Krieg und auch danach im Erwerbsleben durchsetzen müßten und damit "... die gleiche wirtschaftliche Verantwortung zu tragen [hätten] wie die Männer".32 Damit auch sie ihre Bürgerpflichten erfüllen könnten, dürften Änderungen des politischen Systems nicht an den Frauen vorbei gehen. Das Gesuch wurde am 7. Mai 1917 eingereicht und in der Neuen Hamburger Zeitung veröffentlicht. Unterzeichnet war es von Emma Ender, die für die ca. 12600 Einzelmitglieder der im Stadtbund vereinigten Frauenvereine stand33 und von Nanny Goldschmidt für ca. 11000 organisierte Hausfrauen. Eine mit der Eingabe gleichlautende Resolution, die am 14. Mai 1917 auf der Frauenversammlung zum weiblichen Bürgerrecht verabschiedet wurde, brachte bis Oktober 1918 noch einmal 18600 Unterschriften zur Unterstützung der Petition zusammen. Dies nicht zuletzt auch dadurch, daß sich bürgerliche und sozialistische Frauen zusammenschlossen und im April 1918 eine gemeinsame Kundgebung zum allgemeinen Frauenstimmrecht organisierten, gefolgt von einer weiteren gemeinsamen Versammlung im Oktober 1918, an der über 5000 Frauen teilnahmen.34
Am 2. November 1918 wurden die bis dahin gesammelten Unterschriften Bürgermeister von Melle überreicht, auf die der Senat jedoch nicht mehr reagierte. Am 12. November gab in Berlin der Rat der Volksbeauftragten das allgemeine und gleiche Wahlrecht für beide Geschlechter bekannt, und im Januar 1919 wurde so die deutsche Nationalversammlung gewählt. Das Bürgerrecht, wie es in Hamburg existierte, hatte seine Existenzberechtigung verloren und wurde 1919 zum letzten Mal vergeben. Ab 1919 hatten alle Einwohner Hamburgs in politischer Hinsicht die gleichen staatsbürgerlichen Rechte.
Mit der politischen Gleichstellung gingen dann in den folgenden Jahren auch die Zulassung von Frauen in wirtschaftliche Vereinigungen einher. Kauffrauen durften seit 1922 an die Börse. 1927 schließlich wurde ihnen auch der Zugang zur kaufmännischen Vereinigung des "Ehrbaren Kaufmanns" gestattet.35 Doch da waren mehr als sechzig Jahre seit der Aufhebung des weiblichen Bürgerrechts und der Einführung der Gewerbefreiheit vergangen.
7 Literaturverzeichnis
7.1 Quellen
7.1.1 Unveröffentlichte Quellen
Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen
Ratsarchiv: Bürgerrecht
- 1 Generalia et Diversa (1555-1931).
Akt. 73. Protokolle der Deputation zur Revision der das Bürgerrecht betreffenden Einrichtungen (1861-1862).
- 5a Bürgerrecht mit Handlungsfreiheit und dessen Ertheilung und Gewinnung überhaupt, und deshalb erlassene Conclusa (1729-1863).
- 11. b. 0. Schenkung und Restitution des Bürgerrechts an Domestiken wegen Dienstjahre. Generalia et Diversa (1428-1871).
Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg
Bestand 111-1 Senat
- Cl. VII Lit. Bc Nr. 7b: Bürgerrecht, Staatsangehörigkeit, Heimatrecht
Fasc. 6b1 Anhaltung zur Gewinnung des Bürgerrechts durch die Bürger-Capitäne 1783; Zulassung von Frauen zum Bürgerrecht (Einzelfälle) 1790, 1798-1802; Atteste über die Bürgerannahmen 1798-1803.
Fasc. 7 Conclusa wegen Annahme der Bürger.
Fasc. 20 Acta, betreffend Reassumirung der Verhandlungen zur Regulirung der hiesigen bürgerrechtlichen Verhältnisse, Fremden- und Gesindepolizei und daraus resultirende neue Verordnungen: 1, über Gewinnung, Kosten und Aufhebung des Bürgerrechts beliebt durch R[ath] und B[ürger] Schluß, 2. Mai 1833, publicirt 30. December 1833; 2, in Beziehung auf das Gesinde, beliebt 28. Nov. 1833; 3, die s. g. wilden Ehen betr., publicirt 13. Mai 1833 (1829-1837).
Fasc. 30 Acta betreffend die Revision der Verordnung über die Gewinnung, die Kosten und die Aufhebung des Bürgerrechts, erledigt durch den R[ath] und B[ürger] Schluß vom 23. October 1845, in welchem die Verordnung über das Hamburgische Bürgerrecht beliebt und deren Revision nach 5 Jahren zugesagt worden ist (1843-1847).
Fasc. 32 Prinzipien bei der Zulassung zum Bürgerrecht.
Fasc. 45a Acta betr. den Entwurf einer Verordnung über das Niederlassungsrecht Fremder zur ungehinderten Betreibung von Geschäften und Gewerben ohne Erwerbung des hiesigen Bürgerrechtes (1861, 1863).
Fasc. 45b Acta betr. das Gesetz über die Staatsangehörigkeit und das Bürgerrecht, publ. d. 7. Nov. 1864 mit Gesetzeskraft vom ersten Febr. 1865, u. dessen Ausführung nebst Gesuch des Landesvorstandes zu Billwerder u. Ochsenwerder um Wiederaufhebung des Gesetzes (1862-1866).
- Cl. VII Lit. Bc Nr. 7c: Ex nexu civico Entlassene
Fasc. 20 - 37 und 37a-p.
- Cl. VII Lit. Bf Vol. 4: Schriftliche Protokolle über die Verhandlungen der Bürgerschaft
Fasc. 3 (1862) - 5 (1864).
Bestand 121-3I Bürgerschaft I
- B1 Protokolle [der Bürgerschaft] mit Anlagen Bd. 3 (1862) - 5(1864).
- C1118 Ausarbeitung eines Gewerbegesetzes, eines Gesetzes über Staatsangehörigkeit und Bürgerrecht und eines Gesetzes über die Entschädigung für die Aufhebung der Realgerechtsame (1860, 1861-1864).
Bestand 332-7 Staatsangehörigkeitsaufsicht
- AIa Bürgerbücher,
Bd. 22 (1851-1854).
- AIf Bürgerprotokolle (über Annahme und Zulassung zum Bürgerrecht),
Bde. 1-142 (1811-1865).
7.1.2 Veröffentlichte Quellen
- Anleitung für Diejenigen, welche das Hamburgische Bürgerrecht zu gewinnen wünschen, Hamburg 1848.
- Baumeister, H., Das Privatrecht der freien und Hansestadt Hamburg, 2 Bde., Hamburg 1856.
- Ders., Die Mündigkeit unserer Jungfrauen und Wittwen. Gesetzentwurf mit Motiven, Hamburg 1862.
- Buek, Georg, Handbuch der hamburgischen Verfassung und Verwaltung, Hamburg 1828.
- Commentar zum Hamburgischen Stadtrecht von 1603. Aus dem handschriftlichen Nachlasse von Dr. J. K. Gries, hg. v. N. A. Westphalen, 2 Bde., Hamburg 1837.
- "Dem Reich der Freiheit werb′ ich Bürgerinnen". Die Frauenzeitung von Louise Otto, hg. und kommentiert v. Ute Gerhard, Elisabeth Hannover-Drück und Romina Schmitter, Frankfurt a. M. 1980.
- Denkwürdigkeiten aus dem Leben von Amalie Sieveking in deren Auftrage von einer Freundin derselben verfaßt. Mit einem Vorwort von Dr. Wichern, Hamburg 1860.
- Der Bürgerfreund. Oder: Der erfahrene Rathgeber in allen bürgerlichen Lagen und Verhältnissen. Ein unentbehrliches Hand- und Hülfsbuch für jeden Bürger und Einwohner Hamburgs, der Vorstädte und des Landgebiets. Verfaßt von einem practischen Rechtsgelehrten, Hamburg 1831.
- Die factische Bevölkerung nach dem Familienstand geordnet. Recapitulation, in: Statistik des Hamburgischen Staats. Zusammengestellt vom statistischen Bureau der Deputation für directe Steuern. Heft 1. Ergebnisse der Volkszählung vom 3ten December 1866. Stand der Bevölkerung, Hamburg 1867.
- Die Memoiren der Glückel von Hameln. Mit einem Vorwort von Viola Roggenkamp. Autorisierte Übertragung nach der Ausgabe von Prof. Dr. David Kaufmann, Wien 1910, Weinheim 1994.
- Gesetz, betreffend die Gewerbekammer vom 18.12.1872, in: Gesetzsammlung der freien und Hansestadt Hamburg. Amtliche Ausgabe, 8(1872), S. 119-123.
- Gesetz, betr. die Staatsangehörigkeit und das Bürgerrecht. Auf Befehl E. H. Senats der freien und Hansestadt Hamburg publicirt den 7. November 1864, in: Sammlung der Verordnungen der freien und Hansestadt Hamburg seit 1814, bearb. v. J. M. Lappenberg, 32(1864), Hamburg 1865, S. 150-160.
- Gesetz, die Staatsangehörigkeit, das Staatsbürgerrecht und die Schutzgenossenschaft betreffend. Publicirt am 20. November 1866, in: Sammlung der Lübeckischen Verordnungen und Bekanntmachungen, 33(1866), Lübeck 1866, S. 96-102.
- Gewerbegesetz. Auf Befehl E. H. Senats der freien und Hansestadt Hamburg publicirt den 7. November 1864, in: Sammlung der Verordnungen der freien und Hansestadt Hamburg seit 1814, bearb. v. J. M. Lappenberg, 32(1864), Hamburg 1865, S. 161-179.
- Hamburgisches Adressbuch für die Jahre 1827-1865. (Mit Ausnahme der im StAHbg nicht mehr zugänglichen Jahrgänge 1830, 1832-34, 1837f., 1841, 1843f, 1847, 1849, 1851, 1854 und 1856f.)
- Jahresbericht der Hamburgischen Gewerbekammer für 1873/74, Hamburg 1875.
- Kühne, A., Giebt es ein Mittel, die Lage der unversorgten Mädchen und Wittwen in den Mittelständen zu verbessern? Eine sozial-pädagogische Frage, Berlin 1859.
- Meysenbug, Malwida von, Memoiren einer Idealistin und ihr Nachtrag: Lebensabend einer Idealistin, 2 Bde., Berlin o. J.
- Neddermeyer, F. H., Zur Statistik und Topographie der Freien und Hansestadt Hamburg und deren Gebietes, Hamburg 1847.
- Obrigkeitliche Verordnung, die Stadtgemeinden zu Vegesack und Bremerhaven betreffend. Publicirt am 5. Juli 1850, in: Gesetzblatt der freien Hansestadt Bremen 1850, Bremen 1851, S. 75-82.
- Raschke, Marie, Die Ausschließung der Frauen von der Börse, in: Ariadne. Almanach des Archivs der deutschen Frauenbewegung, Heft 19, Mai 1991, S. 16.
- Verordnung, die Aufhebung der bisherigen Gewerbeprivilegien in der Stadt Bremen betreffend. Publicirt am 4. April 1861, in: Gesetzblatt der freien Hansestadt Bremen 1861, Bremen 1862, S. 10ff.
- Verordnung über die gegen das Einschleichen der Fremden erlassene Verfügung und bei der Annahme zum Bürger beliebte Einrichtung vom 20. November 1805, in: Sammlung Hamburgischer Verordnungen, hg. v. Christian Daniel Anderson, 7(1805-1808), Hamburg 1809, S. 51-55.
- Verordnung über die gegen das Einschleichen von Fremden erlassene Verfügung und bei der Annahme zum Bürger oder Schutzbürger beliebte Einrichtung; zur Publication in der Jurisdiction des Wohlw[eisen] Landherrn des Hamburgerberges vom 10. Januar 1806, in: Sammlung Hamburgischer Verordnungen, hg. v. Christian Daniel Anderson, 7(1805-1808), Hamburg 1809, S. 67-72.
- Verordnung über die Gewinnung, die Kosten und die Aufhebung des Bürger-Rechts, welche durch den Rath- und Bürgerschluß vom 2. May 1833, vorläufig auf Fünf Jahre beliebt worden. Auf Befehl Eines Hochedlen Raths der freyen Hansestadt Hamburg, publicirt den 30. December 1833, in: Sammlung der Verordnungen der freien und Hansestadt Hamburg seit 1814, bearb. v. J. M. Lappenberg, 12(1832/33), Hamburg 1834, S. 488-497.
- Verordnung über die Gewinnung, die Kosten und die Aufhebung des Bürger-Rechts, welche durch den Rath- und Bürger-Schluß vom 20. December 1838 auf Fünf Jahre beliebt worden. Auf Befehl eines Hochedlen Raths der freien Hansestadt Hamburg publicirt den 2. Januar 1839, in: Sammlung der Verordnungen der freien und Hansestadt Hamburg seit 1814, bearb. v. J. M. Lappenberg, 15(1837-1839), Hamburg 1840, S. 348-356.
- Verordnung über das Hamburgische Bürgerrecht. Beliebt durch Rath- und Bürgerschluß vom 23. Oct. 1845. Auf Befehl eines Hochedlen Raths der freien Hansestadt Hamburg publicirt den 29. Oct. 1845, in: Sammlung der Verordnungen der freien und Hansestadt Hamburg seit 1814, bearb. v. J. M. Lappenberg, 19(1845/46), Hamburg 1847, S. 135-152.
- Verordnung über die Schutzverwandtschaft in der Stadt nach Rath- und Bürgerschluß vom 3.7.1837, in: Sammlung der Verordnungen der freien und Hansestadt Hamburg seit 1814, bearb. v. J. M. Lappenberg, 15(1837-1839), Hamburg 1840, S. 94-100.
- Vorschrift für diejenigen die das Bürgerrecht nachsuchen vom 20. November 1805, in: Sammlung Hamburgischer Verordnungen, hg. v. Christian Daniel Anderson, 7(1805-1808), Hamburg 1809, S.56-58.
- Westphalen, N. A., Hamburgs Verfassung und Verwaltung in ihrer allmähligen Entwickelung bis auf die neueste Zeit, 2 Bde., Hamburg 1841.
- Zusammenstellung der ortsanwesenden Bevölkerung nach Stand und Beruf, in: Statistik des Hamburgischen Staats. Zusammengestellt vom statistischen Bureau der Deputation für directe Steuern, Heft II. Ergebnisse der Volkszählung vom 3. December 1867. Bevölkerungs und Wohnverhältnisse. Statistik der Unterrichtsanstalten von 1869, Hamburg 1869, S. 34-48.
7.1.3 Zeitungsartikel
- Beilage der Hamburger Nachrichten, Nr. 26 vom 30.1.1864 bis Nr. 142 vom 16. Juni 1864.
- Börsen-Halle, Abendausgabe vom 14.9.1864.
- Das neue Hamburg, Nr. 15 vom 20.2.1983, Nr. 17 vom 27.2.1863, Nr. 19 vom 6.3.1863, Nr. 37 vom 8.5.1863 und Nr. 41 vom 20.5.1864.
- Hamburger Nachrichten, Nr. 14 vom 16.1.1864 bis Nr. 72. vom 2.4.1864.
- Hamburger Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe, Nr. 23 vom 28.1.1864 und Nr. 26 vom 1.2.1864.
- Hamburgische Blätter, Nr. 4 vom 25.1.1834.
- Hamburgische Gerichts-Zeitung, Nr. 25 vom 18.6.1864.
- Staats und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheiischen Correspondenten, Nr. 103 vom 8.5.1863.
7.2 Literatur
- Baumann, Ursula, Protestantismus und Frauenemanzipation in Deutschland 1850-1920, Frankfurt a. M./New York 1992 (Geschichte und Geschlechter, Bd. 2).
- Bavendamm, Dirk, "Keine Freiheit ohne Maß". Hamburg in der Revolution von 1848/49, in: Jörg Berlin (Hg.), Das andere Hamburg. Freiheitliche Bestrebungen in der Hansestadt seit dem Spätmittelalter, Köln 1981 (Kleine Bibliothek, Bd. 237), S. 69-92.
- Behrends, L., Kosten des Erwerbs des Kleinbürgerrechts durch einen Nicht-Hamburger und der Uniformierung als Bürgergardist im Jahre 1844, in: MHG, 11(1911-1913), S. 108f.
- Bertram, Alfred, Die Codification der hamburgischen Nexusverhältnisse unter besonderer Berücksichtigung der Entlassung ex nexu, in: Hanseatische Rechts- und Gerichts-Zeitschrift, Heft 6, 14(1931), Abt. A, Sp. 321-350.
- Berufe in Altona 1803. Berufssystematik für eine präindustrielle Stadtgesellschaft anhand der Volkszählung, hg. v. Hajo Brandenburg, Rolf Gehrmann, Kersten Krüger, Andreas Künne und Jörn Rüffer, Kiel 1991 (Kleine Schriften des Arbeitskreises für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins, Bd. 1).
- Borowsky, Peter, Die Restauration der Verfassungen in Hamburg und in den anderen Hansestädten nach 1813, in: Arno Herzig (Hg.), Das alte Hamburg (1500-1848/49). Vergleiche · Beziehungen, Hamburg 1989 (Hamburger Beiträge zur öffentlichen Wissenschaft, Bd. 5), S. 155-175.
- Braun, Lily, Die Frauenfrage. Ihre geschichtliche Entwicklung und ihre wirtschaftliche Seite. Mit einem Vorwort von Beatrix W. Bouvier, Nachdruck der 1901 in Leipzig erschienen 1. Aufl., Berlin/Bonn 1979.
- Brodmeier, Beate, Die Frau im Handwerk in historischer und moderner Sicht, Münster 1963 (Forschungsberichte aus dem Handwerk, Bd.9).
- Eckardt, Hans Wilhelm, Privilegien und Parlament. Die Auseinandersetzungen um das allgemeine und gleiche Wahlrecht in Hamburg, Hamburg 1980.
- Engelsing, Rolf, Zur Sozialgeschichte deutscher Mittel- und Unterschichten, 2., erw. Aufl., Göttingen 1978. (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, Bd. 4).
- Ennen, Edith, Die Frau in der mittelalterlichen Stadtgesellschaft Mitteleuropas, in: HGBll, 98(1980), S. 1-22.
- Dies., Frauen im Mittelalter, München 1984.
- Dies., Frauen in der mittelalterlichen Stadt, in: RhVBll, 55(1991), S. 21-31.
- Freudenthal, Herbert, Vereine in Hamburg. Ein Beitrag zur Geschichte und Volkskunde der Geselligkeit, Hamburg 1968 (Volkskundliche Studien, Bd. IV).
- Frevert, Ute (Hg.), Bürgerinnen und Bürger. Geschlechterverhältnisse im 19. Jahrhundert. Zwölf Beiträge. Mit einem Vorwort von Jürgen Kocka, Göttingen 1988 (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, Bd. 77).
- Gall, Lothar, "... ich wünschte ein Bürger zu sein", in: HZ, 245(1987), S. 601-623.
- Gall, Lothar, Stadt und Bürgertum im 19. Jahrhundert. Ein Problemaufriß, in: ders.(Hg.), Stadt und Bürgertum im 19. Jahrhundert, München 1990, S.1-18.
- Gerhard, Ute, Verhältnisse und Verhinderungen. Frauenarbeit, Familie und Rechte der Frauen im 19. Jahrhundert. Mit Dokumenten, Frankfurt a. M. 1978.
- Dies., Unerhört. Die Geschichte der deutschen Frauenbewegung. Unter Mitarbeit von Ulla Wischmann, Reinbek b. Hamburg 1990.
- Grolle, Dr. Ingeborg, Demokratie ohne Frauen? In Hamburg um 1848, Hamburg 1988 (Geschichte-Schauplatz Hamburg).
- Grumbach, Detlef, Malwida von Meysenbug und die Hamburger "Hochschule für das weibliche Geschlecht", in: "... und nichts als nur Verzweiflung kann uns retten!" Grabbe-Jahrbuch, 11(1992), S. 149-161.
- Haff, Karl, Die Kaufmannsehefrau nach dem Hamburger Privatrechte, mit einem Rechtsgutachten, in: F. Klausing, C. Nipperdey und A. Nußbaum (Hg.), Beiträge zum Wirtschaftsrecht, 1(1931), S. 309-315.
- Hagemannn, Karen und Jan Kolossa, Gleiche Rechte - Gleiche Pflichten? Der Frauenkampf für »staatsbürgerliche« Gleichberechtigung. Ein Bilder-Lese-Buch zu Frauenalltag und Frauenbewegung in Hamburg, Hamburg 1990.
- Hammonias Töchter. Frauen und Frauenbewegung in Hamburgs Geschichte, Hamburg 1985 (Hamburg-Porträt, Heft 21).
- Hedinger, Hans Walter, Kurzinventar der historischen Hamburger Grenzsteine mit einem Abriß der Hamburger Territorialgeschichte, Hamburg 1972.
- Hering-Zalfen, Sabine, Die Hamburger Jahre, in: Malwida von Meysenbug. Ein Portrait, hg. und mit einem Nachwort versehen v. Gunther Tietz, Frankfurt a. M/Berlin/Wien 1983, S. 55-70.
- Hervé, Florence, "Dem Reich der Freiheit werb ich Bürgerinnen". Die Entwicklung der deutschen Frauenbewegung von den Anfängen bis 1889, in: dies. (Hg.), Geschichte der deutschen Frauenbewegung, Köln 1983, S. 12-40.
- Herzig, Arno, Kontinuität im Wandel der politischen und sozialen Vorstellungen Hamburger Handwerker 1790-1870, in: Ulrich Engelhardt (Hg.), Handwerker in der Industrialisierung. Lage, Kultur und Politik, vom späten Mittelalter bis ins frühe 20. Jahrhundert, Stuttgart 1984 (Industrielle Welt, Bd. 37), S. 294-319.
- Hlawatschek, Elke, Die Unternehmerin (1800-1945), in: Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, Beiheft 35: Die Frau in der deutschen Wirtschaft, Wiesbaden/Stuttgart 1985, S. 127-146.
- Ichikawa, Yoriko, Die Stellung der Frauen in den Handwerksämtern im spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Lübeck, in: ZLGA, 66(1986), S. 91-118.
- Ipsen, Hans, Der Verlust des hamburgischen Bürger- und Heimatsrechtes durch Versitzung, in: Hanseatische Rechts- und Gerichts-Zeitschrift, Heft 11, 21(1938), Abt. A, Sp. 411-422.
- Kayser, Rudolf, Malvida von Meysenbugs Hamburger Lehrjahre, in: ZHG, 28(1927), S. 116-128.
- Kerchner, Brigitte, Beruf und Geschlecht. Frauenberufsverbände in Deutschland 1848-1908, Göttingen 1992 (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, Bd. 97).
- Knapp, Ulla, Frauenarbeit in Deutschland, Bd. 1: Ständischer und bürgerlicher Patriarchalismus. Frauenarbeit und Frauenrolle im Mittelalter und im Bürgertum des 19. Jahrhunderts, 2. Aufl., München 1986.
- Kocka, Jürgen, Bürgertum und Bürgerlichkeit als Probleme der deutschen Geschichte vom späten 18. zum frühen 20. Jahrhundert, in: ders.(Hg.), Bürger und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert, Göttingen 1987, S. 21-63.
- Kopitzsch, Franklin, Grundzüge der Aufklärung in Hamburg und Altona, 2 Teile, Hamburg 1982. (Beiträge zur Geschichte Hamburgs, Bd. 21).
- Ders., Aufklärung, freie Assoziation und Reform: Das Vereinswesen in Hamburg im 18. und frühen 19. Jahrhundert, in: Arno Herzig (Hg.), Das alte Hamburg (1500-1848/49). Vergleiche · Beziehungen, Hamburg 1989 (Hamburger Beiträge zur öffentlichen Wissenschaft, Bd. 5), S. 209-223.
- Kortmann, Marie, Emilie Wüstenfeld. Eine Hamburger Bürgerin, Hamburg 1927 (Hamburgische Hausbibliothek, Bd. 10).
- Kraus, Antje, Die Unterschichten Hamburgs in der ersten Hälfte des 19 Jahrhunderts. Entstehung, Struktur und Lebensverhältnisse. - Eine historisch-statistische Untersuchung -, Stuttgart 1965 (Sozialwissenschaftliche Studien, Heft 9).
- Kwiet, Herbert, Die Einführung der Gewerbefreiheit in Hamburg 1861-1865, phil. Diss., Hamburg 1947 (masch.).
- Laurent, J. C. M., Über das älteste Bürgerbuch, in: ZHG, 1(1841), S. 141-155.
- Ders., Über das zweitälteste Bürgerbuch, in: ZHG, 1(1841), S. 156-168.
- Lehr, Walther, Das Bürgerrecht im Hamburgischen Staate, jur. Diss. Greifswald, Hamburg 1919.
- Loose, Hans-Dieter, Erwerbstätigkeit der Frau im Spiegel Lübecker und Hamburger Testamente des 14. Jahrhunderts, in: ZLGA, 60(1980), S. 9-20.
- Ders. (Hg.), Hamburg. Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner, Bd. 1, Hamburg 1982.
- Lühr, Dora, Die Frau in der Kulturgeschichte des deutschen Kleinhandels, in: Ehrengabe des Museums für Hamburgische Geschichte zur Feier seines hundertjährigen Bestehens. Eine Sammlung von Beiträgen zur Hamburgischen Geschichte und zur allgemeinen deutschen Altertumskunde, hg. v. Otto Lauffer, Hamburg 1939, S. 36-43.
- Marschalck, Peter, Der Erwerb des bremischen Bürgerrechts und die Zuwanderung nach Bremen um die Mitte des 19. Jahrhunderts, in: BremJb, 66(1988), S. 295-305.
- Matti, Werner, Die Bevölkerungsvorgänge in den Hansestädten Hamburg und Bremen vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg, in: ZHG, 69(1983), S. 103-155.
- Mauersberger, Hans, Wirtschafts- und Sozialgeschichte zentraleuropäischer Städte in neuerer Zeit. Dargestellt an den Beispielen von Basel, Frankfurt a. M., Hamburg, Hannover und München, Göttingen 1960.
- Meyer-Renschhausen, Elisabeth, Weibliche Kultur und soziale Arbeit. Eine Geschichte der Frauenbewegung am Beispiel Bremens 1810-1927, Köln/Wien 1989.
- Möller, Christa, Vom Dienen und (Mit)verdienen, Heft I: 500 Jahre Leben und Arbeiten von Frauen in Hamburg. Vom Spätmittelalter bis zur Industrialisierung. Begleitheft I des museumspädagogischen Dienstes zur Ausstellung "Hammonias Töchter - Frauen und Frauenbewegung in Hamburgs Geschichte", Hamburg 1985.
- Niermann, Charlotte, Die Bedeutung und sozioökonomische Lage Bremer Kleinhändlerinnen zwischen 1890 und 1914, in: Geschäfte, Teil 1: Der Bremer Kleinhandel um 1900, hg. v. Wiltrud Ulrike Drechsel, Heide Gerstenberger und Christian Marzahn, Bremen 1982 (Beiträge zur Sozialgeschichte Bremens, Heft 4), S. 85-109.
- Osterloh, Johannes, Die Rechtsstellung der Handelsfrau, jur. Diss., Eutin 1919.
- Paletschek, Sylvia, Frauen und Dissens. Frauen im Deutschkatholizismus und in den freien Gemeinden 1841-1852, Göttingen 1990 (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, Bd. 89).
- Dies., Sozialgeschichte der Frauen im revolutionären Zeitalter (1840er und 1850er Jahre), in: Barbara Vogel und Ulrike Weckel (Hg.), Frauen in der Ständegesellschaft, Hamburg 1991 (Beiträge zur deutschen und europäischen Geschichte, Bd. 4), S. 285-306.
- Postel, Rainer, Amalie Sieveking, in: Gestalten der Kirchengeschichte, Bd. 9,1, Stuttgart 1985, S. 233-242.
- Ders., Versammlung eines Ehrbaren Kaufmanns 1517-1992. Kaufmännische Selbstverwaltung in Geschichte und Gegenwart, Hamburg 1992.
- Reineke, Karl, Das bremische Bürgerrecht, in: BremJb, 32(1929), S. 195-232.
- Schildt, Gerhard, Frauenarbeit im 19. Jahrhundert, Pfaffenweiler 1993 (Frauen in Geschichte und Gesellschaft, Bd. 27).
- Schmitter, Romina, Der lange Weg zur politischen Gleichberechtigung der Frauen in Bremen. Texte und Materialien zum historisch-politischen Unterricht, Bremen 1991 (Kleine Schriften des Staatsarchivs Bremen, Heft 19).
- Schmoller, Gustav, Zur Geschichte der deutschen Kleingewerbe im 19. Jahrhundert. Statistische und nationalökonomische Untersuchungen, Halle 1870.
- Schneider, Konrad, Hamburgs Münz- und Geldgeschichte im 19. Jahrhundert bis zur Einführung der Reichswährung, Koblenz 1983 (Beiträge zur Geschichte Hamburgs, Bd. 22).
- Stieve, Tilman, Der Kampf um die Reform in Hamburg 1789-1842, Hamburg 1993 (Beiträge zur Geschichte Hamburgs, Bd. 44).
- Stubbe-da Lutz, Helmut, Emma Ender (1875-1954), in: ders.: Die Stadtmütter Ida Dehmel, Emma Ender, Margarete Treuge, Hamburg 1994 (Hamburgische Lebensbilder in Darstellungen und Selbstzeugnissen, Bd. 7), S. 39-60.
- Twellmann, Margrit, Die deutsche Frauenbewegung. Ihre Anfänge und erste Entwicklung 1843-1889, Neuaufl., Frankfurt a. M. 1993 (Athenäums Studienbuch Geschichte).
- Uitz, Erika, Die Frau in der mittelalterlichen Stadt, durchgesehene und verbesserte Ausgabe, Freiburg/Basel/Wien 1992 (Herder/Spektrum, Bd. 4081).
- Vogel, Barbara und Ulrike Weckel (Hg.), Frauen in der Ständegesellschaft, Hamburg 1991 (Beiträge zur deutschen und europäischen Geschichte, Bd. 4).
- Wensky, Margret, Die Stellung der Frau in der stadtkölnischen Wirtschaft im Spätmittelalter, Köln/Wien 1980 (Quellen und Darstellungen zur Hansischen Geschichte, Neue Folge 26).
- Dies., Frauen in der Hansestadt Köln, in: Barbara Vogel und Ulrike Weckel (Hg.), Frauen in der Ständegesellschaft. Leben und Arbeiten in der Stadt vom späten Mittelalter bis zur Neuzeit, Hamburg 1991 (Beiträge zur deutschen und europäischen Geschichte, Bd. 4), S. 49-68.
1 Vgl. Uitz, S. 11.
2 Vgl. Barbara Vogel und Ulrike Weckel (Hg.), Frauen in der Ständegesellschaft. Leben und Arbeiten in der Stadt vom späten Mittelalter bis zur Neuzeit, Hamburg 1991 (Beiträge zur deutschen und europäischen Geschichte, Bd. 4). Die Aufsätze dieser Sammlung sind Ergebnis einer Ringvorlesung, die im Sommersemester 1989 an der Universität Hamburg stattfand.
3 Allgemeine Studien zur Stellung der Frau im 19. Jahrhundert lieferten z. B. Ute Gerhard, Verhältnisse und Verhinderungen. Frauenarbeit, Familie und Rechte der Frauen im 19. Jahrhundert. Mit Dokumenten, Frankfurt a. M. 1978. Gerhard bezieht sich dabei jedoch weitestgehend auf die Situation in Preußen. Zur Rolle der bürgerlichen Frau im 19. Jahrhunderts erschien u. a. Ute Frevert (Hg.), Bürgerinnen und Bürger. Geschlechterverhältnisse im 19. Jahrhundert. Zwölf Beiträge. Mit einem Vorwort von Jürgen Kocka, Göttingen 1988 (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, Bd. 77). Zu den Formen der Erwerbstätigkeit von Frauen im 19. Jahrhundert vgl. u. a. Gerhard Schildt, Frauenarbeit im 19. Jahrhundert, Pfaffenweiler 1993 (Frauen in Geschichte und Gesellschaft, Bd. 27).
4 Vgl. zum Bürgerbegriff und bürgerlichem Selbstverständnis u. a. Lothar Gall, "... ich wünschte ein Bürger zu sein", in: HZ, 245(1987), S. 601-623, hier S. 618 und Jürgen Kocka, Bürgertum und Bürgerlichkeit als Probleme der deutschen Geschichte vom späten 18. zum frühen 20. Jahrhundert, in: ders.(Hg.), Bürger und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert, Göttingen 1987, S. 21-63.
5 Lothar Gall unterscheidet sechs Kategorien von Städten im 19. Jahrhundert. Städte wie Hamburg, Bremen und Köln als traditionelle Handels- und Gewerbestädte existieren neben Industriestädten (Dortmund, Essen, Bochum), Residenz- und Verwaltungsstädten (München, Wiesbaden, Münster), Universitätsstädten (Göttingen, Heidelberg, Bonn) und Städten, deren Entwicklung seit dem Ende des 18. Jahrhunderts stagniert oder nur langsam voran geht [Lübeck]. Nach den städtischen Gegebenheiten unterschied sich, so vermutet Gall, auch die Zusammensetzung und das Selbstverständnis des jeweiligen Bürgertums. Vgl. Lothar Gall, Stadt und Bürgertum im 19. Jahrhundert. Ein Problemaufriß, in: ders.(Hg.), Stadt und Bürgertum im 19. Jahrhundert, München 1990, S.1-18, hier S. 17f.
6 Vgl. Tilman Stieve, Der Kampf um die Reform in Hamburg 1789-1842, Hamburg 1993 (Beiträge zur Geschichte Hamburgs, Bd. 44), S. 32.
7 Über die gesamte Entwicklung der äußeren Rechtsform des Bürgerrechts und der anderen Formen des Nexus gibt noch immer Walther Lehr die detaillierteste Übersicht. Allerdings geht er dabei nicht auf die tatsächliche Bedeutung des Bürgerrechts während seiner Entwicklung ein, sondern beschränkt die Betrachtung über die "praktische Bedeutung" auf das Bürgerrechtsgesetz von 1896. Vgl. Walther Lehr, Das Bürgerrecht im Hamburgischen Staate, jur. Diss. Greifswald, Hamburg 1919.
8 Vgl. ebd., S. 26ff. u. 55ff. und Stieve, S. 32f.
9 Vgl. Verordnung über die gegen das Einschleichen der Fremden erlassene Verfügung und bei der Annahme zum Bürger beliebte Einrichtung vom 20. November 1805, in: Sammlung Hamburgischer Verordnungen, hg. v. Christian Daniel Anderson, 7(1805-1808), Hamburg 1809, S. 51-55 (im folgenden zit. als: Bürgerrechtsverordnung 1805).
10 Vgl. Vorschrift für diejenigen die das Bürgerrecht nachsuchen vom 20. November 1805, in: Sammlung Hamburgischer Verordnungen, hg. v. Christian Daniel Anderson, 7(1805-1808), Hamburg 1809, S.56-58 (im folgenden zit. als: Bürgerrechtsvorschrift 1805).
11 Der Begriff Senat für den Rat der Stadt setzte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts durch. In dieser Arbeit wird außer in Zitaten, in denen vom Rat die Rede ist, die Bezeichnung Senat verwendet.
12 Vgl. Gesetz, betr. die Staatsangehörigkeit und das Bürgerrecht. Auf Befehl E. H. Senats der freien und Hansestadt Hamburg publicirt den 7. November 1864, in: Sammlung der Verordnungen der freien und Hansestadt Hamburg seit 1814, bearb. v. Dr. J. M. Lappenberg, 32(1864), Hamburg 1865, S. 150-160 (im folgenden zit. als: Bürgerrechtsgesetz 1864).
13 Vgl. Alfred Bertram, Die Codification der hamburgischen Nexusverhältnisse unter besonderer Berücksichtigung der Entlassung ex nexu, in: Hanseatische Rechts- und Gerichts-Zeitschrift, Heft 6, 14(1931), Abt. A, Sp. 321-350, hier Sp. 347 u. 350 und Lehr, S. 39.
14 Vgl. Die Memoiren der Glückel von Hameln. Mit einem Vorwort von Viola Roggenkamp. Autorisierte Übertragung nach der Ausgabe von Prof. Dr. David Kaufmann, Wien 1910, Weinheim 1994.
15 Vgl. Hammonias Töchter. Frauen und Frauenbewegung in Hamburgs Geschichte, Hamburg 1985 (Hamburg-Porträt Heft 21), [S. 5f.].
16 So z. B. bei Sylvia Paletschek, Sozialgeschichte der Frauen im revolutionären Zeitalter (1840er und 1850er Jahre), in: Vogel u. Weckel (wie Anm. 3), S. 285-306, hier S. 292. Paletschek spricht den Hamburger Frauen jeglichen Anspruch auf das Bürgerrecht ab. Auch Ingeborg Grolle vertritt die Ansicht, daß es kein weibliches Bürgerrecht gab, obwohl erwerbstätige Frauen in den Bürgerlisten auftauchen, da Frauen keine politischen Rechte hatten. Vgl. Ingeborg Grolle, Demokratie ohne Frauen? In Hamburg um 1848, Hamburg 1988 (Geschichte-Schauplatz Hamburg), S. 4.
17 An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, daß die unveröffentlichten Quellen, die in dieser Arbeit zitiert werden, in den Anmerkungen nur mit ihrer Signatur aufgeführt sind. Der vollständige Titel der jeweiligen Quelle findet sich in der Literaturliste.
18 Vgl. StAHbg 111-1 Senat Cl. VII Lit. Bc Nr. 7c Fasc. 20 - 37 und 37a-p.
19 In Hamburg wurden gewerbliche Korporationen Ämter genannt. Dabei bezeichnete Amt sowohl die gesamte Zunft oder Innung als auch das einzelne Gewerbe, deshalb erwarb der einzelne ein Amt.
20 Ausgeschlossen von der Erbgesessenen Bürgerschaft, auch wenn sie Grundeigentümer waren, waren städtische Beamte und solche, die vor den Toren der Stadt wohnten. Demgegenüber gab es Bürger, die Zugang zum Konvent der Erbgesessenen Bürgerschaft hatten, obwohl sie keine erbgesessenen Bürger waren. Es handelte sich dabei um Bürger, die wegen ihrer Sachkompetenz in Deputationen der Stadt saßen, die als beratende Ausschüsse für einzelne Verwaltungsbereiche fungierten und über diese Funktion zur Erbgesessenen Bürgerschaft zugelassen waren. Außerdem waren Offiziere und Vorsteher der Zünfte zugelassen. Vgl. Lehr, S. 3-8 und Hans Wilhelm Eckardt, Privilegien und Parlament. Die Auseinandersetzungen um das allgemeine und gleiche Wahlrecht in Hamburg, Hamburg 1980, S. 15.
21 Vgl. Lehr, S. 11f. Die Nichtzulassung von Leibeigenen war auch in Hamburg, wie in vielen Städten, dahingehend eingeschränkt, daß Leibeigene, die Jahr und Tag, in späterer Zeit 10 Jahre, in der Stadt gelebt hatten und dies durch zwei Ratsmänner bezeugen ließen, gegen die Ansprüche des Grundherrn geschützt waren und dann auch das Recht hatten, in den städtischen Nexus einzutreten. Vgl. ebd., S. 12.
22 Vgl. ebd.
23 Die verwendete Währungseinheit ist das hamburgische Kurantgeld. Es beherrschte nicht den Geldumlauf, war aber als Zahlungsmittel für Gebühren und alle anderen Zahlungen in die öffentlichen Kassen vorgeschrieben. Eine Mark Kurant bestand aus 16 Schillingen zu je 12 Pfennigen. Vgl. hierzu Konrad Schneider, Hamburgs Münz- und Geldgeschichte im 19. Jahrhundert bis zur Einführung der Reichswährung, Koblenz 1983 (Beiträge zur Geschichte Hamburgs, Bd. 22), bes. S. 10. Zu den Kosten des Bürgerrechts siehe auch Kapitel 2.4.2.
24 Vgl. Lehr, S. 16 und Bertram, Sp. 322f.
25 Vgl. Lehr, S. 16f. und Bertram, Sp. 322.
26 Vgl. Lehr, S. 18.
27 Vgl. Verordnung über die gegen das Einschleichen von Fremden erlassene Verfügung und bei der Annahme zum Bürger oder Schutzbürger beliebte Einrichtung; zur Publication in der Jurisdiction des Wohlw[eisen] Landherrn des Hamburgerberges vom 10. Januar 1806, in: Sammlung Hamburgischer Verordnungen, hg. v. Christian Daniel Anderson, 7(1805-1808), Hamburg 1809, S. 67-72.
28 Vgl. Bürgerrechtsvorschrift 1805, S. 56ff.
29 Vgl. ebd., §2, S. 51.
30 Vgl. Bertram, Sp. 325 u. 327f.
31 Vgl. ebd., Sp. 330.
32 Vgl.StAHbg 111-1 Senat Cl. VII Lit. Bc Nr. 7b Fasc. 20.
33 Vgl. ebd. Inv. 3.
34 Ebd., S. 2. Vgl. hierzu auch N. A. Westphalen, Hamburgs Verfassung und Verwaltung in ihrer allmähligen Entwickelung bis auf die neueste Zeit, Bd. 1, Hamburg 1841, S. 346.
35 StAHbg 111-1 Senat Cl. VII Lit. Bc Nr. 7b Fasc. 20 Inv. 3, S. 2.
36 Vgl. Hamburgische Blätter, Nr. 4 vom 25.1.1834, S. 13f. Das Großbürgerrecht hatte bis 1833 50 Rth Species gekostet. Ab 1834 wurde es um das Vierfache auf 750 Mk (200 Rth Species) angehoben.
37 Vgl. J. C. M Laurent, Über das älteste Bürgerbuch, in: ZHG, 1(1841), S. 141-155, hier S. 143. Laurent nennt drei Frauen in diesem Zeitraum, sagt aber nicht, ob es sich dabei um alle Frauen handelt, die in dem Bürgerbuch aufgeführt waren.
38 Vgl. Westphalen, Bd. 1, Anm. *, S. 346 und Lehr, S. 11.
39 Vgl. Der Bürgerfreund. Oder: Der erfahrene Rathgeber in allen bürgerlichen Lagen und Verhältnissen. Ein unentbehrliches Hand- und Hülfsbuch für jeden Bürger und Einwohner Hamburgs, der Vorstädte und des Landgebiets. Verfaßt von einem practischen Rechtsgelehrten, Hamburg 1831, S. 52-54.
40 Verordnung über die Gewinnung, die Kosten und die Aufhebung des Bürger-Rechts, welche durch den Rath- und Bürgerschluß vom 2. May 1833, vorläufig auf Fünf Jahre beliebt worden. Auf Befehl Eines Hochedlen Raths der freyen Hansestadt Hamburg, publicirt den 30. December 1833, in: Sammlung der Verordnungen der freien und Hansestadt Hamburg seit 1814, bearb. v. Dr. J. M. Lappenberg, 12(1832/33), Hamburg 1834, S. 488-497, hier S. 489 (im folgenden zit. als: Bürgerrechtsverordnung 1833).
41 Vgl. ebd.
42 Vgl. Romina Schmitter, Der lange Weg zur politischen Gleichberechtigung der Frauen in Bremen. Texte und Materialien zum historisch-politischen Unterricht, Bremen 1991 (Kleine Schriften des Staatsarchivs Bremen Heft 19), S.4. Schmitter bezieht diese Feststellung auf den Bürgereid, der in Bremen von Frauen nicht geleistet wurde.
43 Vgl. Uitz, S. 144.
44 Vgl. Margret Wensky, Die Stellung der Frau in der stadtkölnischen Wirtschaft im Spätmittelalter, Köln/Wien 1980 (Quellen und Darstellungen zur Hansischen Geschichte, Neue Folge 26). Einen Überblick über ihre Ergebnisse bietet ihr Beitrag "Frauen in der Hansestadt Köln", in: Vogel u. Weckel (wie Anm. 3), S. 49-68, der im folgenden herangezogen wurde.
45 Vgl. Wensky, Frauen in der Hansestadt Köln, S. 50f.
46 Vgl. Hans-Dieter Loose, Erwerbstätigkeit der Frau im Spiegel Lübecker und Hamburger Testamente des 14. Jahrhunderts, in: ZLGA, 60(1980), S. 9-20, hier S. 14 u. 16-18.
47 Vgl. Yoriko Ichikawa, Die Stellung der Frauen in den Handwerksämtern im spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Lübeck, in: ZLGA, 66(1986), S. 91-118, hier S. 94. 1881 ging Wilhelm Mantel davon aus, daß jede Ausübung eines Gewerbes an den Besitz des Bürgerrechts gebunden war, während Julius Hartwig 1908 in seiner Untersuchung der Frauenfrage in Lübeck zu dem Ergebnis kam, daß mehr Frauen erwerbstätig waren als es Bürgerinnen gab. Vgl. ebd.
48 Vgl. Loose, Erwerbstätigkeit, S. 18.
49 Vgl. Ennen, Frauen im Mittelalter, S. 135f.
50 Vgl. Uitz, S. 49-56.
51 Vgl. ebd., S. 52 u. 54f.
52 Vgl. Dora Lühr, Die Frau in der Kulturgeschichte des deutschen Kleinhandels, in: Ehrengabe des Museums für Hamburgische Geschichte zur Feier seines hundertjährigen Bestehens. Eine Sammlung von Beiträgen zur Hamburgischen Geschichte und zur allgemeinen deutschen Altertumskunde, hg. v. Otto Lauffer, Hamburg 1939, S. 36-43, hier S. 37-40.
53 Georg Buek, Handbuch der hamburgischen Verfassung und Verwaltung, Hamburg 1828, S. 401f.
54 H. Baumeister, Das Privatrecht der freien und Hansestadt Hamburg, Bd. 1, Hamburg 1856, S. 37. Hervorhebung im Original.
55 Vgl. Commentar zum Hamburgischen Stadtrecht von 1603. Aus dem handschriftlichen Nachlasse von Dr. J. K. Gries, hg. v. N. A. Westphalen, Bd. 1, Hamburg 1837, S. 13-31.
56 Zit. nach H. Baumeister, Die Mündigkeit unserer Jungfrauen und Wittwen. Gesetzentwurf mit Motiven, Hamburg 1862, S. 8. Zur Geschlechtsvormundschaft im 19. Jahrhundert in Deutschland vgl. auch Gerhard, Verhältnisse und Verhinderungen, S. 464-474.
57 Commentar, Bd. 1, Anm. _, S. 18f.
58 Vgl. Hamburgische Gerichts-Zeitung, Nr. 25 vom 18.6.1864, S. 193f. Die passive Anerkennung der Frau als Handelsfrau durch den Ehemann war nicht überall üblich. Nach dem preußischen Allgemeinen Landrecht bedurfte es der ausdrücklichen Zustimmung des Mannes. Auch das allgemeine deutsche Handelsgesetzbuch von 1861 sah weiterhin die Einwilligung des Mannes vor, wenn Ehefrauen selbständigen Handel treiben wollten. Diese Abhängigkeit der Handelsfrauen von der Einwilligung des Mannes wurde erst 1900 durch das BGB aufgehoben. Vgl. hierzu Johannes Osterloh, Die Rechtsstellung der Handelsfrau, jur. Diss., Eutin 1919, S. 6.
59 Dies stellte das Handelsgericht 1817 fest. Vgl. Commentar, Bd. 1, Anm.**, S. 19.
60 Buek, Anm., S. 32. Hervorhebung im Original.
61 Vgl. Anhang 1, Nr. 1-20.
62 Vgl. Bürgerrechtsverordnung 1833, § 4 , S. 489f.
63 Vgl. Bürgerrechtsverordnung 1845, § 4 , S. 137.
64 Vgl. Schildt, S. 94.
65 Vgl. Anhang 1, Nr. 1-24.
66 Vgl. Verordnung über die Schutzverwandtschaft in der Stadt nach Rath- und Bürgerschluß vom 3.7.1837, in: Sammlung der Verordnungen der freien und Hansestadt Hamburg seit 1814, bearb. v. J. M. Lappenberg, 15 (1837-1839), Hamburg 1840, S. 94-100.
67 Die im Januar 1839 in Kraft getretene Bürgerrechtsverordnung war lediglich eine Modifizierung der Verordnung von 1833, weshalb sie hier nicht ausführlich behandelt wird. Sie enthielt nur eine Ergänzung, die das Bürgerrecht der Frauen betraf und sich auf den Grundstückserwerb bezog. Vgl. Verordnung über die Gewinnung, die Kosten und die Aufhebung des Bürger-Rechts, welche durch den Rath- und Bürger-Schluß vom 20. December 1838 auf Fünf Jahre beliebt worden. Auf Befehl eines Hochedlen Raths der freien Hansestadt Hamburg publicirt den 2. Januar 1839, in: Sammlung der Verordnungen der freien und Hansestadt Hamburg seit 1814, bearb. v. J. M. Lappenberg, 15(1837-1839), S. 348-356 (im folgenden zit. als: Bürgerrechtsverordnung 1839). In den Jahren 1843 und 1844 wurde die Gültigkeit der Verordnung jeweils um ein Jahr verlängert und dabei 1843 leicht modifiziert. Vgl. hierzu Lehr, S. 19, Anm. 32.
68 Vgl. Verordnung über das Hamburgische Bürgerrecht. Beliebt durch Rath- und Bürgerschluß vom 23. Oct. 1845. Auf Befehl eines Hochedlen Raths der freien Hansestadt Hamburg publicirt den 29. Oct. 1845, in: Sammlung der Verordnungen der freien und Hansestadt Hamburg, bearb. v. J. M. Lappenberg, 19(1845/46), Hamburg 1847, S. 135-152 (im folgenden zit. als: Bürgerrechtsverordnung 1845).
69 Vgl. Anhang 1, Nr. 34-38.
70 Vgl. Bürgerrechtsverordnung 1845, §6, S. 137f.
71 Bürgerrechtsverordnung 1839, §2, S. 348.
72 Auch Westphalen sah diese Befreiung von der Bürgerrechtspflicht als "herkömmliche Ausnahme" an. Vgl. Westphalen, S. 342.
73 Vgl StAHbg 111-1 Senat Cl. VII Lit. Bc Nr. 7b Fasc. 30 Inv. 91, S. 1.
74 Vgl. ebd. Inv. 36, Beilage.
75 Vgl. ebd. Inv. 35, S. 2 u. Inv. 36, S. 1.
76 Vgl. ebd. Inv. 36, S. 1.
77 Vgl. ebd. Inv. 91.
78 Vgl. Bürgerrechtsverordnung 1845, §1, S. 136.
79 Vgl. hierzu Kapitel 2.4.2.
80 So Senator Hudtwalcker 1845. StAHbg 111-1 Senat Cl. VII Lit. Bc Nr. 7b Fasc. 30 Inv. 35, S. 2
81 Vgl Baumeister, Privatrecht, S. 39.
82 Seit der Verordnung von 1833 hatten alle Fremden, wenn sie Bürger wurden, eine Kaution von 500 Mk zu entrichten, die sie für fünf Jahre beim Weddebüro entweder in bar oder in Form von hamburgischen Staatspapieren hinterlegen mußten. Letztere mußten, wenn sie nicht auf den Antragsteller oder die Antragstellerin ausgestellt waren, durch zwei erbgesessene Bürger als Selbstschuldner verbürgt sein. Die Kaution galt als Sicherheit für die Stadt, daß Neubürger oder Neubürgerinnen innerhalb von fünf Jahren weder Steuern schuldig blieben noch der Armenanstalt zur Last fielen.
83 Vgl. StAHbg 111-1 Senat Cl. VII Lit. Bc Nr. 7b Fasc. 30 Inv. 24. Der Schreiber der Wedde stellte hier fest, daß es im Zeitraum seit Inkrafttreten der Verordnung von 1833 bis Mitte Januar 1840 Bürgen gab, die mehr als 130 Mal für Antragsteller gebürgt hatten, so daß davon auszugehen ist, daß es sich hierbei um ein einträgliches Geschäft handelte. Ebd.
84 Vgl Lehr, S. 19f.
85 Vgl. StAHbg 111-1 Senat Cl. VII Lit. Bc Nr. 7b Fasc. 7, Beilage 3.
86 Ebd. Fasc. 20 Inv. 34, S. 9.
87 Vgl. ebd. Fasc.20 Inv. 16.
88 Ebd. Fasc. 32a1 Inv. 5.
89 Vgl. ebd. Fasc. 32a1 Inv. 7 u. 8.
90 Vgl. ebd.
91 Vgl. Anhang 1, Nr. 26, 236, 257, 328, 345, 346, 347, 354, 390, 396.
92 Vgl. Bürgerrechtsverordnung 1805, Punkt 6-8, S. 53ff.; Bürgerrechtverordnung 1833, §§ 7-9, S. 490f.; Bürgerrechtsverordnung 1845, §§ 7-9, S. 138ff.
93 Vgl. Schmitter, S. 3.
94 Vgl. Buek, S. 32.
95 Bürgerrechtsverordnung 1845, §1, S. 136.
96 Anleitung für Diejenigen, welche das Hamburgische Bürgerrecht zu gewinnen wünschen, Hamburg 1848, S. 6. Die Bürgerrechtskosten, die in diesem Ratgeber genannt werden entsprechen nicht exakt denen, die 1845 festgesetzt wurden. Während der Ratgeber von Bürgerrechtskosten für Großbürgerssöhne von 32 Mk 12 Sh für das Großbürgerrecht und von Kleinbürgerssöhnen für das Kleinbürgerrecht von 30 Mk 12 Sh ausgeht, liegen diese Summen laut Anhang zur Bürgerrechtsverordnung 1845 bei 33 Mk 8 Sh und 32 Mk 8 Sh. Dies bedeutet, daß die Kosten für Großbürgerswitwen und -töchter bei 47 Mk 12 und für Kleinbürgerswitwen und -töchtern bei 46 Mk 12 Sh lagen, wie die Tabellen auf S. 33f. zeigen.
97 Vgl. Bürgerrechtsverordnung 1845, Erster Anhang, Punkt 7, S. 148. Der hier und im folgenden angeführte Vergleich zwischen den Bürgerrechtskosten für Frauen und denen für Männer bezieht sich nur auf die direkt mit dem Vorgang in Verbindung stehenden amtlichen Kosten, also das Bürgergeld, die Stempelgebühren und Gebühren für den Bürgereid. Nicht berücksichtigt wurden die Kosten, die den Männern durch die Uniformierung für das Bürgermilitär entstanden oder die eventuellen Kosten einer Genehmigung seitens der Ämter oder der Akzise für den Erwerb das Bürgerrechts, um einen Beruf im Handwerk oder im Nahrungsmittelgewerbe ausüben zu können. Ebenfalls nicht berücksichtigt wurden inoffizielle Kosten, wie die Bezahlung der Bürgen, die ein weitverbreitetes Phänomen war und die ′Trinkgelder′ für das Personal in den Amtsstuben. Alles in allem konnten diese Posten eine Gesamtsumme ergeben, die das Vierfache des eigentlichen Kleinbürgergeldes betrug. Eine Aufstellung über die tatsächlichen Kosten eines fremden Tischlers, der 1844 das Kleinbürgerrecht erlangte, ist zu entnehmen bei L. Behrends, Kosten des Erwerbs des Kleinbürgerrechts durch einen Nicht-Hamburger und der Uniformierung als Bürgergardist im Jahre 1844, in: MHG, 11(1911-1913), S. 108f.
98 Vgl. die Darstellung zum Familienstand der Bürgerinnen in Bild Nr. 3, S. 51
99 Nicht berücksichtigt wurde die seit der Verordnung von 1833 durch alle Fremde zu entrichtende Kaution von 500 Mk.
100 Die Höhe der Kosten für Kleinbürger und Kleinbürgerinnen, die das große Bürgerrecht erwerben wollten, richtete sich ab 1845 nach der Art des vorher erworbenen Kleinbürgerrechts, da die schon geleisteten Zahlungen auf die Großbürgerrechtskosten von 758 Mk 8 Sh angerechnet wurden.
101 Vgl. StAHbg 111-1 Senat Cl. VII Lit. Bc Nr. 7b Fasc. 30 Inv. 9, 10, 16 u. 20-22.
102 Vgl. ebd. Fasc. 30 Inv. 91, S. 6.
103 Dies ergibt sich aus den Eintragungen in den Bürgerbüchern, in denen die Höhe des gezahlten Bürgergeldes festgehalten ist.
104 Vgl. hierzu Anhang 1 und die Darstellung zum Familienstand der Bürgerrechtsantragstellerinnen in Kapitel 3.2.1.
105 Schildt führt bspw. in bezug auf das Betreiben konzessionierter Geschäfte durch Ehefrauen für Braunschweig aus, daß die Dunkelziffer der selbständig Handel treibenden Frauen, die dies auf Konzession des Mannes taten, als relativ hoch angesehen werden muß. Auch für Hamburg muß dies als übliche Praxis angesehen werden. Vgl. Schildt, S. 87.
106 Vgl. StAHbg 111-1 Senat Cl. VII Lit. Bc Nr. 7b Fasc. 30 Inv. 35, S. 2.
107 Vgl. ebd. Fasc. 20 Inv. 3, S. 20.
108 Die Kosten für das Bürgerrecht in Bremen betrugen 1806 für die Altstadt mit Handlungsfreiheit 500 Rth, ohne Handlungsfreiheit 60 Rth. Der Erwerb des Neustädter Bürgerrechts kostete 50 Rth und das der Vorstädte 40 Rth. 1814 wurden die Kosten auf die Hälfte gesenkt und 1820 auf 400 Rth mit Handlungsfreiheit und 50 Rth ohne Handlungsfreiheit in der Altstadt, in der Neustadt 50 Rth und das Vorstadtbürgerrecht auf 40 Rth angehoben. Vgl. Karl Reineke, Das bremische Bürgerrecht, in: BremJb, 32(1929), S. 195-232, hier S. 217f.
109 Vgl. Schmitter, S. 3 und Reineke, S. 222.
110 Vgl. StABrem 2-P. 8. A. 11 b .0. und Reineke, S. 209.
111 Zit. nach Schmitter, S. 3.
112 Vgl. Antje Kraus, Die Unterschichten Hamburgs in der ersten Hälfte des 19 Jahrhunderts. Entstehung, Struktur und Lebensverhältnisse - Eine historisch-statistische Untersuchung -, Stuttgart 1965 (Sozialwissenschaftliche Studien Heft 9), S.89-92.
113 Vgl. ebd., S. 91.
114 Vgl. ebd., S. 60.
115 Vgl. Rolf Engelsing, Zur Sozialgeschichte deutscher Mittel- und Unterschichten, 2., erw. Aufl., Göttingen 1978 (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, Bd. 4), S. 26 u. 30-37.
116 So Ingeborg Grolle, die davon ausgeht, daß die in die hamburgischen Bürgerlisten als selbständig Erwerbstätige eingetragenen Frauen überwiegend Witwen waren; vgl. Grolle, S. 4 und Christa Möller, Vom Dienen und (Mit)verdienen, Heft I: 500 Jahre Leben und Arbeiten von Frauen in Hamburg. Vom Spätmittelalter bis zur Industrialisierung. Begleitheft I des museumspädagogischen Dienstes zur Ausstellung "Hammonias Töchter - Frauen und Frauenbewegung in Hamburgs Geschichte", Hamburg 1985, S. 21.
117 Vgl. Florence Hervé, "Dem Reich der Freiheit werb ich Bürgerinnen". Die Entwicklung der deutschen Frauenbewegung von den Anfängen bis 1889, in: dies. (Hg.), Geschichte der deutschen Frauenbewegung, Köln 1983, S. 12-40, hier S. 13.
118 Vgl. Die factische Bevölkerung nach dem Familienstand geordnet. Recapitulation, in: Statistik des Hamburgischen Staats. Zusammengestellt vom statistischen Bureau der Deputation für directe Steuern. Heft 1. Ergebnisse der Volkszählung vom 3ten December 1866. Stand der Bevölkerung, Hamburg 1867, S. 182 (im folgenden zit. als: Volkszählung 1866).
119 Nach Kraus, S. 35. Einhundert Jahre später hielt auch Lily Braun die Tatsache fest, daß proletarische Männer früh heirateten, weil sie ihre Frauen nicht versorgen mußten. Im Gegenteil, sie sahen das Einkommen der Ehefrau als eine Art Mitgift an, aber "der Mann aus bürgerlichen Kreisen heiratet spät, weil die ganze Last der Bestreitung des Familienlebens auf seinen Schultern ruht, falls er keine reiche Frau findet." Lily Braun, Die Frauenfrage. Ihre geschichtliche Entwicklung und ihre wirtschaftliche Seite. Mit einem Vorwort von Beatrix W. Bouvier, Nachdruck der 1901 in Leipzig erschienen 1. Aufl., Berlin/Bonn 1979, S. 167.
120 Vgl. Volkszählung 1866, S. 182. Statistisches Zahlenmaterial aus Volkszählungen ist immer vorsichtig zu bewerten. Es bleiben sowohl Unsicherheiten hinsichtlich der tatsächlichen Erfassung aller Einwohner und Einwohnerinnen wie auch bei den vorgenommenen Bemessungsgrundlagen. Sinn der Darstellung hier ist es jedoch, eine Tendenz im Verhältnis von alleinstehenden Frauen an der Bevölkerung Hamburgs im Vergleich zu als versorgt geltenden verheirateten Frauen nachzuweisen, wie sie sich generell im 19. Jahrhundert entwickelte. Dafür sind die Ergebnisse der Volkszählung eine ausreichende Grundlage.
121 Vgl. Margrit Twellmann, Die deutsche Frauenbewegung. Ihre Anfänge und erste Entwicklung 1843-1889, Neuauflage, Frankfurt a. M. 1993 (Athenäums Studienbuch Geschichte), S. 28. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, daß Florence Hervé in ihrem schon angemerkten Aufsatz die oben genannten Zahlen zu Bremen und Preußen auch zitiert und dabei auf Lily Brauns "Die Frauenfrage" in der Auflage von 1979, S. 165 verweist. Die genannten Zahlen finden sich aber nicht bei Braun, sondern bei Twellmann, ebd.
122 Vgl. ebd., S. 28f.
123 Vgl. Werner Matti, Die Bevölkerungsvorgänge in den Hansestädten Hamburg und Bremen vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg, in: ZHG, 69(1983), S. 103-155, hier S. 115 u. 128.
124 Vgl. Eckardt, S. 18.
125 Die Zahlen der männlichen Bürgeranträge wurden bis zum 16.11.1864 erhoben, dem Tag, an dem die letzte Frau zum Bürgerrecht zugelassen wurde.
126 Vgl. Kapitel 3.1.3 zur Entwicklung der weiblichen Antragszahlen sowie Anhang 2 zur jährlichen Gesamtzahl der Bürgeranträge und ihrer Trennung nach dem Geschlecht. Die Höhe der Bürgeranträge entspricht nicht der Zahl der tatsächlichen Neubürger pro Jahr, denn in den Bürgerprotokollen waren auch diejenigen verzeichnet, die letztlich nicht zum Bürgerrecht zugelassen wurden. Eine Auswertung der über 63.000 männlichen Bürgerprotokolle nach Zulassung und Ablehnung hätte den Rahmen dieser Arbeit jedoch gesprengt. Ausgehend von den weiblichen Bürgeranträgen waren Ablehnungen der Bürgeranträge eher selten (von 401 Anträgen wurden 4 abgelehnt und 1 Protokoll enthielt gar keinen Eintrag). Da die Analyse der männlichen Zahlen als Tendenz der Gesamtentwicklung durchgeführt wird, um Vergleichswerte zu denen der Frauen zu erhalten, erweist sich die Zugrundelegung der Bürgeranträge legitim. Denn es ist das Ziel der Analyse, die Bedeutung des Bürgerrechts für Frauen darzustellen und dafür ist die Intention, Bürgerin zu werden, ausschlaggebender, als die tatsächliche Zulassung. Auch bei den folgenden Berechnungen und Ausführungen zum weiblichen Bürgerrecht wurden, sofern es die Vollständigkeit der Angaben in den Bürgerprotokollen ermöglichte, alle 401 Datensätze berücksichtigt.
127 Vgl. Peter Borowsky, Die Restauration der Verfassungen in Hamburg und in den anderen Hansestädten nach 1813, in: Arno Herzig (Hg.), Das alte Hamburg (1500-1848/49). Vergleiche · Beziehungen, Hamburg 1989 (Hamburger Beiträge zur öffentlichen Wissenschaft Bd. 5), S. 155-175. hier, S. 161f. u. 166.
128 Vgl. Matti, S. 115 u. 119.
129 Vgl. Kapitel 2.1.
130 Vgl. Matti, S. 122. Die Zuwanderung von Handwerkern, die das Bürgerrecht erwarben, weil sie sich dauerhaft in Hamburg niederlassen wollten, löste besondere Besorgnis bei den Ämtern der Stadt aus. So richtete das Tischleramt im Rahmen der Verhandlungen um die Bürgerrechtsverordnung von 1845 eine Bittschrift an den Senat, in der es darauf hinwies, daß seit dem Brand immer mehr junge Leute in die Stadt kämen, das Bürgerrecht erwarben und verarmten. Das Tischleramt sah durch die Zunahme von zunftberechtigten Handwerkern die Überfüllung von Erwerbszweigen auf sich zukommen, die das gesamte handwerkliche System bedrohte. Es forderte rigidere Maßnahmen bei der Zulassung zum Bürgerrecht durch eine Erhöhung des Bürgergelds und die Hinterlegung der Kaution in bar, ohne die Möglichkeit zu haben, sie durch Bürgen lediglich garantieren zu lassen sowie eine verschärfte Prüfung der Verhältnisse der Antragsteller. Vgl. hierzu StAHbg 111-1 Senat Cl. VII Lit. Bc Nr. 7b Fasc 30 Inv. 18.
131 Vgl. Lehr, S. 48.
132 Vgl. Matti, S. 125f.
133 Vgl. Eckardt, S. 26f.
134 Vgl. Wensky, Frauen in der Hansestadt Köln, S. 50.
135 Vgl. Ichikawa, S. 94.
136 Vgl. Laurent, Über das älteste Bürgerbuch, S. 143f.
137 Vgl. Loose, Erwerbstätigkeit, S. 10f.
138 Es handelt sich hierbei um die Witwen Sophie Lewis (Kauffrau), Alida Weigel (Kauffrau), Henrietta Betta Oehrens (Drogerie und Farbe), Anna Catharina Cäcilia Witt (Gewürze und Farben), Catharina Rebecca Francisca Möller (Kauffrau), Magdalena Lippelt (Kauffrau), Margarethe Maria Christina Flügger (Gewürze und Firniß) und Catharina Maria Henriette Bandmann (Tuch Groß- und Einzelhandel). Vgl. Hamburgisches Adressbuch für 1835, S. 167, 300, 207, 310, 195, 109, 76f. u. 12 sowie Anhang 1, Nr. 34-39, 41 u. 43.
139 Witwe Henriette Catharina Claussen aus den großen Bleichen 35. Vgl. Hamburgisches Adressbuch für 1835, S. 335 und Anhang 1 Nr. 40.
140 Vgl. in Anhang 1 die Angaben der Frauen zum ausgeübten Beruf vor Antragstellung und die Graphiken zur Verteilung der Berufe vor und nach dem Erwerb des Bürgerrechts in Kapitel 3.3.1.
141 Vgl. Peter Marschalck, Der Erwerb des bremischen Bürgerrechts und die Zuwanderung nach Bremen um die Mitte des 19. Jahrhunderts, in: BremJb, 66(1988), S. 295-305, hier S. 298.
142 Vgl. ebd., S. 298f.
143 Die territoriale Unterteilung ist entnommen aus: Hans Walter Hedinger, Kurzinventar der historischen Hamburger Grenzsteine mit einem Abriß der Hamburger Territorialgeschichte, Hamburg 1972, S. 57f.
144 Die Differenz der bürgersangehörigen Witwen zu denen, die in Hamburg geboren waren, ergibt sich durch den Zuzug von Frauen nach Hamburg, die einen Hamburger Bürger heirateten und so als Bürgerswitwe Bürgerin wurden.
145 Vgl. Anhang 1.
146 Zwei ledige Bürgerinnen machten keine Angaben zum Alter. Bei den Witwen konnten 163 von 166 in der Altersverteilung ausgewertet werden.
147 Dabei handelte es sich um 26 Witwen, 26 Ledige, 4 Geschiedene und 2 Frauen, die keine Angaben zum Familienstand machten.
148 Es handelt sich hierbei um die Bürgerstochter Johanna Catharina Henrietta Krage, die am 4.10.1837 zum Bürgerrecht zugelassen wurde. Sie lebte von den Mieteinkünften. Vgl. Anhang 1, Nr. 54.
149 Da in Hamburg bis zur Gewerbefreiheit 1865 das Handwerk im Vergleich zu anderen Städten einen sehr festen Stand hatte und die Manufakturen, die im 18. Jahrhundert ihre Hochzeit hatten, im 19. Jahrhundert nicht in die Industrialisierung führten, sondern stagnierten, ist es möglich, die Berufsstruktur nach der Berufssystematik, die Hajo Brandenburg u. a. 1991 anhand der Altonaer Volkszählung von 1803 entwickelt haben, auszurichten. Vgl. Berufe in Altona 1803. Berufssystematik für eine präindustrielle Stadtgesellschaft anhand der Volkszählung, hg. v. Hajo Brandenburg, Rolf Gehrmann, Kersten Krüger, Andreas Künne und Jörn Rüffer, Kiel 1991 (Kleine Schriften des Arbeitskreises für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins Bd. 1). Da es sich bei den hier zur Verfügung stehenden Datensätzen um eine im Vergleich zu einer Volkszählung sehr geringe Menge handelt, konnten jedoch einzelne Untergruppierungen, wie in der Berufssystematik vorgenommen wurden, nicht umgesetzt werden. So wurde die Textil- und Bekleidungsproduktion als eine Berufsobergruppe gewählt, doch konnte sie nicht in die Untergruppen der Vorprodukt-, Zwischenprodukt- und Endproduktherstellung unterteilt werden, ohne die Auswertung zu sehr zu zersplittern. Das gleiche gilt für die Unterteilung von Handel und Herstellung von Nahrungs- und Genußmitteln. Ferner wurden alle Formen des Einzelhandels, die nicht mit Textilien und Bekleidung oder Nahrungs- und Genußmitteln zu tun hatten, in einer Gruppe zusammengefaßt. Generell wurden aber die Obergruppen, wie sie in der Systematik vorgeschlagen wurden, und sofern es entsprechende Berufshäufigkeiten unter den Bürgerinnen in einer der Gruppen gab, übernommen. Eine Ausnahme bilden die Kauffrauen und die Inhaberinnen produzierender Gewerbe. Sie wurden nicht in eine Untergruppe des jeweiligen Gewerbes oder des Handels eingeordnet, sondern unabhängig von den Inhalten ihrer Geschäfte als Großhändlerinnen (Kauffrauen) und als Produktionsstättenbesitzerinnen bzw. -leiterinnen (′Inhaberin/Prod.′) klassifiziert, um ihren besonderen Status zu verdeutlichen. Vgl. zu diesem Komplex ebd., bes. S. 46-51 u. 58-61.
150 Vgl. Gustav Schmoller, Zur Geschichte der deutschen Kleingewerbe im 19. Jahrhundert. Statistische und nationalökonomische Untersuchungen, Halle 1870, S. 641.
151 Es wurden nur Frauen berücksichtigt, deren Großbürgerinnenstatus, der Besitz eines Bankkontos oder die Tatsache, daß sie Warenlager hatten, sie als Großhändlerinnen auswies. Diverse Frauen gaben an, Inhaberin einer Handlung, Handelsfrau oder Kauffrau zu sein. Da jedoch auch Einzelhändlerinnen diese Begrifflichkeiten verwendeten, wurden solche Frauen nur dann berücksichtigt, wenn es gleichzeitig andere der o. g. Hinweise gab. Demzufolge ist nicht völlig auszuschließen, daß sich hinter den unspezifischen Angaben weitere Großhändlerinnen verbergen, doch ist davon auszugehen, daß Großhändlerinnen in den Adreßbüchern unter Angabe der Art des Handels und des Bankkontos eingetragen waren.
152 Vgl. hierzu und zum Folgenden auch Anhang 1.
153 Weiterhin ist hier zu beachten, daß es mit großer Wahrscheinlichkeit unter den Frauen einige gab, die sich zunächst selbständig machten, ohne das Bürgerrecht zu gewinnen. Diesen Personen wurde, wenn sie auffielen, von der Wedde eine Frist gesetzt, binnen der sie das Bürgerrecht erwerben mußten. Vgl. StAHbg 111-1 Senat Cl. VII Lit. Bc Nr. 7b Fasc. 20 Inv. 34, S. 14. Dementsprechend ist es möglich, daß einige Frauen auf die Frage nach dem alten Beruf schon das Gewerbe nannten, mit dem sie selbständig waren. Da dies jedoch nur vermutet werden kann, konnte der Umstand bei der Untersuchung der Umverteilung von Gewerben vor und nach dem Bürgerrecht nicht berücksichtigt werden. Das Ergebnis kann also nur eine Annäherung sein.
154 Vgl. Braun, S. 227. Zur zeitgenössischen Beurteilung der Durchsetzung der "Magazine", also der Geschäfte, die fertige Waren von den Fabriken kauften oder durch eigene Angestellte auf Vorrat fertigen ließen, im 19. Jahrhundert und zum besonderen Erfolg der Textilwarenhandlungen vgl. auch Schmoller, S. 228-236 u. 616ff.
155 Schildt gibt an, daß von den zugezogenen, nach dauerndem Wohnsitz nachsuchenden Frauen in Braunschweig um die Mitte des Jahrhunderts 299 Dienstmädchen werden wollten und 85 sich auf andere Berufe verteilten. Davon wollten 12 als Lehrlinge in der Putz- und Kleiderherstellung arbeiten, 7 als Gehilfinnen in Putz- und Modegeschäften und 33 in der Produktion von Textilien, wovon 7 Unterricht im Handarbeiten erteilen wollten. Vgl. Schildt, S. 82 u. Anm. 232, S.82.
156 Der Lehrerinnen- und Erzieherinnenberuf war für gebildete bürgerliche Frauen vor allem in Elementarschulen, in (meist privaten) höheren Mädchenschulen oder als Privatlehrerin die Form der Finanzierung des Lebensunterhalts, die als standesgemäß angesehen wurde und deshalb in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verstärkt ausgeübt wurde. Verdienen konnten sie dabei jedoch nicht viel, weil sie sehr viel schlechter als Lehrer bezahlt wurden. Vgl. zum Lehrerinnenberuf im 19. Jahrhunderts u. a. Braun, S. 117f. u. 180-184; Elisabeth Meyer-Renschhausen, Weibliche Kultur und soziale Arbeit. Eine Geschichte der Frauenbewegung am Beispiel Bremens 1810-1927, Köln/Wien 1989, S. 30f. u. 58f und Brigitte Kerchner, Beruf und Geschlecht. Frauenberufsverbände in Deutschland 1848-1908, Göttingen 1992 (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, Bd. 97), S. 35ff. u. 74.
157 Vgl. Commentar, Bd. 1, Anm. _, S. 18f.
158 Die Bürgerstochter Johanna Christiana Theresia Jamrach wurde 1846 als Naturalienhändlerin Bürgerin. Wohnhaft war sie Brauerknechtgraben 38. Ihr Vater, der als Bürge auftrat, betrieb einen Ein- und Verkauf von Naturalien im Brauerknechtgraben 38. Die Bürgerstochter Johanna Christina Gebel wurde 1857 als Federfabrikantin in der elterlichen Federfabrik ABC-Str. 15 Bürgerin. Vgl. Hamburgisches Adressbuch für 1848, S. 127 und Hamburgisches Adressuch für 1858, S. 81 und Anhang 1, Nr. 142 u. 306.
159 Vgl. zur Situation von Unternehmerinnen im 19. Jahrhundert Elke Hlawatschek, Die Unternehmerin (1800-1945), in: Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, Beiheft 35: Die Frau in der deutschen Wirtschaft, Wiesbaden/Stuttgart 1985, S. 127-146.
160 Vgl. Rainer Postel, Versammlung eines Ehrbaren Kaufmanns 1517-1992. Kaufmännische Selbstverwaltung in Geschichte und Gegenwart, hg. v. der Versammlung eines Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg, Hamburg 1992, S. 77.
161 Vgl. Schildt, S. 44.
162 Vgl. Gerhard, Verhältnisse und Verhinderungen, S. 35.
163 Vgl. Charlotte Niermann, Die Bedeutung und sozioökonomische Lage Bremer Kleinhändlerinnen zwischen 1890 und 1914, in: Geschäfte. Teil 1: Der Bremer Kleinhandel um 1900, hg. v. Wiltrud Ulrike Drechsel, Heide Gerstenberger und Christian Marzahn, Bremen 1982 (Beiträge zur Sozialgeschichte Bremens, Heft 4), S. 85-109, hier S. 98.
164 Auch bei den Witwen kennzeichnet der untere, karierte Teil des Balkens, wieviele von ihnen schon vorher in diesem Berufsfeld tätig waren, doch sind diese Zahlen mit Vorsicht zu betrachten. Zum einen sind die Angaben der Witwen in den Bürgerprotokollen zum alten Einkommen oft unspezifisch oder lückenhaft, vermutlich, weil die meisten Hausfrauen waren und zum anderen tritt eine Verzerrung durch die Witwen ein, die schon vor Beantragung des Bürgerrechts das Geschäft des verstorbenen Mannes weiterführten, vor dem Tod des Mannes jedoch nicht beruflich tätig waren. Da jedoch besonders bei den Kauffrauen und Händlerinnen über eine Tätigkeit gemeinsam mit dem Ehemann in dem Gewerbe nur spekuliert werden kann, es aber offensichtlich ist, daß Frauen, wenn sie angaben, Kaufmannsfrau oder die Frau eines Speisewirts gewesen zu sein, nicht in einem anderen Gewerbe tätig waren, wurden sie bezüglich des von ihnen vor Erwerb des Bürgerrechts ausgeübten Berufs in die Gruppe eingeordnet, in der sie als Bürgerin selbständig arbeiteten. Auf diese Weise ist gewährleistet, daß nicht der Eindruck entsteht, bei vielen der Kauffrauen etc. wäre die Selbständigkeit gleichzeitig eine Geschäftsgründung gewesen. Es muß aber noch einmal festgehalten werden, daß die Verteilung nach den alten Berufen keine zwingenden Schlüsse auf die Erwerbstätigkeit der Frauen vor der Witwenschaft und dem Erwerb des Bürgerrechts zulassen. Aus diesem Grunde wurde auch der Gegenvergleich über den Anteil von Witwen in den verschiedenen Berufsfeldern vor Erwerb des Bürgerrechts nicht durchgeführt.
165 Vgl. Möller, S. 21.
166 Vgl. Ennen, Frauen in der Stadt, S. 25.
167 Vgl. Hlawatschek, S. 131f.
168 Vgl. Anhang 1, Nr. 183,184 und 199.
169 Außer den drei schon genannten Frauen handelte es sich dabei um die Großbürgerswitwen Babette Lieben (Handelsfrau), Friederica Gutmann (Handelsfrau) und Miene Löwenthal (Handelsfrau), die Bürgerswitwen Caecilie Müller (Handelsfrau) und Therese Mendel (Handelsfrau), die Witwen Therese May (ohne Geschäft), Recha Levy (ohne Geschäft), Minna Phillipp (ohne Geschäft), Betty Mathiason (Handelsfrau) und Jenny Tachau (Kindergarderobengeschäft), aus deren Angaben nicht hervorging, ob der Mann hamburgischer Bürger war, sowie um die ledige Pauline Josephy (Modewarenhändlerin) und Johanna Moos (Putz- und Modewarenhändlerin), die keine Angaben zum Familienstand machte. Vgl. Anhang 1, Nr. 217, 218, 229, 241, 245, 262, 272, 276, 353, 355, 375, 400.
170 Vgl Braun, S. 174f.
171 Vgl. Zusammenstellung der ortsanwesenden Bevölkerung nach Stand und Beruf, in: Statistik des Hamburgischen Staats. Zusammengestellt vom statistischen Bureau der Deputation für directe Steuern, Heft II. Ergebnisse der Volkszählung vom 3. December 1867. Bevölkerungs und Wohnverhältnisse. Statistik der Unterrichtsanstalten von 1869, Hamburg 1869, S. 34-48.
172 Hier konnte nur eine Auswahl der in der Statistik angegebenen Berufe berücksichtigt werden, die bei den Bürgerinnen nachweisbar waren bzw. in Kategorien der Statistik eingeordnet werden konnten. Sie sind in Anhang 3 tabellarisch dargestellt, da an dieser Stelle nur auf die Berufsgruppen verwiesen wird, die unter den Bürgerinnen häufig vorkamen.
173 Die Differenzen, die sich in diesem Vergleich zu den Angaben in den Graphiken der Berufsverteilung der Ledigen und Witwen finden, ergeben sich daraus, daß hier auch die Berufsangaben der Bürgerinnen berücksichtigt wurden, die geschieden waren oder keine Angaben zum Familienstand machten. Außerdem wurden in der Statistik Kleidersellerinnen extra aufgeführt, die in der graphischen Auswertung im Bereich Textilhandel berücksichtigt worden waren.
174 Dies gilt vor allem vor dem schon erwähnten Hintergrund der starken Vermehrung von Modegeschäften, seitdem durch den Einsatz der Nähmaschine die Herstellung von Konfektionsware immer stärkere Verbreitung erfuhr.
175 Es handelte sich hierbei um die Bürgerswitwe Anna Maria Gustava Mackenthun, die am 23.10.1850 zum Bürgerrecht zugelassen wurde, sofern das Tischleramt zustimmte. Vgl. Anhang 1, Nr. 201.
176 Die Schneiderin Cecilie Charlotte Friederike Emilie Schmidt aus Berlin wurde am 18.4.1838 als Putzmacherin Hamburger Bürgerin. Vgl. Anhang 1, Nr. 58.
177 Sophie Auguste Catharina Schmock war 25 Jahre und ledig, als sie 1848 das Bürgerrecht beantragte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie viereinhalb Jahre in Hamburg gelebt und als Schneiderin gearbeitet. Vgl. Anhang 1, Nr. 168.
178 Vgl. Stieve, S. 53f.
179 Zit. nach Arno Herzig, Kontinuität im Wandel der politischen und sozialen Vorstellungen Hamburger Handwerker 1790-1870, in: Ulrich Engelhardt (Hg.), Handwerker in der Industrialisierung. Lage, Kultur und Politik vom späten Mittelalter bis ins frühe 20. Jahrhundert, Stuttgart 1984 (Industrielle Welt, Bd. 37), S. 294-319, hier S. 304.
180 Vgl. Schildt, S. 94.
181 Zit. nach Gerhard, Verhältnisse und Verhinderungen, S. 38.
182 Zit. nach ebd., S. 39.
183 Vgl. F. H. Neddermeyer, Zur Statistik und Topographie der Freien und Hansestadt Hamburg und deren Gebietes, Hamburg 1847, S. 292f.
184 Vgl. ebd., S. 294.
185 Vgl. Gerhard, Verhältnisse und Verhinderungen, S. 40.
186 Vgl. Bürgerrechtsverordnung von 1845, §§ 17 u. 19, S. 145f.
187 Vgl. Hans Ipsen, Der Verlust des hamburgischen Bürger- und Heimatsrechtes durch Versitzung, in: Hanseatische Rechts- und Gerichts-Zeitschrift, Heft 11, 21(1938), Abt. A, Sp. 411-422, hier Sp. 413.
188 Vgl. Bürgerrechtsverordnung von 1833, §§ 14f., S. 493f. und Bürgerrechtsverordnung von 1845, §§ 15f., S. 145f.
189 Die hier angeführten und alle folgenden Angaben über die quantitative Verteilung der Austritte aus dem Nexus und die persönlichen Gründe für den Austritt ergeben sich aus den Akten der Ex nexu civico Entlassenen der Jahre 1834-1865. Vgl. StAHbg 111-1 Senat Cl. VII Lit. Bc Nr. 7c Fasc. 20 - 37 und 37a-n.
190 Vgl. ebd. Fasc. 37p.
191 Vgl. ebd. Fasc. 37c.
192 Ebd. Fasc. 37a.
193 Auszug aus dem Senatsprotkoll der freien Stadt Frankfurt vom 20. März 1834. Ebd. Fasc. 20, Beilage.
194 Vgl. ebd. Fasc. 37c.
195 Vgl. Obrigkeitliche Verordnung, die Stadtgemeinden zu Vegesack und Bremerhaven betreffend. Publicirt am 5. Juli 1850, in: Gesetzblatt der freien Hansestadt Bremen 1850. Mit einem Anhange im Jahre 1850 erlassener Bekanntmachungen verschiedener Behörden, Bremen 1851, S. 75-82, hier S. 76f.
196 Die folgenden Einzelheiten zur Witwe Raynal ergeben sich aus dem Entlassungsverfahren von Juni bis August 1843. Vgl. StAHbg 111-1 Senat Cl. VII Lit. Bc Nr. 7c Fasc 29 Inv. 20 und das Bürgerprotokoll vom 4.1.1854, StAHbg 332-7 Staatsangehörigkeitsaufsicht AIf, Bd. 103, Fol. 28.
197 Vgl. Hamburgisches Adreßbuch für das Jahr 1855, S. 268.
198 In den altonaischen Adreßbüchern zwischen 1845 und 1853 läßt sich Frau Raynal nicht nachweisen, auch nicht unter dem Punkt "Schul-Collegium". Beides bedeutet jedoch nicht, daß sie nicht in Altona tätig war, sondern nur, daß sie keine leitende Stellung als Erzieherin inne hatte.
199 Vgl. StAHbg 332-7 Staatsangehörigkeitsaufsicht AIa Bürgerbücher, Bd. 22(1851-1854), 4. 1. 1854, Nr. 28.
200 Vgl. StAHbg 111-1 Senat Cl. VII Lit. Bc Nr. 7c Fasc. 37l.
201 Vgl. ebd. Fasc. 27.
202 Vgl. ebd.,Schreiben der Vormundschaftsdeputation an den Senat vom 14. August 1840.
203 Vgl. ebd. Fasc. 29 Inv. 14.
204 Vgl. ebd. Fasc. 37l.
205 Vgl. A. Kühne, Giebt es ein Mittel, die Lage der unversorgten Mädchen und Wittwen in den Mittelständen zu verbessern? Eine sozial-pädagogische Frage, Berlin 1859, S. 3 u. 6-9.
206 Vgl. "Dem Reich der Freiheit werb′ ich Bürgerinnen". Die Frauenzeitung von Louise Otto, hg. und kommentiert von Ute Gerhard, Elisabeth Hannover-Drück und Romina Schmitter, Frankfurt a. M. 1980.
207 Louise Otto, "Die Freiheit ist unteilbar", in: Frauen-Zeitung, Nr. 1, 21.4.1848, S. 2. Zit. nach "Dem Reich der Freiheit werb′ ich Bürgerinnen"..., S. 38 u. 41.
208 Vgl. Eckardt, S. 18.
209 Zur Entwicklung des Vereinswesens in Hamburg seit der Aufklärung und dem von ihm ausgelösten Reformdrang vgl. Franklin Kopitzsch, Aufklärung, freie Assoziation und Reform: Das Vereinswesen in Hamburg im 18. und frühen 19. Jahrhundert, in: Herzig (Hg.), Das alte Hamburg.(wie Anm. 128), S. 209-223, bes. S. 216f.
210 Vgl. Herbert Freudenthal, Vereine in Hamburg. Ein Beitrag zur Geschichte und Volkskunde der Geselligkeit, Hamburg 1968 (Volkskundliche Studien, Bd. IV), S. 134.
211 Aus den Vereinsstatuten, zit. nach Freudenthal, S. 135.
212 Vgl. Grolle, S. 19.
213 Zit. nach Marie Kortmann, Emilie Wüstenfeld. Eine Hamburger Bürgerin, Hamburg 1927 (Hamburgische Hausbibliothek, Bd.10.), S. 29.
214 Vgl. Georg Bendix, Geschichte des St. Pauli Bürgervereins von 1843 bis 1903 aus den Protokoll-Auszügen dem Verein zum 60jährigen Stiftungsfeste gewidmet, o. O. u. J., S. 7 u. 24f.
215 Vgl. ebd., S. 16f.
216 Vgl. Freudenthal, S. 139.
217 Vgl. Ursula Baumann, Protestantismus und Frauenemanzipation in Deutschland 1850-1920, Frankfurt a. M./New York 1992 (Geschichte und Geschlechter Bd. 2), S. 39 und Denkwürdigkeiten aus dem Leben von Amalie Sieveking in deren Auftrage von einer Freundin derselben verfaßt. Mit einem Vorwort von Dr. Wichern, Hamburg 1860, S. 307-309.
218 Vgl. Baumann, S. 42 und Rainer Postel, Amalie Sieveking, in: Gestalten der Kirchengeschichte, Bd. 9,1, Stuttgart 1985, S. 233-242, S. 236f.
219 Vgl. Postel, Amalie Sieveking, S. 233.
220 Vgl. Grolle, S. 19.
221 Vgl. ebd., S. 18f und Kortmann, S. 42.
222 Vgl. Kortmann, S. 44.
223 Ebd., S. 44
224 Ebd., S. 45.
225 Vgl. Sylvia Paletschek, Frauen und Dissens. Frauen im Deutschkatholizismus und in den freien Gemeinden 1841-1852, Göttingen 1990 (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft Bd. 89), S. 48-52 u. 195f. und Grolle, S. 12.
226 Vgl. Paletschek, Frauen und Dissens, S. 172ff.
227 Vgl Grolle, S. 12.
228 Paletschek, Frauen und Dissens, S. 178.
229 Vgl. Grolle, S. 26f. u. 31.
230 Vgl. Stundenplan der Hochschule für das Sommerhalbjahr 1850, entnommen aus ebd., S. 29.
231 Vgl. ebd., S. 28.
232 Vgl. Kortmann, S. 28-30. sowie Wüstenfelds im Kapitel 4.1.1 erwähnte Kritik an der Nichtzulassung von Frauen zu politischen Versammlungen.
233 Vgl. Malwida von Meysenbug. Memoiren einer Idealistin und ihr Nachtrag: Lebensabend einer Idealistin, Bd. 1, Berlin o. J. Für ihre Darstellung und Bewertung der Jahre in Hamburg siehe S. 187-238.
234 Die Hamburger Hochschule für das weibliche Geschlecht ist in der Forschung untrennbar mit dem Namen Malwida von Meysenbugs verbunden. So z.B. schon 1927 bei Rudolf Kayser, Malvida von Meysenbugs Hamburger Lehrjahre, in: ZHG, 28(1927), S. 116-128, aber auch in der neueren Forschung u. a. bei Grolle, S. 24-38; Detlef Grumbach, Malwida von Meysenbug und die "Hamburger Hochschule für das weibliche Geschlecht", in: "... und nichts als nur Verzweiflung kann uns retten!" Grabbe-Jahrbuch, 11(1992), S. 149-161 sowie Sabine Hering-Zalfen, Die Hamburger Jahre, in: Malwida von Meysenbug. Ein Portrait, hg. und mit einem Nachwort versehen v. Gunther Tietz, Frankfurt a. M/Berlin/Wien 1983, S. 55-70. Zur Revolution 1848/49 in Hamburg vgl. Dirk Bavendamm, "Keine Freiheit ohne Maß". Hamburg in der Revolution von 1848/49, in: Jörg Berlin (Hg.), Das andere Hamburg. Freiheitliche Bestrebungen in der Hansestadt seit dem Spätmittelalter, Köln 1981 (Kleine Bibliothek, Bd. 237), S. 69-92.
235 Vgl. Twellmann, S. 23f.
236 von Meysenbug, S. 236f. Die deutschkatholische Gemeinde wurde 1853 in Hamburg verboten.
237 Ebd., S. 237.
238 Vgl. zur Entwicklung der Frauenbewegung seit 1865 Twellmann, bes. S. 54-138 u. 202-221.
239 Vgl. Kortmann, S. 101f.
240 Die 1765 gegründete "Hamburgische Gesellschaft zur Beförderung der Manufacturen, Künste und nützlichen Gewerbe" wurde von den Hamburgern kurz "Patriotische Gesellschaft" genannt. Eine ausführliche Darstellung zu den Initiatoren der Gründung und deren Interessen sowie der Zusammensetzung der Mitglieder im 18. Jahrhundert und den Betätigungsfeldern der Gesellschaft in dieser Zeit gibt Franklin Kopitzsch, Grundzüge der Aufklärung in Hamburg und Altona, 2 Teile, Hamburg 1982. (Beiträge zur Geschichte Hamburgs, Bd. 21), Teil 1, S. 329-355; Teil 2, S. 540-550 u. 557-564.
241 Vgl. Herbert Kwiet, Die Einführung der Gewerbefreiheit in Hamburg 1861-1865, phil. Diss., Hamburg 1947 (masch.), S. 23 u. 81 und Borowsky, S. 162-170.
242 Vgl. Kwiet, S. 77.
243 Vgl. StAHbg 111-1 Senat Cl. VII Lit. Bc No. 7b Fasc. 45a.
244 Vgl. Protokolle des Ausschusses vom 20. Juni 1861 und 29. Oktober 1861. StAHbg 121-3I Bürgerschaft I C1118.
245 Gewerbegesetz. Auf Befehl E. H. Senats der freien und Hansestadt Hamburg publicirt den 7. November 1864, in: Sammlung der Verordnungen der freien und Hansestadt Hamburg seit 1814, bearb. v. J. M. Lappenberg, 32(1864), Hamburg 1865, S. 161-179, hier §2, S. 162. Lediglich die Vorbehaltsbestimmungen verschoben sich. Während der ersten Berichterstattung waren diese noch für die §§ 4 und 5 vorgesehen und erst später in die §§ 3 und 4 geschrieben worden.
246 Vgl. StAHbg 111-1 Senat Cl. VII Lit. Bf. Vol. 4 Fasc. 3. Verhandlungen der Bürgerschaft vom 5.3.1862.
247 Vgl zur Revision des bremischen Bürgerrechts die Protokolle der entsprechenden Deputaion. StABrem 2-P.8.A.1 Akt. 73. Zum Bürgerrecht mit Handlungsfreiheit in Bremen vgl. StABrem 2-P.8.A.5a. Die Zunftprivilegien wurden in Bremen schon 1861 aufgehoben. Verordnung, die Aufhebung der bisherigen Gewerbeprivilegien in der Stadt Bremen betreffend. Publicirt am 4. April 1861, in: Gesetzblatt der freien Hansestadt Bremen 1861, Bremen 1862, S. 10ff.
248 Vgl. Gesetz, die Staatsangehörigkeit, das Staatsbürgerrecht und die Schutzgenossenschaft betreffend. Publicirt am 20. November 1866, in: Sammlung der Lübeckischen Verordnungen und Bekanntmachungen, 33(1866), Lübeck 1866, S. 96-102.
249 Vgl. StAHbg 111-1 Senat Cl. VII Lit. Bf. Vol. 4 Fasc. 3. Verhandlungen der Bürgerschaft vom 12.3.1882 TO Punkt 2 und 19.3.1862 TO Punkt 4.
250 Vgl. Kwiet, S. 71f.
251 Vgl. Gesetz, betreffend den Erwerb von Grundeigenthum. Auf Befehl E. H. Senats der freien und Hansestadt Hamburg publicirt den 20. März 1863. StAHgb. 111-1 Senat Cl. VII Lit. Bc No. 7b Fasc. 45b, Beilage.
252 Vgl. Bericht über die 3. Sitzung der Bürgerschaft vom 27.1.1864, in: Beilage der Hamburger Nachrichten, Nr. 26 vom 30.1.1864.
253 Vgl. ebd.
254 Vgl. Motive zum Gesetz betreffend die Staatsangehörigkeit vom 16.11.1863. StAHbg 111-1 Senat Cl. VII Lit. Bc Nr. 7b Fasc. 45b Inv. 32.
255 Vgl. Bericht über die 4te Sitzung der Bürgerschaft, in: Beilage der Hamburger Nachrichten, Nr. 32 vom 6.2.1864
0 StAHbg 111-1 Senat Cl. VII Lit. Bf Vol. 4 Fasc. 5. Verhandlungen der Bürgerschaft vom 3.2.1864 TO Punkt 3. Vgl. auch Bericht über die 4te Sitzung der Bürgerschaft, in: Beilage der Hamburger Nachrichten, Nr. 32 vom 6.2.1864.
1 Vgl. zu den Kommentaren in der Presse u. a. "Der Paragraph 8 des Bürgerrechtsgesetzes", in: Das neue Hamburg, Nr. 41 vom 20.5.1864 und "Hamburger Angelegenheiten. Noch immer § 8", in: Börsen-Halle, Abendausgabe vom 14.9.1864. Zu den Stellungnahmen der Presse zur Gewerbefreiheit vgl. Kwiet, S. 69-73.
2 Aus einer Resolution des Grundeigentümervereins vom 25. Januar 1864, veröffentlicht in: Hamburger Nachrichten, Nr. 23 vom 27.1.1864. In den Hamburger Nachrichten, Nr. 79 vom 2.4.1864 rief der Grundeigentümerverein zu einer Bürgerversammlung zum gleichen Thema am 3.4.1864 im Conventgarten auf.
3 Aus einem Aufruf an die Mitbürger zum Protest gegen Teile der Gesetze durch den St. Pauli Bürgerverein, veröffentlicht in: Hamburger Nachrichten, Nr. 14 vom 16.1.1864.
4 Vgl. den 3. Abschnitt, Art. 29 der Verfassung der freien und Hansestadt Hamburg. Publicirt den 28. September 1860.
5 Konzept eines Gesetzentwurfs über die Staatsangehörigkeit, das Bürgerrecht und das Niederlassungsrecht Fremder. StAHbg 111-1 Senat Cl. VII Lit. Bc Nr. 7b Fasc. 45b Inv. 4, §9.
6 Bürgerrechtsgesetz 1864, §6, S. 154.
7 Vgl. StAHbg 121-3I Bürgerschaft I C1118 Darin der Bericht des von der Bürgerschaft am 20. März 1861 niedergesetzten Ausschusses zur Püfung einiger die Gewerbefreiheit betreffenden Fragen (im folgenden zit. als: Baumeisterbericht), S. 32-36. Eine zusamenfassende Darstellung der Ausführungen Baumeisters als vortragendes Ausschußmitglied in dem Bericht bietet Kwiet, S. 112-117.
8 Motive zum Gesetz betreffend die Staatsangehörigkeit und das Bürgerrecht vom 16.11.1863. StAHbg 111-1 Senat Cl. VII Lit. Bc Nr. 7b Fasc. 45b Inv. 32.
9 Vgl. Ennen, Frau in der Stadtgesellschaft, S. 10.
10 Vgl. Anhang 1, Nr. 401.
11 Vgl. Hamburgisches Adressbuch für 1865, S. 86 u. 89.
12 Vgl. StAHbg 111-1 Senat Cl. VII Lit. Bf Vol. 4 Fasc. 3. Verhandlungen der Bürgerschaft vom 10.9.1862.
13 Vgl. Baumeister, Die Mündigkeit (wie Anm. 57).
14 Ebd., S. 5. Ein gedrucktes Exemplar des Baumeister Antrags befindet sich in: StAHbg 121-3I Bürgerschaft I B1 Band 3 Protokolle [der Bürgerschaft] mit Anlagen 1862; 39. Sitzung der Bürgerschaft vom 10.9.1862.
15 Vgl. zu den Redebeiträgen die Rubrik "Aus der Bürgerschaft", in: Das neue Hamburg, Nr. 15 vom 20.2.1983, Nr. 17 vom 27.2.1863 und Nr. 19 vom 6.3.1863.
16 Zit. nach der Wiedergabe der Stellungnahme Sutors in der Rubrik "Aus der Bürgerschaft", in: Das neue Hamburg, Nr. 19. vom 6.3.1863.
17 Vgl. StAHbg 111-1 Senat Cl. VII Lit. Bf Vol. 4 Fasc. 4. Verhandlungen der Bürgerschaft vom 4.3.1863 TO Punkt 1.
18 Rubrik "Hamburg. Bürgerschaft." in: Staats und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheiischen Correspondenten, Nr. 103 vom 8.5.1863.
19 Rubrik "Aus der Bürgerschaft", in: Das neue Hamburg, Nr. 37 vom 8.5.1863 und "Hamburg. Bürgerschaft." in: Staats und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheiischen Correspondenten, Nr. 103 vom 8.5.1863.
20 Rubrik "Aus der Bürgerschaft", in: Das neue Hamburg, Nr. 37 vom 8.5.1863.
21 Vgl. StAHbg 111-1 Senat Cl. VII Lit. Bf Vol. 4 Fasc. 4. Verhandlungen der Bürgerschaft vom 6.5.1863 TO Punkt 3.
22 Vgl. ebd. Fasc. 4. Verhandlungen der Bürgerschaft vom 4.3.1863 TO Punkt 1.
23 Vgl. ebd. Fasc. 10. Verhandlungen der Bürgerschaft vom 6.1.1869 und vom 19.5.1869 TO Punkt 8.
24 StAHbg 121-3I Bürgerschaft I C1118, Baumeisterbericht, S. 28.
25 Vgl. Gewerbegesetz, §§ 1, 8-13, S. 161 u. 167-169.
26 Vgl. Gesetz, betreffend die Gewerbekammer vom 18.12.1872, in: Gesetzsammlung der freien und Hansestadt Hamburg. Amtliche Ausgabe, 8(1872), S. 119-123.
27 Vgl. Jahresbericht der Hamburgischen Gewerbekammer für 1873/74, Hamburg 1875, S. 96.
28 Vgl. Beate Brodmeier, Die Frau im Handwerk in historischer und moderner Sicht, Münster 1963 (Forschungsberichte aus dem Handwerk, Bd. 9 ), S. 65ff.
29 Vgl. Marie Raschke, Die Ausschließung der Frauen von der Börse, in: Ariadne. Almanach des Archivs der deutschen Frauenbewegung, Heft 19, Mai 1991, S. 16.
30 Ute Gerhard, Unerhört. Die Geschichte der deutschen Frauenbewegung. Unter Mitarbeit von Ulla Wischermann, Reinbek b. Hamburg 1990, S. 223.
31 Vgl. Helmut Stubbe-da Lutz: Emma Ender (1875-1954), in: ders.: Die Stadtmütter Ida Dehmel, Emma Ender, Margarete Treuge, Hamburg 1994. (Hamburgische Lebensbilder in Darstellungen und Selbstzeugnissen Bd. 7.), S. 39-60, hier S. 47.
32 Ebd. , S. 51.
33 Die Ortsgrupppe des Deutsch-Evangelischen Frauenbundes versagte ihre Unterstützung allerdings, ebd., S. 52.
34 Vgl. Ebd., S. 51 und Karen Hagemannn und Jan Kolossa, Gleiche Rechte - Gleiche Pflichten? Der Frauenkampf für »staastsbürgerliche« Gleichberechtigung. Ein Bilder-Lese-Buch zu Frauenalltag und Frauenbewegung in Hamburg, Hamburg 1990, S. 44f.
35 Postel, Versammlung eines Ehrbaren Kaufmanns, S. 77.
Häufig gestellte Fragen zu "Handelsfrauen, Bürgerfrauen und Bürgerwitwen"
Was ist das Thema dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung des Bürgerrechts für Frauen in Hamburg im 19. Jahrhundert bis zu dessen Aufhebung im Jahr 1864. Sie beleuchtet die rechtliche, soziale und ökonomische Situation der Bürgerinnen, die Entwicklung des Bürgerrechts, sowie die Gründe für seine Aufhebung.
Welche Abkürzungen werden in der Arbeit verwendet?
Es gibt eine Liste mit Abkürzungen wie BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), BremJb (Bremisches Jahrbuch), gen. (genannt), geschied. (geschieden), Handl. (Handlung), Hbg (Hamburg), HGBll (Hansische Geschichtsblätter), HZ (Historische Zeitschrift), J. (Jahr), MHG (Mitteilungen des Vereins für Hamburgische Geschichte), Mk (Kurant Mark), Mo. (Monat), RhVBll (Rheinische Vierteljahresblätter), Rth (Reichstaler), Sh (Schilling(e)), StAHbg (Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg), StABrem (Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen), TO (Tagesordnung), v. (von/vom), Wo. (Woche(n)), ZHG (Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte), und ZLGA (Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde).
Welche Hauptkapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Hauptkapitel: Einleitung, Die Entwicklung des Bürgerrechts in Hamburg bis 1845, Sozio-ökonomische Verteilung der Bürgerinnen bei Erwerb und Aufgabe des Bürgerrechts, Die Aufhebung des weiblichen Bürgerrechts 1864, Schlussbetrachtung und Ausblick, Literaturverzeichnis und Anhang.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung erläutert die Bedeutung des rechtlichen Status von Frauen in der Gesellschaft, insbesondere des Bürgerrechts. Sie geht auf die Forschungslage ein, definiert den Bürgerbegriff und umreißt die Fragestellung und den Aufbau der Arbeit.
Wie entwickelte sich das Bürgerrecht in Hamburg bis 1845?
Dieses Kapitel beschreibt die bürgerrechtliche Situation zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die Bürgerrechtsverordnungen von 1833 und 1845, die Definition des großen und kleinen Bürgerrechts sowie des Bürgerrechts für Frauen, und das Verfahren und die Kosten des Erwerbs des Bürgerrechts.
Welche Informationen bietet die Arbeit zur sozioökonomischen Verteilung der Bürgerinnen?
Dieses Kapitel analysiert die Verhältnismäßigkeiten von weiblichen und männlichen Einwohnern und Bürgern in Hamburg, die soziale Struktur der Bürgerinnen (Familienstand, Herkunft, Altersverteilung), die von den Bürgerinnen betriebenen Gewerbe und die Gründe für die Aufgabe des Bürgerrechts.
Was waren die Gründe für die Aufhebung des weiblichen Bürgerrechts 1864?
Dieses Kapitel untersucht die gesellschaftspolitische Präsenz und Akzeptanz des weiblichen Bürgerrechts, die Rolle der Hamburger Bürgervereine und der Hamburger Frauenhochschule, sowie die Diskussionen um die Gewerbefreiheit und das Bürgerrecht im Zusammenhang mit frauenspezifischen Aspekten.
Welche Quellen wurden für die Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf unveröffentlichte Quellen (Staatsarchive Hamburg und Bremen), veröffentlichte Quellen (Gesetze, Verordnungen, Adressbücher) und Zeitungsartikel sowie eine umfangreiche Liste von Sekundärliteratur.
Welche Informationen enthält der Anhang?
Der Anhang enthält Daten der weiblichen Bürgerrechtsanträge aus den Bürgerprotokollen 1811-1864, die Anzahl der gesamten Bürgeranträge getrennt nach Geschlecht, und einen Vergleich zwischen den von Bürgerinnen betriebenen Gewerben und denen der selbständigen Frauen in der Statistik der Volkszählung vom 3. Dezember 1867.
Was ist die Schlussfolgerung der Arbeit?
Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf die weitere Forschung. Die Analyse der Bürgerprotokolle ergab das der Anteil der Frauen unter den Bürgern Hamburgs äußerst gering war und daß schon von daher die Bedeutung des Bürgerrechts für Frauen nicht überschätzt werden darf.
- Quote paper
- Claudia Thorn (Author), 1995, Handelsfrauen, Bürgerfrauen und Bürgerwitwen. Zur Bedeutung des Bürgerrechts für Frauen in Hamburg im 19. Jahrhundert bis zu seiner Aufhebung 1864, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108739