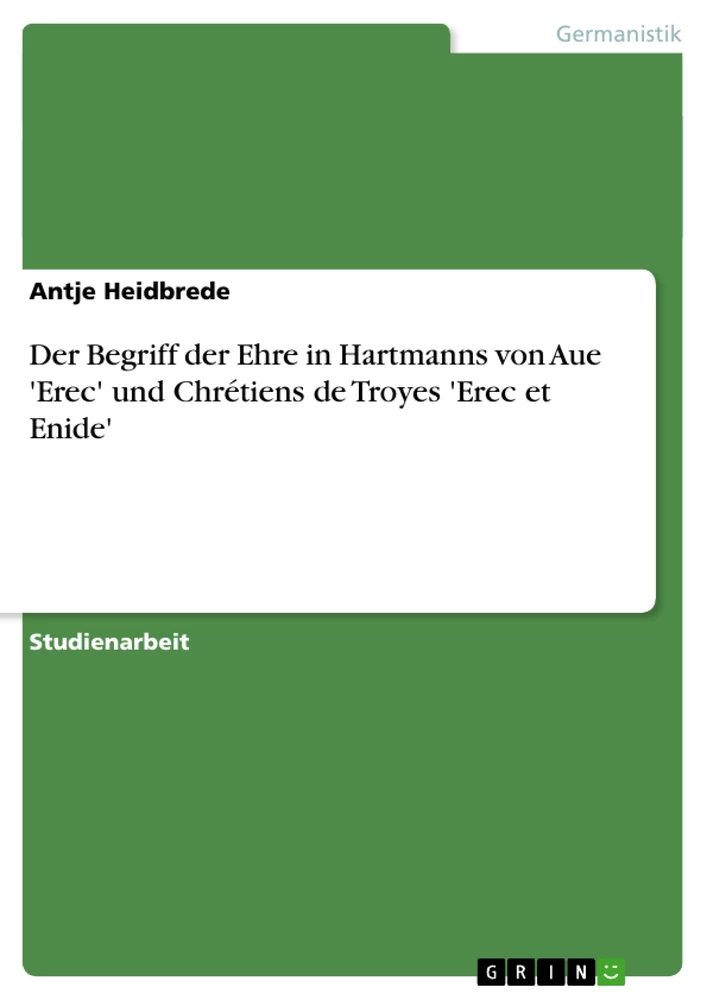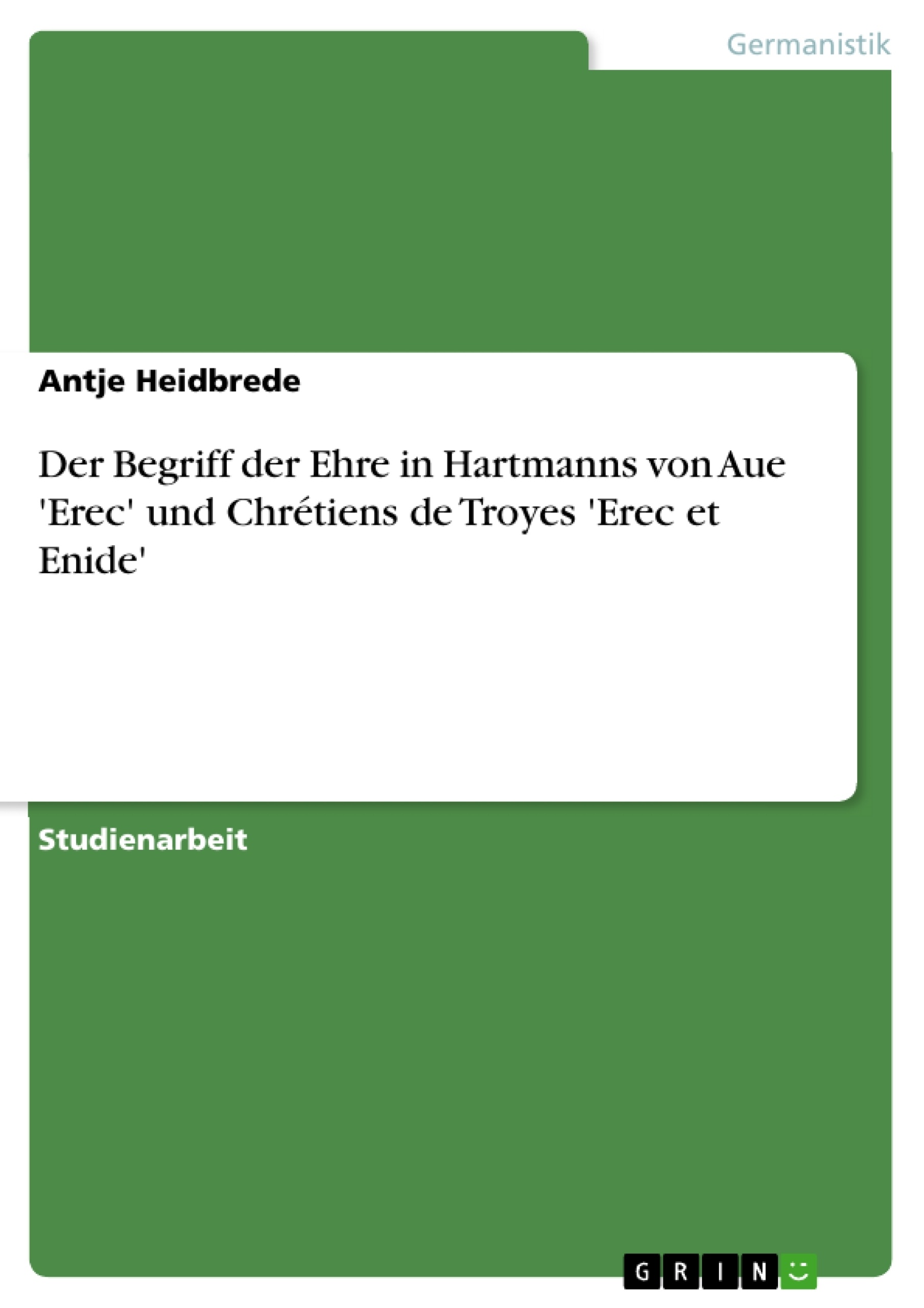In einer Welt, in der Ehre mehr als nur ein Wort war, sondern ein Lebensweg, entführt uns diese fesselnde Erzählung in die schillernde Welt des Mittelalters, wo Rittertum, höfische Liebe und die Suche nach Anerkennung das Leben bestimmten. Der Leser taucht ein in das Leben von Erec, einem strahlenden Ritter, dessen Ruhm durch einen einzigen, unglückseligen Vorfall getrübt wird. Getrieben von dem Wunsch, seine Ehre wiederherzustellen und seinen Wert zu beweisen, begibt sich Erec auf eine gefährliche Reise voller Prüfungen und Herausforderungen, die ihn an seine Grenzen bringen. An seiner Seite steht Enite, eine Frau von unvergleichlicher Schönheit und Tugend, deren Liebe und Loyalität zu Erec auf eine harte Probe gestellt werden. Gemeinsam trotzen sie finsteren Schurken, bestehen gefährliche Abenteuer und navigieren durch die komplexen Regeln der höfischen Gesellschaft. Doch was bedeutet Ehre wirklich in einer Welt, in der Ruhm vergänglich ist und Intrigen an jeder Ecke lauern? Kann Erec seine Ehre tatsächlich wiedererlangen, oder ist er dazu verdammt, für immer im Schatten seiner Vergangenheit zu leben? Begleiten Sie Erec und Enite auf ihrer aufregenden Queste, in der sie nicht nur äussere Gefahren, sondern auch innere Zweifel überwinden müssen, um wahre Ehre und Glück zu finden. Diese Geschichte ist mehr als nur ein Ritterroman; sie ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit den Werten, die uns definieren, und der Frage, wie weit wir bereit sind zu gehen, um das zu schützen, was uns am wichtigsten ist. Tauchen Sie ein in eine Welt voller prunkvoller Turniere, geheimer Verschwörungen und leidenschaftlicher Liebe, die Sie bis zur letzten Seite in Atem halten wird. Entdecken Sie die Bedeutung von "êre", "werdekeit" und "schame" im Kontext einer Gesellschaft, in der Ehre über allem stand, und erleben Sie, wie diese Konzepte das Schicksal von Erec und Enite für immer verändern. Lassen Sie sich von der fesselnden Sprache und den lebendigen Bildern in eine längst vergangene Zeit entführen, in der Tapferkeit, Treue und die unerschütterliche Suche nach Ehre die Eckpfeiler einer ganzen Welt bildeten. Eine unvergessliche Reise erwartet Sie, auf der Sie nicht nur die Abenteuer von Erec und Enite miterleben, sondern auch über die wahre Bedeutung von Ehre und die Konsequenzen ihres Verlusts nachdenken werden. Werden Erec und Enite ihren Platz in der Geschichte als wahre Helden einnehmen, oder werden sie Opfer der gnadenlosen höfischen Welt?
Inhalt
Einleitung
Was ist êre?
Koralus - Ehre durch Abkunft
werdekeit
schame
Enite ehrt Erec
Erec ehrt Enite
Mabonagrin
Der êren krône
Literatur
Mich bedunket des vil verre
Daz mir daz minner werre
Ob ich mit êren sterbe
Dan an êren verderbe.
Einleitung
Ehre
Untersucht man den Begriff der Ehre im mittelalterlichen Text, so stellt man schnell fest, dass unsere heutige Vorstellung von der Bedeutung dieses Wortes mit dem Begriff êre nicht übereinstimmt. Heutzutage spricht man nur noch selten von der „Ehre“ des Menschen. Man gebraucht vielmehr Begriffe wie „Würde“ oder „Ansehen“ einer Person. Das erste meint das Innere, während das andere sich auf das Äußere bezieht. Die „Würde“ besitzt ein Mensch, während ihm „Ansehen“ meist entgegengebracht wird, d.h. man „ehrt“ ihn. Die Würde des Menschen ist im Grundgesetz ausdrücklich geschützt. Jeder Mensch hat sie von vornherein, während er sich Ansehen erst verdienen muss.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.[1]
Wer das Ansehen einer Person schädigt, etwa durch Beleidigung, üble Nachrede oder Verleumdung, kann nach dem Strafrecht ebenfalls bestraft werden.
Es zeigt sich also, dass es offensichtlich verschiedene Formen der Ehre gibt: Eine „innere“ und eine „äußere“.
Damit ist man auch schon an dem schwierigsten Punkt angelangt, wenn man den Begriff der Ehre im mittelalterlichen Text untersuchen will. Welche Begriffe umschreiben die „Ehre“? Was genau ist damit eigentlich gemeint?
Was ist êre?
Um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts entbrannte in der Germanistik eine heftige Diskussion um den von Gustav Ehrismann geprägten Begriff „ritterliches Tugendsystem“.
Ehrismann führt die höfische Ritterethik auf Ciceros „de officiis“ (Über die Pflichten) zurück. Demnach gebe es „drei Werte: das höchste gut, summum bonum, die theoretische art der pflichten, die sich auf den vollendeten und weisen menschen beziehen (...); das sittlichgute, honestum (die tugenden), das praktische pflichtverhalten des gewöhnlichen und einfach rechtschaffenen mannes; endlich das nützliche, utile, die äußeren güter.[2] “
Bumke ist der Meinung, dass es eine solche „Systematik der höfischen Morallehre nie gegeben hat[3] “. Das erkläre sich daraus, dass die höfische Tugendlehre fast nur in poetischer Form vorgelegen habe und vorgetragen worden sei. Schon aus Rücksicht auf das Publikum sei man an einem „System der Begriffe[4] “ gar nicht interessiert gewesen.
Diesen drei genannten „wertgebieten“[5] entspricht nach Ehrismann die Übertragung Walthers von der Vogelweide. In seinem Gedicht „Ich saz ûf eime steine“ fragt sich das lyrische „Ich“, „wie man zer werlte solte leben“. Man bemerkt, dass es sich um ein weltliches Tugendideal handelt. Es soll klären, wie man sich im Diesseits zu verhalten habe. So heißt es auch bei Ehrismann. Die nun folgende Dreiteilung in „êre“, „varnde guot“ und „gotes hulde“ lasse sich auch in weiteren höfischen Dichtungen nachweisen. Ehrismann definiert „gotes hulde“ als eine „hulderweisung, gnade, gratia, eine göttliche, ohne alles menschliche zutun würkende kraft, von der alles gute kommt, also auch êre und guot[6] “.
Es gebe zwei verschiedene Bedeutungen des Begriffs Ehre: Eine subjektive (innere) und eine objektive (äußere). Die erste umschreibe das Ehrgefühl, den ehrenhaften Charakter und ehrenhafte Gesinnung oder auch Willensrichtung und Verhaltensweise, „welche die anerkennung der tüchtigen und guten durch ehrliche und tüchtige leistung zu erringen strebt (ehrliebe), wobei sich also die ehre beide male in ehrenhaftem handeln äußert[7] “. Hier hat man es sozusagen mit einer aktiven Ehre zu tun. Diese kann also beeinflusst werden. Anders verhalte es sich bei der objektiven (äußeren) Ehre. Sie beziehe sich auf das Geehrtwerden, Ansehen, die Achtung, Anerkennung, die jemandem von anderen entgegengebracht wird und begründe sich vor allem auf Dinge wie: Ehrenstellung, hohe Stellung, Auszeichnung, Standes- oder Berufswürde. Nur in wenigen Fällen handelt es sich dabei um etwas Erworbenes. Adel hat also stark mit êre zu tun. Wer adlig ist, dem unterstellt man zumindest einen ehrenhaften Charakter.
Koralus - Ehre durch Abkunft
Dieses Motiv findet sich zum Beispiel bei der Szene mit Koralus, Enites Vater. Als Erec ihn zuerst anblickt, sieht er einen alten Mann. Dieser ist schlecht gekleidet und stützt sich auf einen Stock[8]. Dennoch ist das Haar des Alten gepflegt[9] und seine Kleidung ist so gut wie eben möglich. Zwar ist der Mann offensichtlich arm, dennoch nimmt er Erec freundlich auf. Erec dagegen verhält sich Koralus gegenüber sehr höflich. Mit ausgestreckten Händen geht er auf ihn zu. Peil[10] schlägt vor, dass es sich dabei um einen „Gestus des Wartens“ handeln könnte. Dieser Ansatz bestätigt sich, wenn man diese Stelle einmal mit Chrétien vergleicht.
Dort kommt Erec gar nicht erst dazu, zu warten. Zuerst verfolgt er den fremden Ritter, der von den Stadtbewohnern begrüßt wird. Erec beachtet man nicht, da man ihn nicht kennt. Also reitet er ein wenig weiter. Vor einem Haus sieht Erec einen Edelmann sitzen. Obwohl er sofort erkennt, dass der Mann arm ist, fasst er augenblicklich Vertrauen zu ihm. Der Mann wirkt auf ihn sympathisch, edel und freundlich. Noch ehe Erec ein Wort sagen kann, läuft der Edelmann schon auf ihn zu und sagt: „Biax sire, fet il, bien vaingniez./ Se o moi herbergier daingniez./ Vez l´ostel aparellié ci.“[11] Erst dann steigt Erec vom Pferd ab. Die Angst, wieder hinausgeworfen zu werden[12] bleibt Erec bei Chrétien also ebenso erspart, wie die beschämende Bitte um ein Quartier[13].
Es ist also nicht ehrenvoll, um ein Quartier bitten zu müssen. Dagegen ist es aber ehrenvoll, einen Gast aufzunehmen, wie es Koralus tut. So ein „gruoz bedeutete daher zugleich, die êre des Gegenübers anzuerkennen[14]. Erec legt vorläufig alle seine Ehre in dessen Hände.[15]
Interessant ist auch, dass Koralus Erec immer noch für ehrenhaft hält, obwohl dieser ja durch den Zwerg Schande erfahren hat. Allein Erecs adlige Abstammung garantiert ihm offenbar ein gewisses gewährleistetes Maß an Ehre. Deshalb stimmt Koralus einer Ehe zwischen seiner Tochter Enite und Erec sofort zu. Natürlich geschieht all das unter dem Vorbehalt, dass Erec seine Ehre beim Kampf zurückgewinnt. Enite würde durch Erec an Ehre gewinnen. Umgekehrt verhält es sich ebenso, denn Enite ist erstens wunderschön und vor allem ist sie von adliger Abkunft: „ir geburt was âne schande“[16]. Schließlich ist Herzog Imain Enites Onkel. Dennoch glaubt Koralus zuerst, Erec erlaube sich mit ihm einen Scherz.
Bei Chrétien lässt Enites Vater gar keinen Zweifel daran, dass Enite von hohem Wert ist. Er fragt sogar: „A dons soz ciel ne roi ne conte/ qui eust an ma fille honte,/ qui tant par est bele a mervoille/ qu`an ne puet trover sa paroille?“[17] Er möchte daher noch warten, bis sich ein König oder Graf findet, mit dem er Enite verheiraten kann.
werdekeit
Der Begriff „werdekeit“ ist mit dem Begriff „êre“ benachbart. Es bezieht sich auf die êre, die einem anderen entgegengebracht wird.
Bei Ehrismann heißt es, Enites Vater nehme „Erec nach grôzer herren werdekeit auf: so wie es dem hohen Rang großer Herren angemessen ist (377).“[18] Das stimmt allerdings nicht ganz, denn die dafür notwendigen kostspieligen Gegenstände sind ja „vil tiure[19] “, d.h. gar nicht vorhanden. Es ist jedoch nicht wichtig, denn „in gap der reine wille genuoc/ den man dâ ze hûse vant“[20]. So ehrt Koralus Erec nach seinen Möglichkeiten und tut damit genug.
Bei Chrétien ist die Situation nicht ganz so drastisch. Zwar lebt Koralus durchaus bescheiden, kann sich aber immerhin einen Diener leisten, der ein recht gutes Essen bereitet. Es gibt auch Kissen, die die Hausherrin herbeiträgt.[21]
Nach seinen Möglichkeiten handelt auch König Artus, als er bei Erecs Hochzeit die Gäste „mit vil grôzer werdekeit[22] “ empfängt. Das heißt bei ihm natürlich, dass an nichts gespart wird. Er besteht ja sogar darauf, dass die Hochzeit in seinem Schloss stattfindet, „ze vreuden sînem lande[23] “. Artus zeigt damit seine gesellschaftliche Stellung, die er als König besitzt. Er stellt sich so als großzügig und ruhmreich dar. Wenn man so will, ehrt er sich selbst, oder zeigt zumindest die êre, die er besitzt. Bei Chrétien fragt Erec, ob die Hochzeit an Artus Hof stattfinden dürfe. Der König gewährt ihm dies.[24] Bei Artus stellt sich die Frage nach êre durch heldenhafte Taten gar nicht mehr. Jeder weiß, dass er ruhmreich ist. Außerdem stellt er dies hin und wieder unter Beweis, z.B. als er den weißen Hirsch fängt. Somit ist dieser Unterschied nicht wichtig für Artus Wirken nach außen.
Analog zur êre „besitzt“ die vrouwe immer schon werdekeit, wie sie der Mann durch arbeit[25] “ erst noch erwerben muss. Erec gelingt dies bei seinem großen Turniersieg. Er gewinnt Ehre. Dies geschieht durch zwei Gaben, mit denen Gott ihn ausgestattet hat: „saelde und grôze werdekeit“[26]. Werdekeit ist in diesem Zusammenhang offenbar eine besondere Eigenschaft, die einem zuteil wird, während êre etwas ist, das man wie eine Trophäe mit sich trägt. Das würde auch zu den anderen beiden Beispielen passen. Dann wäre werdekeit auch länger „haltbar“ als êre. Sie bleibt auch unter bestimmten Umständen erhalten, wenn man sein äußeres Ansehen einbüßt. Außerdem ist sie nicht so direkt mit einem bestimmten Ereignis verknüpft wie die êre. Während Erec bei seinem Turniersieg êre direkt gewinnt, ist die werdekeit schon vorher da. Allerdings wäre sie das wohl kaum, wenn Erec kein tugendhafter Ritter wäre.
Was hat „saelde“ damit zu tun? Die nhd. Bedeutung ist „Glück“. Ehrismann sieht in der Wortbedeutung Weltliches und Religiöses miteinander verknüpft.[27] In diesem Fall könnte man wohl von einer religiösen Bedeutung ausgehen, da Gott direkt genannt wird.
schame
Die schame ist ein Teil der êre. Ohne schame könnte ein Ritter nicht tugendhaft sein und auch nicht zu êre gelangen.
Im Lexer[28] findet man die Bedeutungen: Scham, Schamhaftigkeit, Züchtigkeit, Scham-, Ehrgefühl.
Ehrismann sieht die „höfische schame“ im Innern der Person verankert. So sei sie mehr als „das regelhafte Befolgen einer gesellschaftlichen Norm, mehr als ein Teil des höfischen Kontrollsystems[29] “. Dass das so ist, zeigt sich besonders zu Beginn des „Erec“.
Als Erec den Peitschenschlag erhält, schämt er sich sehr. Sofort möchte er Rache nehmen: „ouch wolde er sich gerochen hân[30] “, beherrscht sich aber nach den Vorgaben der mâze, denn er müsste, weil er unbewaffnet ist, mit seinem Leben dafür bezahlen: „der ritter hete im genomen den lîp[31] “. Es ist jedoch nicht so sehr die Striemen von dem Peitschenschlag, die Erec so schmerzen als vielmehr der äußerliche Ehrabfall, den er dadurch erlitten hat, dass die Königin seine Schande mitansehen musste.
Nicht nur beim Gewinn von Ehre ist es von Bedeutung, gesehen zu werden, sondern auch beim Verlust derselben. Beide Male wirkt es verstärkend auf die jeweilige êre bzw. schame. Ehre ist immer etwas Öffentliches. Diese äußere Kränkung erlebt Erec innerlich. Er errötet, als er vor die Königin tritt: „schamvar wart er under ougen[32] “.
Die schame gilt auch für Frauen. So überträgt sich die erlittene schande auch auf die Königin und zwar einmal durch die Hofdame und dann durch Erec. Der Zwerg schlägt die beiden so, „daz siz muoste ane sehen[33] “. Damit verhält sich der Zwerg respektlos der Königin gegenüber und der fremde Ritter ebenfalls, weil er nicht einschreitet.
Chrétiens Erzählung stellt das Ereignis sehr ähnlich dar. Sie weicht allerdings in Einzelheiten ab. Hier schickt die Königin selbst Erec zu dem fremden Ritter, während sich Erec bei Hartmann anbietet, indem er sagt: „ich will rîten dar, /daz ich iu diu maere ervar.“[34] Bei Chretien schimpft die Königin auf den Ritter, dass er es zulässt, dass so eine „bele criature[35] “ geschlagen wird. Deshalb soll Erec ihn nun herbringen. Jong meint, Hartmann habe damit, dass er nur von „maget“ spricht, verallgemeinernd verdeutlichen wollen: „Jemand, der eine Jungfrau schlägt, ist ehrlos, und wer es billigt, gleichfalls“[36]. Ich glaube nicht, dass dieser Unterschied so wichtig ist. Auffallender ist, dass bei Chrétien die Königin nicht sieht, wie Erec geschlagen wird. Er berichtet ihr erst hinterher von dem Vorfall und zeigt seine Verletzungen.
Diese Wendung ist also offenbar typisch für Hartmann. Es gelingt ihm damit, eine Verflechtung der einzelnen Ehrenkränkungen herzustellen und die Geschehnisse in die Öffentlichkeit zu rücken. Bei Chrétien versucht Erec, sich zu rechtfertigen und erklärt, er habe den Ritter nicht angreifen können, weil er selbst unbewaffnet war. Dafür könne man ihn nicht tadeln[37]. Bei Hartmann kennt Erec sich selbst gegenüber keine Gnade, verhält sich der Königin gegenüber aber höflicher als bei Chrétien, indem er darum bittet, reiten zu dürfen, um sich zu rächen. Dennoch lässt er keinen Zweifel daran, wie unbedingt notwendig es ist.
Hartmanns Erec handelt also noch mehr im Zeichen der ® mâze, als Chrétiens.
Durch den Peitschenschlag und das Erleben der schame wird die Romanhandlung erst richtig in Gang gesetzt. Erec sinnt auf Rache, macht sich auf den Weg und stellt in dieser ersten Abenteuerreihe seine êre wieder her.
Auch Enite bekommt schame. Als sie von der Königin zur Tafelrunde geführt wird, errötet sie zuerst und erbleicht dann. Das geschieht „von grôzer schame[38] “, denn Enite ist verlegen, vor so viele Menschen zu treten. Mehrmals gebraucht Hartmann hier das Wort „schame“[39]. Gerade durch diese Verlegenheit wirkt sie „schoener dan ê[40] “, so dass sich alle vergessen und sie anstarren. Auch bei Chrétien errötet Enide, allerdings erbleicht sie nicht. Als sie von allen betrachtet wird, senkt sie den Kopf und wird durch ihr Erröten noch viel schöner.
Die Augen als „Spiegel der Seele“ verraten, was im Innern der handelnden Personen vorgeht. Im Mittelalter verstand man das Innen und Außen noch nicht als so sehr voneinander getrennt, wie man es heute tut. Deshalb steht Enites innere Schönheit auch in enger Verbindung mit der Schönheit ihres Körpers. Diese lobt Erec und sagt, es komme nämlich nicht auf Kleidung an: man sol einem wîbe/ kiesen bî dem lîbe/ ob si ze lobe stât/ unde niht bî der wât.“[41]
Enite ehrt Erec
Erec und Enite verhelfen sich gegenseitig zu êre.
Durch ihre Schönheit ehrt Enite Erec. Enites Schönheit erfüllt verschiedene Funktionen. Zuerst hilft sie Erec, seine Ehre wiederherzustellen, weil er durch sie den Schönheitspreis gewinnt. Dann wird Enite in die höfische Gesellschaft aufgenommen, als sie vom König durch den Kuss zur schönsten Dame ernannt wird.
Manchmal bringen Enites erotische Reize Erec und Enite in Gefahr. Zuerst vergisst er seine ritterlichen Pflichten, dann lockt sie ungewollt Gegner an, die Enite besitzen möchten. Ihre Schönheit verursacht oftmals unhöfisches Verhalten. In der Artusrunde starrt man Enite selbstvergessen an und das Verhalten der Gegner Erecs ist ebenfalls nicht gerade vorbildlich. Erst Guivreiz, der kleine König, will Enite nicht besitzen, sondern betrachtet sie als Beweis dafür, dass Erec ein „degen“ ist, denn „wer gaebe die einem boesen man?“[42]
Wer also eine so schöne Frau an seiner Seite hat, ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein ehrenhafter Ritter. Dennoch muss er dies natürlich unter Beweis stellen.
Besonders ehrt Enite Erec durch ihr Verhalten. Stets überlegt sie genau, wie sie sich zu benehmen hat. Als beide sich auf ihrer âventiure- Fahrt befinden, gerät Enite in einen Konflikt. Erec hatte ihr unter Androhung der Todesstrafe verboten, zu sprechen. Als sie drei Räuber nahen sieht, weiß sie nicht, was sie tun soll. Nun wägt sie ab, wer von ihnen beiden von größerem Wert sei. Dabei stellt sie fest: „wir wegen ungelîche.[43] “ Sie hält Erec für edler und will sich daher opfern, um ihn zu retten. Sein Verlust scheint ihr schlimmer als der eigene Tod. Schweren Herzens warnt sie Erec vor den Räubern.
Später fleht Enite Erec um seiner êre[44] willen an, ihr zu vergeben. Damit stehen Enites triuwe[45] und Erecs êre in Beziehung zueinander. Die triuwe macht Enites êre aus. Diese beweist sie im folgenden noch öfter, indem sie Erec ohne Rücksicht auf eigene Verluste warnt.
Bei Chrétien überlegt Enide nur kurz. Sie möchte auf keinen Fall feige sein und spricht: „Dex! serai je donc si coarde/ que dire ne li oserai?/ Ja si coarde ne serai;/ jel li dirai, nel leirai pas.“[46] Chrétien kommt es offenbar nicht so sehr auf die Darstellung dieses inneren Konflikts Enides an, als vielmehr auf die Beschreibung der folgenden Kampfszenen. Außerdem ist dem Räuber auch gar nicht an Enide gelegen, sondern vielmehr an ihrem Pferd. Bei Hartmann ist Enite die wertvollste potenzielle Beute. Auch hier zeigt sich, dass Hartmanns Enite den eigenen Wert viel geringer einschätzt als Chrétiens Enide.
Über Feigheit denkt Enite nicht nach. Sie steht nicht nur zwischen Erecs und ihrem eigenen Leben, sondern auch zwischen triuwe und zuht. Diese Anstandsregeln, die sie als höfische Dame zweifelsohne gelernt hat, besagen unter anderem, eine Dame solle möglichst nicht sprechen, wenn sie nicht gefragt werde[47]. Nun ist ihr das Sprechen sogar verboten. Enites triuwe vermag aber auch diesen Regelverstoß zu überstrahlen.
Manchmal übertritt Enite das Gebot der mâze. Hartmann tadelt sie aber niemals. Ihre unhöfisch langen Klagereden und ihr Zweifeln an Gott nimmt Hartmann zugunsten ihrer triuwe und ihrer Liebe zu Erec in kauf.
Enites mutiges Sprechen rettet Erec noch einmal. Als er und König Guivreiz einander in der Dunkelheit nicht erkennen, siegt Guivreiz, weil Erec bereits zuvor durch ihn verwundet worden war. Gerade will Guivreiz Erec erschlagen, da springt Enite dazwischen und klärt die Verwechslung auf[48].
Erec ehrt Enite
Enite gewinnt Ehre durch die Heirat und dann immer wieder durch Erecs Tapferkeit und seinen ritterlichen Mut.
Als sich Erec „verliegt“, wird Enites Ehre ebenso gekränkt wie Erecs. Sie hört die Worte: „wê der stunt,/ daz uns mîn vrouwe ie wart kunt!/ des verdirbet unser herre.“[49] Sie glaubt nun, sie sei schuld an der schande, die sie beide trifft. Die Ehrkränkung Erecs fällt auch auf Enite zurück. Allerdings kann man vielleicht eher von einer Beschämung sprechen. Als Dame hat Enite eine „angeborene“ Ehre. Die Ehre, die sie im Leben gewinnen kann, ergibt sich aus ihrem angemessenen Verhalten und ihrer triuwe gegenüber Erec. Ehrismann legt die männliche Ehre auf die Begriffe arbeit und manheit fest, während die weibliche sich auf zuht und schoene begründe. „Da die höfische Dame beides schon immer besaß, so ´besaß` sie auch êre und lebte nach ihren Geboten. (...) Sie konnte êre nicht erkämpfen, nicht mehren, nur wahren und behüten, was zur Passivität verdammt“.[50] Während Enite im folgenden darum bemüht ist, Erecs und die eigene Ehre zu schützen, gewinnt Erec die verlorene êre zurück und gibt sie Enite schließlich auch zurück. Er entlässt sie aus ihrem Redeverbot und ganz am Ende der Erzählung wird Enite für ihre Mühen belohnt. „in dem ellende/ hâte vrouwe Ênîte/ erliten übele zîte:/ daz hât si wol bewendet,/ wan sich daz hie endet,/ und muoz sich verkêren/ ze gemache unde zêren/ und ze wünne manecvalt.“[51]
Mabonagrin
Erec hat schon viele Kämpfe und vor allem Siege hinter sich, dennoch sucht er noch nach einer besonderen aventiure. Er hört vom Joie de la curt. Als man ihm nicht sagen will, worum es sich dabei handele, sagt er, man werde ihn für unredlich halten, wenn er unwissend wieder fortgehe.[52] Schweren Herzens erzählt ihm der Burgherr von dem unbesiegbaren Ritter und warnt ihn: Wenn ihm lîp und êre[53] etwas bedeuten, solle er von dieser âventiure unbedingt Abstand nehmen.
Erec aber lässt sich nicht beirren. Er glaubt sogar, es müsse Gott gewesen sein, der ihm den Weg gewiesen habe. Er ist erfreut, ein Spiel gefunden zu haben, „dâ ich lützel wider vil/ mit einem wurfe wâgen mac.[54] “ Erec wägt seine eigene Ehre gegen die des fremden Gegners ab und kommt zu dem Ergebnis, dass der andere viel mehr Ehre zu verlieren habe als er selbst. Er achtet dabei êre höher als lîp. In einer wahren Anhäufung findet man in diesen Versen das Wort êre. Bei Chrétien gibt es diesen langen Monolog Erecs nicht. Er hört aber, wie die Leute über ihn reden und sich ängstigen, dass ein so schöner Ritter sterben soll. Keiner zweifelt jedoch, dass ein Sieg für Erec große Ehre bedeuten würde. Als Erec darauf besteht, die aventiure auf sich zu nehmen, ist der Burgherr bereit, ihm so gut wie möglich zu helfen.[55]
Es kommt zum Kampf und Erec siegt. Da fragt erstaunlicherweise der Besiegte den Sieger nach dessen Namen[56]. Er will lieber sterben, als von einem Unedlen besiegt zu werden. Der besiegte Mabonagrin will Erec noch nicht einmal den Sieg zugestehen und überrascht ihn damit. Mabonagrin erklärt: „jâ mac mir disiu schande/ von solhem manne geschehen/ dem nimmer siges wirt gejehen/ und daz ich mich ê toeten lân./ hâtz ein unadels man getân,/ sô enwolde ich durch niemen leben“[57] Damit spricht Mabonagrin die zwei großen Bestandteile der êre an: Die Ehre durch Sieg und die Ehre durch Geburt. Beides gehört zusammen. Erec nennt seinen Namen, erfährt danach den Namen Mabonagrins und erbarmt sich. Als Mabonagrin von seinem Schicksal berichtet hat, sagt er, ihm sei heute eine schadelôse schande[58] “ widerfahren. Offenbar geht seine Ehre nicht verloren, weil Erec ein angemessener Gegner ist. Die Erlösung aus der Verzauberung ist mehr wert als das Bewahren der Ehre. Das ließe sich daraus erklären, dass es viel ehrenvoller ist, auf âventiure- Fahrt zu gehen, als in einem Garten zu warten. Erec deutet kurz seine Erfahrungen mit dem „verligen“ an. Er habe es heimlich aus dem Munde einer Frau gehört, dass „hin varn und wider komen“[59] nicht den Zorn der Frauen errege. Man habe die Pflicht, sich hin und wieder von ihnen zu trennen. Dies ist Mabonagrin nun wieder möglich. Der Ehrverlust durch die Niederlage gleicht sich aus mit der Aussicht auf Ehrgewinn durch ein Leben, das einem Ritter angemessen ist.
Bei Chrétien kommt es ebenfalls zu diesem ungewöhnlichen Gespräch. Allerdings handelt es sich dabei mehr um einen Informationsaustausch. Der fremde Ritter muss sich eingestehen, dass er besiegt ist[60]. Sofort erklärt er, eine Niederlage gegen einen Ritter von höherem Rang und Ansehen sei nur ehrenvoll. Er bittet darum, Erecs Namen erfahren zu dürfen, da es ihn trösten würde. Wäre Erec allerdings ein Schlechterer als er selbst, so würde es ihn sehr bekümmern. Erec lässt sich von dem Fremden zuerst versprechen, nach dem Nennen des Namens sofort die Geschichte des Ritter zu erfahren. Dann berichtet er von seiner Herkunft.
Erec spricht den Ritter sofort mit „Amis“[61] an und zeigt sich bereits damit freundlich und versöhnlich. Nachdem der fremde Ritter seine Geschichte erzählt hat, nennt er nun endlich seinen Namen[62]: Maboagrin.
Das Verhältnis zwischen Erec und Maboagrin ist von gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Beide wissen eigentlich, dass sie einander, sowohl in ihrer Herkunft als auch in ihrem Ansehen, gewachsen sind, denn sonst hätte der Kampf wohl kaum so lange gedauert. Sie ehren einander, indem sie dies anerkennen. Außerdem sind beide mit dem Ausgang des Kampfes recht zufrieden. Erec konnte seine Ehre mehren, während Maboagrin endlich erlöst ist.
Der êren krône
Durch den Sieg beim Joie de la curt hat Erec seine êre endlich wiederhergestellt. Dennoch bleibt ihm noch eine Aufgabe, um „Êrec der wunderaere“[63] zu werden. Als er die trauernden Witwen sieht, die ihre Gefährten durch Mabonagrin verloren haben, empfindet er Mitgefühl. Obwohl sich Erec so sehr im Glück befindet, zeigt er „erbaermde“, denn „nû half in Êrec trûric sîn[64] ”. Er selbst und Enite bemühen sich, die Damen nicht allein zu lassen.
Schließlich bietet er ihnen an, mit zum Artushof zu kommen. Als sie diesen erreichen, erklärt Erec, was es mit den Damen auf sich habe. „hie emphie der valsches vrîe/ von al der massenîe/ sîner arbeit ze lône/ alsô der êren krône[65] “. Man lobt Erecs Tapferkeit und seine Freundlichkeit. Artus spricht vor allen, Erec habe des „hoves wünne[66] “ sehr gemehrt und solle fortan immer gepriesen und geehrt werden.
Bumke[67] sieht die erbaermde Erecs als Versöhnung des Helden mit Gott. In „tätigem Mitleid erfüllt sich sein innerer Weg.“ Erec ist nun angekommen. Er hat seine Ehre wiederhergesellt und führt nun ein angemessenes Leben, in dem er sich nicht wieder verligen wird, sondern „nâch êren[68] “ lebt.
Letztlich hat Erec es sogar geschafft, „êre“, „varnde guot“ und „gotes hulde“ in Einklang zu bringen. Er hat seine êre, ist König und Gott belohnt ihn mit dem „êwigen lîbe[69] “. Die êre bleibt „ âne alle missewende[70] “ „unze an sînen tôt[71] “ bestehen. Der Held hat sich also offenbar so weitgehend bewährt, dass er sich um seine êre keine Sorgen mehr zu machen braucht. Die Veränderung an ihm ist nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich an ihm vonstatten gegangen. Auch das zeigt sich besonders an seiner erbaermde.
Bei Chrétien geht es vor allem um Erecs Krönung. Alle sind sehr erfreut und erweisen Erec Ehre. Als Erec erfährt, dass sein Vater gestorben ist, verschenkt er große Mengen seines Besitzes an die Armen und vor allem auch an Gotteshäuser und Kirchen. All dies geschieht zu Ehren Gottes[72]. Anschließend bittet er darum, von Artus an dessen Hof gekrönt zu werden. Im folgenden geht es um die prächtige Ausstattung der Feierlichkeiten. Noch mehr als Hartmann betont Chrétien den guten Ausgang der Erzählung. Die Beschreibungen des Festes finden kaum ein Ende. Während Hartmann genau erklärt, worum es ihm geht, ergibt sich die Aussage der Erzählung bei Chrétien aus sich selbst heraus. Die nun harmonische Beziehung Erecs und Enides steht hierbei (neben der Krönung) im Mittelpunkt. Alles hat ein gutes Ende und auch die Ehre ist nun unangreifbar gerettet und bleibt bestehen.
Literatur
Primärliteratur:
Chrétien de Troyes: Erec et Enide. Altfranzösisch/ Deutsch. Stuttgart: Reclam 2000.
Hartmann von Aue: Erec. Mittelhochdeutscher Text und Übertragung. 23. Auflage. Frankfurt am Main: Fischer Verlag 2000.
Sekundärliteratur:
Bartsch, Karl: Über Christian´s von Troies und Hartmann´s von Aue Erec und Enide. In: Germania VII. 1862.
Bumke, Joachim: Höfische Kultur. Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter. Band 2. 6. Auflage. München: DTV 1992.
Bumke, Joachim: Die romanisch- deutschen Literaturbeziehungen im Mittelalter. Ein Überblick. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag 1967.
Dreyer, Karl: Hartmanns von Aue Erec und seine altfranzösische Quelle. Königsberg: Hartungsche Buchdruckerei 1893.
Drube, Herbert: Hartmann und Chrétien. Diss. Münster 1928.
Ehrismann, Otfrid: Ehre und Mut, Âventiure und Minne. Höfische Wortgeschichten aus dem Mittelalter. München: Verlag C.H.Beck 1995.
de Jong, Jan Catharinus Wilhelm Christinus: Hartmann von Aue als Moralist in seinen Artusepen. Proefschrift. Rijksuniversiteit te Utrecht 1964.
Keen, Maurice: Das Rittertum. Aus dem Englischen von Harald Ehrhardt. Düsseldorf, Zürich: Artemis und Winkler 1999.
Peil, Dietmar: Die Gebärde bei Chrétien, Hartmann und Wolfram. Erec-Iwein-Parzival. In: Medium Aevum- Philologische Studien. Band 28. Hrg. v. Friedrich Ohly u.a. München: Wilhelm Fink Verlag 1975.
Reck, Oskar: Das Verhältnis des Hartmannschen Erec zu seiner französischen Vorlage. Inaugural- Dissertation. Universität Greifswald. 1898.
Ritterliches Tugendsystem. Wege der Forschung. Band LVI. Hrg. v. Günter Eifler. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1970.
[...]
[1] Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 1 (1).
[2] Ehrismann, Gustav: Die Grundlagen des ritterlichen Tugendsystems. In: Ritterliches Tugendsystem. Wege der Forschung. Band LVI. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1970. Hg.v. Günter Eifler, S.3.
[3] Bumke, Joachim: Höfische Kultur. Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter. 6. Auflage. München: DTV 1992. im folgenden zitiert als „Bumke“.
[4] ebda.
[5] summum bonum, honestum, utile.
[6] ebda. S.17.
[7] ebda. S.20.
[8] ein krücke was sîn stiure.
[9] Vil wol gestraelet ez lac/ über sîn ahsel ze tal.
[10] Peil, Dietmar: Die Gebärde bei Chrétien, Hartmann und Wolfram. Erec-Iwein-Parzival. München: Wilhelm Fink Verlag 1975. Hg.v. Friedrich Ohly u.a., S.38.
[11] „Lieber Herr“, sprach er, „seid willkommen! Wenn ihr bei mir Quartier zu nehmen geruht, seht hier mein Haus bereit!“ Chrétien de Troyes: Erec et Enide. Übersetzt und hrg. v. Albert Gier. Stuttgart: Reclam 2000, S.24f..
[12] Hartmann: V. 293f.: wan er vorhte die gewonheit, /er solde in ûz getriben hân,/ als im vor was getân.
[13] ebda. V. 303: „diu bete machete in schamerôt.“
[14] Ehrismann, Otfrid: Ehre und Mut, Âventiure und Minne. Höfische Wortgeschichten aus dem Mittelalter. München: Verlag C.H.Beck 1995. S.84. Im folgenden zitiert als „Ehrismann, O.“
[15] Hartmann: Erec V. 496f. „beide helfe unde heil / stât vil gar âne teil, / herre, in iuwer hant.“; V. 585. „an iu stât gar mîn êre“.
[16] ebda. V. 439.
[17] Chrétien: Erec et Enide. V.533ff. „Gibt es etwa einen König oder Grafen unter dem Himmel, der sich meiner Tochter schämen müsste, da sie so wunderbar schön ist, dass man nicht ihresgleichen finden kann?“.
[18] Ehrismann, O.: S. 239.
[19] Hartmann: Erec V. 381.
[20] Ebda. V. 393f..
[21] Chrétien: Erec et Enide. V.477ff., 488ff..
[22] Hartmann: Erec V. 2068.
[23] ebda. V. 1892.
[24] Chrétien: Erec et Enide. V.1873.
[25] Ehrismann, O.: S.240.
[26] Hartmann: Erec V.2438.
[27] Ehrismann, O.: S.183: (...) und es wäre deshalb unangemessen, dessen Semantik ausschließlich geistlich, gar mystisch, oder ausschließlich weltlich zu fokussieren: die Verschränkung machte seine Faszination aus (...).
[28] Lexer: Mittelhochdeutsches Wörterbuch.
[29] Ehrismann, O.: S.188.
[30] Hartmann, „Erec“: V. 99.
[31] ebda. V. 102.
[32] ebda. V. 112.
[33] ebda. V. 65.
[34] ebda. V. 70f..
[35] Chrétien: Erec et Enide. V. 200. „schönes Geschöpf“.
[36] Jan Catharinus Wilhelm Christinus de Jong: Hartmann von Aue als Moralist in seinen Artusepen. Proefschrift. Rijksuniversiteit te Utrecht 1964.
[37] Chrétien: Erec et Enide. V. 235ff..
[38] Hartmann: Erec. V. 1732.
[39] ebda. V.1711, 1725, 1732.
[40] ebda. V. 1729.
[41] ebda. V. 646ff..
[42] ebda. V. 4335.
[43] ebda. V.3173.
[44] ebda. V. 3264.
[45] ebda. V. 3262.
[46] Chrétien: Erec et Enide. V. 2835 ff.. „Gott, werde ich denn so feige sein, dass ich nicht wage, es ihm zu sagen? So feige will ich nicht sein; ich will es ihm sagen und das nicht unterlassen“.
[47] ein juncvrouwe sol selten iht sprechen, ob mans vrâget niht (...). Thomasin von Zirklaere. In: Bumke: S. 477.
[48] Hartmann: Erec. V.6943ff..
[49] Hartmann: Erec. V. 2996 ff..
[50] Ehrismann, O.: S. 68.
[51] Hartmann: Erec. V. 10107 ff..
[52] Hartmann: Erec. V. 8452ff..
[53] ebda. V. 8473.
[54] ebda. V. 8531 f..
[55] Chrétien: Erec et Enide. V. 5614 f..
[56] Hartmann: Erec. V. 9326.
[57] ebda. V. 9345 ff..
[58] ebda. V. 9584.
[59] ebda. V. 9427.
[60] Chrétien: Erec et Enide. V. 5960 ff..
[61] „Freund“. ebda. V. 5974.
[62] ebda. V. 6082.
[63] Hartmann: Erec. V. 10045.
[64] ebda. V. 9816.
[65] ebda. V. 9888 ff..
[66] ebda. V. 9948.
[67] Bumke, Joachim: Die romanisch- deutschen Literaturbeziehungen im Mittelalter. Ein Überblick. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag 1967. S. 31.
[68] Hartmann: Erec. V. 10124.
[69] ebda. V. 10129.
[70] ebda. V. 10106.
[71] ebda. V. 10104..
Häufig gestellte Fragen zu "Erec"
Was ist êre im Kontext von "Erec"?
Êre, im Kontext von "Erec," bezeichnet mehr als nur Ehre im modernen Sinne. Es umfasst Würde, Ansehen, und sowohl innere (subjektive) als auch äußere (objektive) Aspekte. Subjektiv bezieht es sich auf Ehrgefühl und ehrenhaftes Verhalten, während objektiv Ansehen, Respekt, und Standeswürde umfasst. Adel spielt eine wichtige Rolle, da er mit einem ehrenhaften Charakter verbunden ist.
Welche Rolle spielt Koralus im Bezug auf êre?
Koralus, Enites Vater, demonstriert Ehre durch seine adlige Herkunft und seine Gastfreundschaft, obwohl er arm ist. Erecs adlige Abstammung garantiert ihm ein gewisses Maß an Ehre, weshalb Koralus einer Ehe zwischen Erec und Enite zustimmt, unter dem Vorbehalt, dass Erec seine Ehre im Kampf zurückgewinnt.
Was bedeutet "werdekeit"?
"Werdekeit" ist ein Begriff, der eng mit "êre" verwandt ist und sich auf die Ehre bezieht, die jemandem entgegengebracht wird. Es beschreibt die angemessene Behandlung und den Respekt, den man jemandem aufgrund seines Ranges oder seiner Eigenschaften zollt. Im Fall von Koralus ehrt er Erec nach seinen bescheidenen Möglichkeiten.
Welche Bedeutung hat "schame" (Scham)?
Schame ist ein integraler Bestandteil der êre. Ohne schame kann ein Ritter nicht tugendhaft sein und keine Ehre erlangen. Sie ist im Inneren der Person verankert und mehr als nur die Befolgung gesellschaftlicher Normen. Das Erleben von schame motiviert Erec, seine Ehre wiederherzustellen.
Wie beeinflussen sich Erec und Enite gegenseitig in Bezug auf ihre Ehre?
Erec und Enite helfen sich gegenseitig, Ehre zu erlangen. Enites Schönheit ehrt Erec, während Erecs Tapferkeit und ritterlicher Mut Enite Ehre verschaffen. Enites Verhalten, insbesondere ihre Triuwe (Treue), ehrt Erec zusätzlich. Umgekehrt wird Enites Ehre gekränkt, wenn Erec sich "verliegt" (seine ritterlichen Pflichten vernachlässigt), aber sie gewinnt sie zurück, als Erec seine Ehre wiederherstellt.
Welche Bedeutung hat die Episode mit Mabonagrin?
Die Episode mit Mabonagrin ist entscheidend für Erecs Wiederherstellung seiner êre. Durch seinen Sieg über Mabonagrin beweist Erec seine Tapferkeit und seinen ritterlichen Mut. Mabonagrin selbst betont die Bedeutung von Ehre durch Geburt und Sieg und erkennt Erec als würdigen Gegner an.
Was ist die "êren krône" (Krone der Ehre)?
Die êren krône symbolisiert Erecs vollständige Wiederherstellung seiner Ehre. Sie wird ihm am Artushof verliehen, nachdem er die trauernden Witwen der von Mabonagrin getöteten Ritter tröstet und an den Hof bringt. Es ist der Lohn für seine Arbeit und ein Beweis für seine Tapferkeit und Freundlichkeit.
Wie endet die Geschichte von Erec im Bezug auf Ehre?
Am Ende von "Erec" hat Erec seine Ehre wiederhergestellt und führt ein angemessenes Leben. Er hat êre, ist König, und wird von Gott mit dem "êwigen lîbe" (ewigen Leben) belohnt. Seine Ehre bleibt bis zu seinem Tod bestehen.
- Quote paper
- Antje Heidbrede (Author), 2004, Der Begriff der Ehre in Hartmanns von Aue 'Erec' und Chrétiens de Troyes 'Erec et Enide', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108741