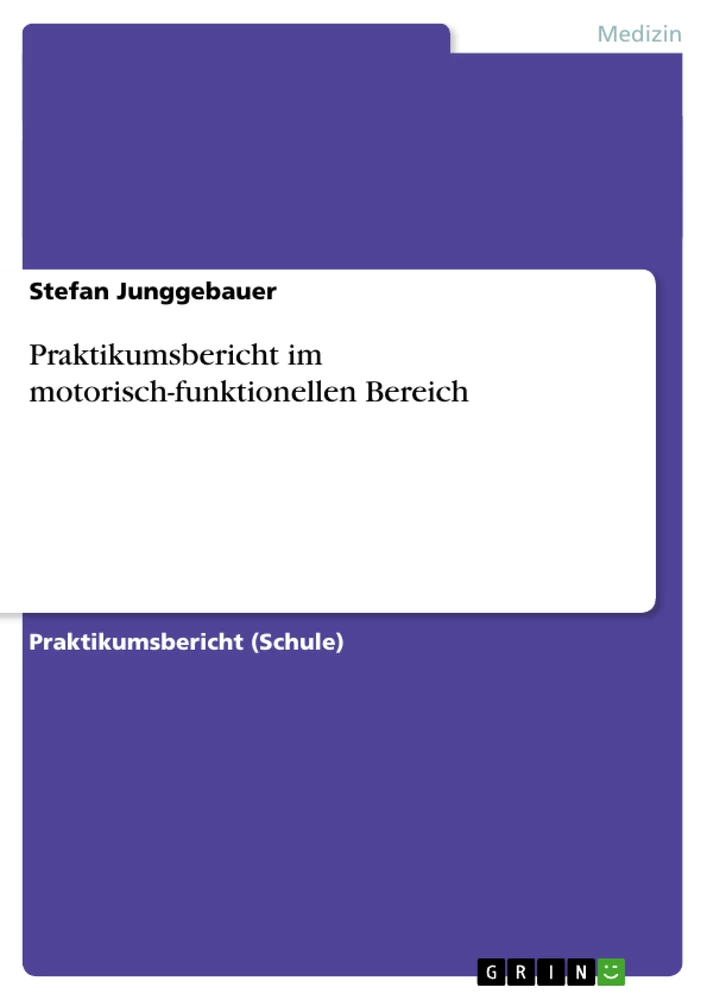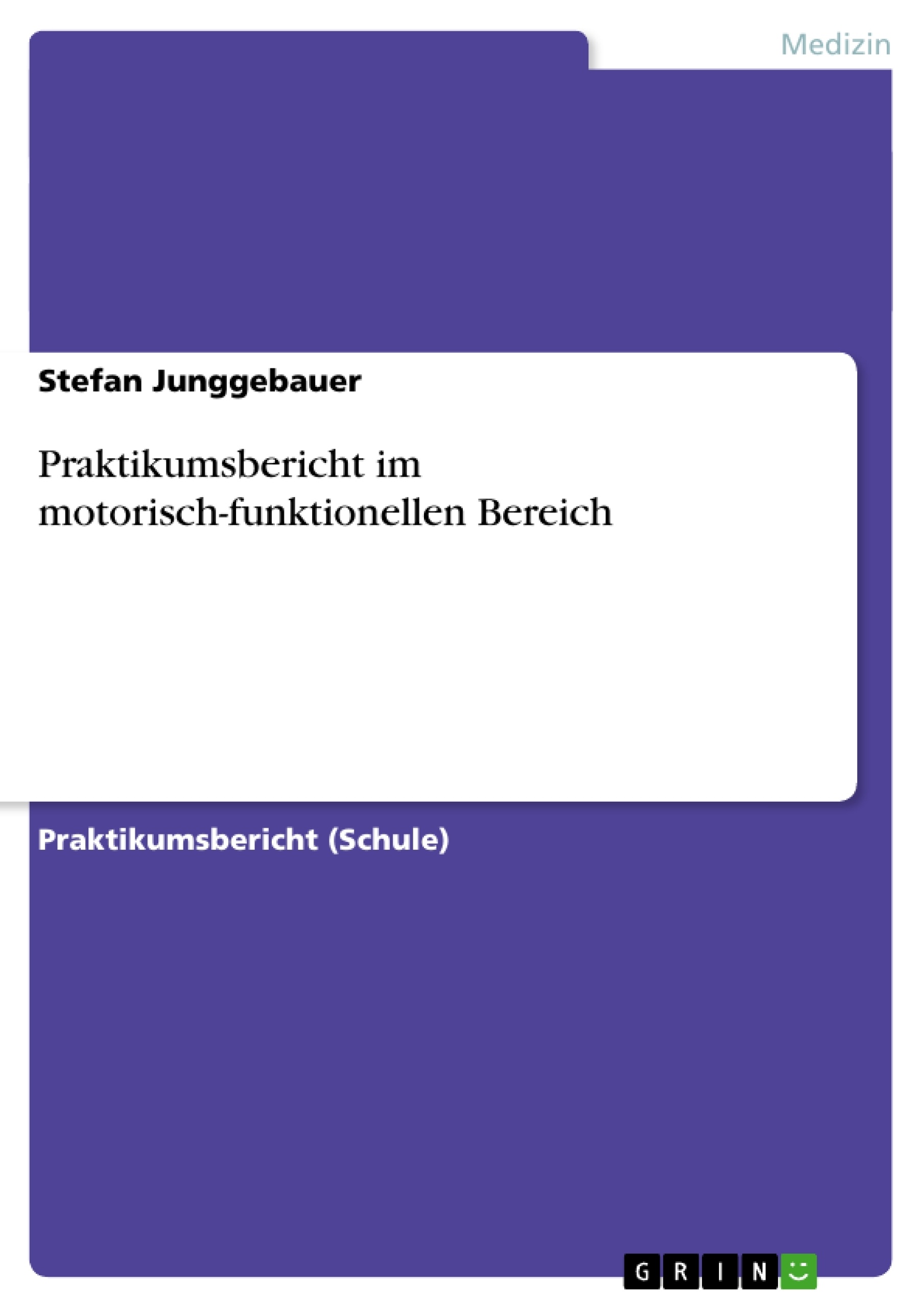Was, wenn ein Moment alles verändert? Stellen Sie sich vor, ein Leben voller Möglichkeiten wird durch einen tragischen Vorfall auf einen Schlag reduziert. In diesem ergreifenden Fallbericht erleben wir die erschütternde Realität eines Patienten, der nach einer schweren Alkohol- und Kokainintoxikation mit anschließendem hypoxischen Hirnschaden im apallischen Syndrom gefangen ist. Diese tiefgreifende Analyse beleuchtet den komplexen Prozess der ergotherapeutischen Befundaufnahme und Behandlungsplanung für Menschen mit schwersten neurologischen Beeinträchtigungen. Von der detaillierten Anamnese über die präzise Diagnose bis hin zur sorgfältigen Erstellung individueller Therapieziele und Behandlungspläne wird jeder Schritt transparent und nachvollziehbar dargestellt. Erfahren Sie, wie Therapeuten mit innovativen Ansätzen und unermüdlichem Engagement versuchen, dem Patienten ein Stück Lebensqualität zurückzugeben, seine Körperwahrnehmung zu fördern, Kontrakturen vorzubeugen und seine Vigilanz zu steigern. Begleiten Sie uns auf einer emotionalen Reise, die die Grenzen der Rehabilitation auslotet und die Bedeutung von interdisziplinärer Zusammenarbeit, Empathie und Hoffnung in der Behandlung von Menschen mit komplexen neurologischen Erkrankungen eindrücklich verdeutlicht. Dieser Bericht ist nicht nur eine wertvolle Ressource für Ergotherapeuten, sondern auch für alle, die sich für die menschliche Resilienz und die Möglichkeiten der Neurorehabilitation interessieren. Tauchen Sie ein in die Welt der neurologischen Rehabilitation, lernen Sie die Herausforderungen und Erfolge kennen und gewinnen Sie neue Perspektiven auf das menschliche Potenzial zur Genesung. Entdecken Sie die Macht der Ergotherapie bei der Verbesserung der Lebensqualität von Patienten mit schwersten Hirnschädigungen und lassen Sie sich von der Hingabe und dem Fachwissen der Therapeuten inspirieren, die sich jeden Tag für ihre Patienten einsetzen. Einblicke in die spezifischen Behandlungsansätze, wie Mobilisation im Bett und an der Bettkante, Transfertechniken und die Anpassung von Hilfsmitteln, bieten praktische Orientierung für die therapeutische Arbeit. Erfahren Sie mehr über die Bedeutung von sensorischer Integration, Tiefensensibilität und die Förderung von Gleichgewichtsreaktionen in der Neurorehabilitation.
Inhaltsverzeichnis
1. Anamnese
1.1 Persönliche Daten von der Patientin / des Patienten
1.2 Medizinische Daten
2. Diagnose
3. Ärztliche Verordnung zur ergotherapeutischen Behandlung
4. Begleitende therapeutische Maßnahmen
4.1 Weitere Therapien
4.2 Medikation
4.3 Hilfsmittel
5. Ergotherapeutische Befundaufnahme
5.1. Sichtbefund
5.1.1 Erstgespräch / Erstkontakt
5.1.2 Äußeres Erscheinungsbild
5.1.3 Dynamik / Statik
5.2. Motorisch – funktioneller Befund
5.2.1 Funktionsanalyse
5.2.2 Tonusverhältnisse
5.3 Gleichgewicht
5.4 Sensibilität
5.4.1 Oberflächensensibilität
5.4.2 Tiefensensibilität
5.5 Wahrnehmungsleistung / Orientierungsfunktionen
5.6 Selbsthilfebefund
5.7 Geistig – funktioneller Befund / Hirnleistungen
5.8 Psychische Situation
5.9 Soziale Situation / soziale Aspekte
5.10 Schmerzbefund
5.11 Zusammenfassung des Befundes mit Priorität der Hauptsymptomatik
6. Therapieziele für die Gesamtbehandlung
7. Ergotherapeutischer Behandlungsplan einer Therapieeinheit
7.1 Arbeitsplatz
7.2 Beschreibung der einzelnen Sequenzen mit:
7.2.1 Zeit
7.2.2 Zielsetzung
7.2.3 Behandlungsmittel
7.2.4 Behandlungsmaßnahmen unter Berücksichtigung des Therapeutenverhaltens
8. Vorschläge zur weiteren ergotherapeutischen Behandlung unter Berücksichtigung von Steigerungsmöglichkeiten
9. Ergotherapeutische Behandlungsdokumentation
10. Literaturnachweis
11. Anlagen
1. Anamnese
Aus datenschutzrechtlichen Gründen sind die persönlichen Daten des Patienten verschlüsselt. Die Angaben entstammen aus der Patientenakte.
1.1 Persönliche Daten von der Patientin / des Patienten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.2 Medizinische Daten
Krankheitsverlauf: Im August 2001 wurde Herr D. im Garten liegend schwer erweckbar und deutlich alkoholisiert ( 1,4 Liter Wodka ) aufgefunden. Er wurde in ein Krankenhaus in Niedersachsen transportiert und war dort bei der Aufnahme wach und ansprechbar. Er wurde zunächst vor dem Stationszimmer beobachtet und nach Stabilisierung seines Allgemeinzustandes in ein Aufnahmezimmer verlegt. Hier wurde er am nächsten Morgen beim Durchgang einer Schwester leblos in Erbrochenem liegend aufgefunden. Er wurde sofort reanimiert, intubiert und beatmet auf die Intensivstation übernommen. Letztendlich bleibt unklar, ob primär Erbrechen mit Aspiration oder aber eine Rhythmusstörung im Rahmen eines dann festgestellten Kokainabusus mit sekundärem Erbrechen ursächlich für die Asystolie gewesen sei. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine ausgeprägte Aspirationspneumonie, die eine Langzeitbeatmung erforderlich machte. Drei Tage nach der Aufnahme wurde daraufhin eine Tracheotomie durchgeführt. Danach konnte der Patient (Pat.) durchgehend spontan über das Tracheostoma atmen. Nach Beedigung der sedierenden Maßnahmen kam es neurologischerseits zum einen zu generalisierten Krampfanfällen mit Zungenbiss, auf Grund derer eine Therapie mit Rivotril begonnen wurde, zum anderen öffnete der Pat. spontan die Augen ohne zu fixieren. Im weiteren Verlauf waren Abwehrreaktionen auf Schmerzreize sowie eine Akzelleration von Atmung und Puls zu beobachten. Durchgeführte CCT – Kontrollen lokalisierten ein generalisiertes Hirnödem. Die letzte Kontrolle 25 Tage nach der Aufnahme zeigte auffällig weite basale Zisternen und eine Erweiterung des Ventrikelsystems. Desweiteren wurde der Verdacht auf eine beidseitige Schädigung des Stammganglienbereichs sowie eine mögliche beidseitige Ischämie frontal beschrieben. Nach insgesamter Stabilisierung des Allgemeinzustands wurde der Pat. drei Wochen nach der Aufnahme auf eine periphere Station zurückverlegt. Hier wurde ein fieberhafter Harnwegsinfarkt antibiotisch sowie eine Soormyokose im Bereich des Genitals und des Mundes behandelt. Anfang Oktober wurde der Pat. in eine andere Einrichtung zur Durchführung einer frührehabilitierenden, stationären Maßnahme übernommen.
2. Diagnose
- Hypoxischer Hirnschaden mit protrahiertem Hirnödem und rezidivierenden cerebralen Krampfanfällen bei Zustand nach Reanimation bei Asystolie nach Alkohol- und Kokainintoxikation
- Apallisches Syndrom
- Symptomatische Epilepsie
3. Ärztliche Verordnung zur ergotherapeutischen Behandlung
24 mal Ergotherapie, 2 mal wöchentlich Spezifizierung der Therapieziele:
- Verbesserung der Körperwahrnehmung, Körperschema, Sensorik
4. Begleitende therapeutische Maßnahmen
4.1 Weitere Therapien
2 mal wöchentlich Physiotherapie
4.2 Medikation
Rivotril Tropfen
Dosierung: 0 – 0 – 5
Anwendung: Antiepileptikum ( Benzodiazepin – Derivat )
Indikation: Klinische Formen der Epilepsie der Säuglinge und Kinder, insbesondere Petit – mal - Epilepsien, generalisierte tonisch - klonische Krisen, Erwachsenenepilepsien Nebenwirkungen: Zunahme der Anfallhäufigkeit in Langzeitbehandlung bestimmter Epilepsieformen ist möglich. Thrombozytopenie, Brustschmerzen
Akatinol Tropfen
Dosierung: 20 – 20 – 20
Anwendung: Psychopharmakon
Indikation: Leichte bis mittelschwere Hirnleistungsstörungen mit folgender Leitsyptomatik: Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Interessen- und Antriebsverlust, vorzeitige Ermüdbarkeit, eingeschränkte Selbstversorgung. Störung der Motorik bei alltäglichen Handlungen und depressiver Stimmungslage ( dementielles Syndrom ) sowie bei Erkrankungen, bei denen eine Steigerung der Aufmerksamkeit und Wachheit ( Vigilanz ) erforderlich ist, wie z.B. bei zentral bedingten Hirnschädigungen, Schädel-Hirn-Traumen, Multipler Sklerose, cerebraler Ischämie und parkinsonähnlichen Erkrankungen.
Nebenwirkungen: Dosisabhängig Schwindel, innere und motorische Unruhe und Überregung. Müdigkeit, Kopfdruck und Übelkeit. In einzelnen Fällen wurde bei Patienten mit erhöhter Anfallsbereitschaft eine Absenkung der Krampfschwellung beobachtet.
Orfiril
Dosierung: 10 – 10 – 10 ( ml )
Anwendung: Antiepileptikum
Indikation: Generalisierte Anfälle in Form von Absencen, myoklonische und tonisch – klonische Anfälle, fokale und sekundär – generalisierte Anfälle
Nebenwirkungen: Polyzystische Ovarien
Paspertin Tropfen
Dosierung: 20 – 20 – 20
Anwendung: Motilitätsstörungen des oberen Magen – Darm – Traktes ( z.B. bei Reizmagen, Sodbrennen, Refluxösophagitis, funktionell bedingte Pylorusstenose ).
Übelkeit, Brechreiz, Erbrechen ( bei Migräne, Leber- und Nierenerkrankungen, Schädel- und Hirnverletzungen, Arzneimittelunverträglichkeit ).
Diabetische Gastroparese
Nebenwirkungen: Vereinzelt Depressionen, Neuroleptisches malignes Syndrom ( Fieber, Muskelstarre, Bewusstseins- und Blutdruckveränderungen )
4.3 Hilfsmittel
- Ein individuell – physiologisch adaptierbarer Rollstuhl
- Ein Schaumstoffaufsatz für den Rollstuhl ( Rollstuhlaufsatz )
- Ein Baumwolltuch ( siehe 5.1.3 Statik / Sitzen im Rollstuhl )
- Eine Nahrungssonde ( PEG )
- Eine elektrische Pumpe für die Nahrungssonde
- Eine Trachealkanüle
- Ein Gerät zum Absaugen von Bronchialsekret
- Ein Harnkatheter
- Ein mit verkabelter Fernbedienung individuell verstellbares Bett
5. Ergotherapeutische Befundaufnahme
Aufgrund des apallischen Syndroms kann Herr D. fast keine aktive, willkürliche Aktivität ausführen. Dementsprechend ist die Befundung nur begrenzt durchzuführen. Sie erstreckt sich über mehrere Tage, da die Tagesform des Pat. recht schwankend ist.
5.1. Sichtbefund
5.1.1 Erstgespräch / Erstkontakt
Herr D. schlief als ich zum ersten Mal sein Zimmer betrat. Seine Augenlider zuckten sporadisch. Als ich mich auf das zweite, leere Bett setzte hob Herr D. kurz den Kopf, darauf beugte er sich ruckartig im Rumpf, so dass der Oberkörper kurzzeitig wenige Zentimeter vom Bett abhob. Als ich später mit der Anleiterin das Zimmer betrat hatte Herr D. die Augen geöffnet, sie rollten jedoch ständig von einer Seite zur Anderen. Er reagierte weder auf die Begrüßung, noch auf die Berührung der Therapeutin. Der Pat. zeigte nicht mehr das Maß an Eigenaktivität verglichen mit dem oben beschriebenen Schlafzustand wenige Stunden zuvor. Die Therapeutin stellte mich dem Pat. vor. Im weiteren Verlauf fixierte der Pat. kurzzeitig seine Augen deutlich gezielter. Bei der folgenden Therapieeinheit war ich mit verschiedenen, unterstützenden Tätigkeiten beteiligt. Aufgrund der apallischen Symptomatik des Pat. war es weder möglich die Ziele des Patienten zu erfragen, Therapieangebote vorzustellen, noch eine Terminabsprache durchzuführen.
5.1.2 Äußeres Erscheinungsbild
Herr D. hat kurze, gewellte, tief – schwarze Haare. Er hat ein rundes Gesicht und braune Augen. Die Nase ist flach und breit. Die Haut des Pat. ist hellbraun und fast am ganzen Körper stark, ebenfalls schwarz, behaart. Der Ernährungszustand des Pat. ist normal und er liegt mit einem T-Shirt und einer Schutzhose unter der Bettdecke bekleidet in seinem Bett. Aus den Bettgittern ragen seitlich ein dünner Schlauch zur Ernährung ( PEG ) und ein etwas Dickerer zum Harnkatheterbeutel. Im unteren Halsbereich ist beim Pat. eine Trachealkanüle angebracht.
5.1.3 Dynamik / Statik
Dynamik:
Das Gehen, sich - hinsetzen, sich - hinlegen, aufstehen aus dem Liegen und aus dem Sitzen lässt sich beim Pat. aufgrund der fehlenden zielgerichteten Eigenaktivität nicht befunden.
Statik:
Liegen: Der Pat. wurde auf den Rücken gelagert, da er aktiv dazu nicht fähig ist.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Es bestehen bei Herrn D. beidseitig Kontrakturen der die Kniegelenke betreffenden Beugemuskulatur, welche auf der rechten Seite deutlich stärker ausgeprägt ist. Auch in den Händen und Fingern sind, vor allem rechts, Bewegungseinschränkungen in Richtung ( Palmar- ) Flexion und Ulnarduktion zu beobachten.
Sitzen ( im Rollstuhl )
Kopf: - leicht nach rechts lateroflektiert;
Anmerkung: Der Kopf wurde mit einem um die Stirn gelegtem und an der Kopfstütze des Rollstuhls befestigtem Tuch in Aufrichtung gehalten, da dieser sonst nach vorne kippen würde.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Stehen Es ergab sich bis zur Fertigstellung dieses Berichtes keine Möglichkeit den Pat. während einer Behandlungseinheit an einem Stehbrett oder ähnlichem zu beobachten.
5.2. Motorisch – funktioneller Befund
5.2.1 Funktionsanalyse
Ist eine aktive Bewegung nicht als Solche benannt, dann wurde diese passiv durchgeführt. Die Bewegungsausmaße sind als endgradig zu betrachten, wenn keine Angaben dazu gemacht wurden. Der Pat. war bei der Befundung in der Rückenlage, sofern die zu befundenen Bewegungen dies zuließen. Zur Ermittlung des Bewegungsausmaßes von z.B. Retroversionen und Abduktionen der proximalen Gelenke wurde der Pat. in Seitenlage gebracht.
Kopf / HWS
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Schultergelenke
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ellenbogengelenke
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Handgelenke
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
MCPs
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
PIPs
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
DIPs
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
CMCPs
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Hüftgelenke
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Kniegelenke
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Sprunggelenke
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zehengelenke
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5.2.2 Tonusverhältnisse
Der Tonus ist grundsätzlich eher schlaff. Die rechte Körperhälfte ist gegenüber der Linken etwas hypertoner. In den oberen Extremitäten ist der Tonus nach distal zunehmend.
5.3 Gleichgewicht
Es ist dem Pat. nicht möglich Schutzreflexe wie einen Ausfallschritt oder eine Stützfunktion der Hand auszuführen. So ist auch das Sitzen an der Bettkante nicht möglich, ohne dass jemand den Rumpf von Herrn D. festhält. Verändert man die Stellung des Rumpfes, reagiert der Pat. mit vermehrten Augenbewegungen ( Nystagmus ), es sind jedoch keine Tonusveränderungen zu beobachten.
5.4 Sensibilität
5.4.1 Oberflächensensibilität
Herr D. zeigte auf verschiedene taktile Reize, sowie auf die Berührung mit nassen Lappen ( warm und kalt ) keine Reaktion.
5.4.2 Tiefensensibilität
Der Pat. reagiert auf feste Berührung, während und nach Gelenksmobilisation und nach der Mobilisation in den Rollstuhl mit Entspannung. Er wirkt etwas wacher und zugewandter. Er hat aufgrund der fehlenden Eigenaktivität fast keine Möglichkeit sich selbst tiefensensible Informationen zuzufügen.
5.5 Wahrnehmungsleistung / Orientierungsfunktionen
Die räumliche, zeitliche, örtliche Orientierung, sowie die zur eigenen Person ist bei dem Pat. wegen seiner Symptomatik nicht zu beurteilen.
5.6 Selbsthilfebefund
Herr D. kann sich weder selbst waschen, an-/ ausziehen, Essen zubereiten bzw. zu sich nehmen, noch kann er bei irgendeiner dieser Tätigkeiten unterstützend mitwirken. Der Pat. wird vom Pflegepersonal gewaschen und be- und entkleidet. Die Nahrung und Medikamente werden ihm über eine Nahrungssonde verabreicht. Das Urin wird über den Harnkatheter abgeleitet.
5.7 Geistig – funktioneller Befund / Hirnleistungen
Es ist bei Herrn D. nicht möglich geistig – funktionelle Leistungen wie Gedächtnis, Geduld und Merkfähigkeit zu befunden. Jedoch zeigt der Pat. im Rollstuhl und bei weiteren mobilisierenden Maßnahmen eine deutlich erhöhte Aufmerksamkeit. Unter optimalen Umständen schafft Herr D. es manchmal seinen Kopf in Richtung einer ihn ansprechenden Person zu wenden.
5.8 Psychische Situation
Im momentanen Stadium des apallischen Syndroms von Herrn D. ist es nicht möglich Kontakt mit ihm aufzunehmen. Es bleibt zu vermuten, dass das Husten des Pat. in gewissen Situationen Unruhe oder Unzufriedenheit ausdrückt. Bei lauten Geräuschen in seiner Umgebung, hustet er deutlich öfter.
5.9 Soziale Situation / soziale Aspekte
Herr D. wird regelmäßig von Familienmitgliedern besucht. Sein Vater und seine Schwester wurden kürzlich in Transfertechniken eingewiesen, was als insgesamt sehr günstig für den Patienten zu betrachten ist. Bedingt durch die Therapie und Pflege des Pat. ist er außerdem mehrmals täglich mit dem Pflegepersonal, sowie mehrere Tage in der Woche mit Ergo- und / oder Physiotherapeuten in Kontakt.
5.10 Schmerzbefund
Eine adäquate Schmerzreaktion zeigt der Pat. seit kurzer Zeit bei Injektionen. Reaktionen auf weitere Schmerzreize sind eher, wie bereits erwähnt ( Husten, Nystagmus ), als Zeichen von Unruhe / Unzufriedenheit zu bezeichnen.
5.11 Zusammenfassung des Befundes mit Priorität der Hauptsymptomatik
Es ist bei dem Pat. in Bezug auf das apallische Syndrom vor allem einzugehen auf eine mögliche Steigerung der Vigilanz, auf die Verhinderung und Verminderung von Kontrakturen, auf den Aufbau der Kopf- und Rumpfstabilität und auf eine Erweiterung der aktiven Beweglichkeit, welche sich im Ansatz bei der Drehung des Kopfes zeigt. Zusätzlich ist es wichtig intensiv auf die sensorische Integration von Tiefensensibilität und Körperschematik einzugehen, um in eine bessere Ausgangslage zur Entwicklung von Gleichgewichtsreaktionen zu gelangen.
Auf die Bereiche der Wahrnehmungsleistung, der Selbsthilfe, des Geistig – funktionellen und der psychischen ist erst nach dem Erreichen einer gesteigerten Vigilanz einzugehen.
6. Therapieziele für die Gesamtbehandlung
Richtziel
- Der Erhalt der Pflegefähigkeit und der Erhalt bzw. die Verbesserung des verbliebenen physiologischen Bewegungsausmaßes
Grobziel
- Förderung der Funktionsfähigkeit von Halte- und Bewegungsapparat des Kopfes
Feinziele
- Förderung der Mobilität und Funktion der Gelenke der HWS - Förderung des Gleichgewichts und Stabilität im Sitzen - Förderung der visuo – motorischen Koordination - Anbahnung, bzw. Aufbau aktiver physiologischer Bewegungen
Grobziel
- Förderung des passiven physiologischen Bewegungsausmaßes der oberen und unteren Extremitäten
Feinziele
- Förderung der Mobilität der Gelenke der oberen und unteren Extremitäten
- Verhinderung bzw. Verminderung der Verkürzung von Sehnen und Muskeln
- Förderung der Tiefen- und Oberflächensensibilität
Grobziel
- Förderung der Körperwahrnehmung und des Körperbewusstseins
Feinziele
- Förderung der Wahrnehmung von Gleichgewichtsveränderungen
- Förderung der kinästhetischen Wahrnehmung
- Förderung der Vigilanz
- Passive Auseinandersetzung mit Schwerkraft zur Verbesserung der Tiefenwahrnehmung
- Förderung der Integration von Basissinnen Grobziel
- Förderung der Aufrichtung und Stabilität des Rumpfes
Feinziele
- Förderung der Aufrichtung des Beckens
- Förderung der Körpersymmetrie
- Förderung bzw. Erhalt des Bewegungsausmaßes der Gelenke des Rumpfes und des Beckens
7. Ergotherapeutischer Behandlungsplan einer Therapieeinheit
7.1 Arbeitsplatz
Die Therapieeinheit findet im Stationszimmer von Herrn D. statt. Sein Bett steht an der Fensterseite und daneben ein zweites, leeres etwa ein und einen halben Meter entfernt in Richtung Zimmertür. An der Wand zwischen den Betten steht ein Tisch auf dem Medikamente, Sondennahrung und Schutzhandschuhe liegen. Rechts neben dem Bett des Pat. steht ein kleiner Nachttisch mit einem Kofferradio. Die beiden Tische können als Ablage für kleinere, therapierelevante Hilfsmittel genutzt werden. Der Ständer mit der Nahrung und der Pumpe für die Ernährungssonde steht zwischen dem Bett und dem größeren Tisch. Es wird vor Therapiebeginn darauf geachtet, dass die Zimmertür geschlossen ist, um für eine möglichst reizfreie Umgebung zu sorgen, und es werden die Vorhänge zugezogen, um die Intimsphäre des Pat. zu wahren. Bei Bedarf wird die Raumbeleuchtung angeschaltet, und es wird bei entsprechendem Wetter und / oder Raumluftverhältnissen ein Fenster geöffnet, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung zu gewährleisten.
7.2 Beschreibung der einzelnen Sequenzen mit:
7.2.1 Zeit
7.2.2 Zielsetzung
7.2.3 Behandlungsmittel
7.2.4 Behandlungsmaßnahmen unter Berücksichtigung des Therapeutenverhaltens
Es wird während der Therapieeinheit ein Co – Therapeut unterstützend mitwirken. Es ist abhängig von der Tagesform des Pat., ob die Therapieplanung, was die Anzahl sowie Dauer der Sequenzen betrifft, einzuhalten ist. Der Pat. ist zu Beginn der Behandlung gewaschen und in seinem Bett gelagert.
1. Sequenz:
Mobilisation im Bett
Dauer: ca. 20 Min.
Zielsetzung:
- Förderung des passiven, physiologischen Bewegungsausmaßes beider Extremitäten
- Förderung der Vigilanz
- Verhinderung bzw. Verminderung der Verkürzung von Sehnen und Muskulatur
- Förderung bzw. Erhalt des Bewegungsausmaßes der Gelenke des Rumpfes und des Beckens
- Förderung der Tiefen- und Oberflächensensibilität
Behandlungsmittel:
- mehrere Lagerungskissen
- höhenverstellbares Bett
- Handtuch
Behandlungsmaßnahme:
Nachdem ich den Pat. begrüßt und evt. geweckt habe, kontrolliere ich den Zustand des Trachealkanülenaufsatzes und wechsele diesen gegebenenfalls. Zusätzlich wird der Schlauch der Ernährungssonde abgeklemmt und getrennt. Ich benenne nahezu jede meiner Handlungen, um Herrn D. auf eventuelle Geräusche und Berührungen aufmerksam zu machen. Nach dem Entfernen der Bettdecke wird der Intimbereich des Pat. mit einem Handtuch verdeckt. Der Pat. wird auf den Rücken gelagert. Beginnen werde ich mit der Mobilisation des Rumpfes und der Schulter. Danach werden die distalen Gelenke mobilisiert. Bei einigen Maßnahmen werden die Beine des Pat. entweder vom Co – Therapeuten oder von Lagerungskissen gehalten.
2. Sequenz:
Mobilisation an der Bettkante
Dauer: ca. 15 Min.
Zielsetzung:
- Förderung der Körperwahrnehmung
- Förderung des Gleichgewichts
- Förderung der Rumpfstabilität
- Förderung der Aufrichtung des Beckens und des Kopfes
- Förderung der Körpersymmetrie
Behandlungsmittel:
- höhenverstellbares Bett
- Handtuch
- würfelförmige Unterlage
Behandlungsmaßnahme:
Nachdem der Pat. an die Bettkante gesetzt wurde, wird das Bett so in der Höhe verändert, dass die Füße plan auf einer Unterlage aufliegen. Der Co – Therapeut hält hinter dem Pat. dessen Rumpf und Kopf in Aufrichtung. Ich führe den Oberkörper des Pat. langsam von einer Seite zur Anderen, um Gleichgewichtsreaktionen anzubahnen.
3. Sequenz:
Transfer in den Rollstuhl
Dauer: ca. 20 Min.
Zielsetzung:
- Förderung der Stabilität im Sitzen
- Förderung bzw. Erhalt der Mobilität und Funktion der Gelenke der HWS
- Förderung der visuo – motorischen Koordination
- Förderung der Basissinne
- Förderung der kinästhetischen Wahrnehmung
- Förderung der Vigilanz
Behandlungsmittel:
- Rollstuhl
- Rollstuhlaufsatz
- evt. ein Halstuch
Behandlungsmaßnahme:
Der Patient sitzt an der Bettkante und wird mit Hilfe des Co – Therapeuten über den sogenannten „australischen Transfer“ in den Rollstuhl gehoben. Zu beachten ist hierbei, dass der Katheterbeutel und dessen Zuleitung die Therapeuten und den Pat. beim Transfer nicht behindern. Sitzt der Pat. im Rollstuhl, wird gegebenenfalls seine Haltung so korrigiert, dass er im physiologischen Sinne korrekt im Rollstuhl sitz. Um den Rumpf und die Schultern zu stützen wird vor seinem Bauch ein Rollstuhlaufsatz befestigt. Wenn nötig wird der Kopf des Pat. mit einem um die Stirn gelegtem und am Kopfteil des Rollstuhls befestigtem Halstuch fixiert, um zu verhindern das der Kopf nach vorne kippt. Bei guter Tagesform des Pat. genügt es die Neigung der Rollstuhllehne ein wenig nach hinten einzustellen.
8. Vorschläge zur weiteren ergotherapeutischen Behandlung unter Berücksichtigung von Steigerungsmöglichkeiten
Es sollte im weiteren Therapieverlauf eine Steigerung der Vigilanz weiterhin angestrebt werden. Zudem sind Maßnahmen zur Kontrakturprophylaxe und Mobilisation des Bewegungsapparates, wie bereits unter Punkt 6 und 5.11 beschrieben, intensiv fortzuführen.
9. Ergotherapeutische Behandlungsdokumentation
Es befinden sich in den Anlagen unter Punkt 11 drei in dieser Einrichtung übliche Vordrucke von therapeutischen Behandlungsdokumentationen.
10. Literaturnachweis
- Pschyrembel
- Rote Liste
- Unterlagen aus dem Schulunterricht
- Patientenakten
11. Anlagen
siehe die Nächste und folgende Seiten
Ich versichere diesen Bericht allein angefertigt und alle dabei benutzten Hilfsmittel angegeben zu haben.
Ort, Datum:
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist ein ergotherapeutischer Bericht über einen Patienten mit hypoxischem Hirnschaden, der sich im apallischen Syndrom befindet. Es enthält Informationen zur Anamnese, Diagnose, ärztlichen Verordnung, begleitenden Maßnahmen, ergotherapeutischen Befundaufnahme, Therapieziele, Behandlungsplan und Vorschläge zur weiteren Behandlung.
Was beinhaltet die Anamnese?
Die Anamnese umfasst persönliche Daten des Patienten (verschlüsselt aus Datenschutzgründen) und medizinische Daten, insbesondere den Krankheitsverlauf, der einen schweren alkohol- und kokainbedingten Vorfall mit Reanimation umfasst.
Welche Diagnosen werden im Bericht genannt?
Die Diagnosen sind: hypoxischer Hirnschaden mit protrahiertem Hirnödem und rezidivierenden cerebralen Krampfanfällen bei Zustand nach Reanimation bei Asystolie nach Alkohol- und Kokainintoxikation, apallisches Syndrom und symptomatische Epilepsie.
Welche ärztliche Verordnung zur ergotherapeutischen Behandlung liegt vor?
Es liegt eine Verordnung für 24 ergotherapeutische Behandlungen, 2 mal wöchentlich, zur Verbesserung der Körperwahrnehmung, des Körperschemas und der Sensorik vor.
Welche begleitenden therapeutischen Maßnahmen werden beschrieben?
Zu den begleitenden Maßnahmen gehören Physiotherapie (2 mal wöchentlich) und Medikation (Rivotril Tropfen, Akatinol Tropfen, Orfiril, Paspertin Tropfen). Außerdem werden verschiedene Hilfsmittel aufgeführt.
Was beinhaltet die ergotherapeutische Befundaufnahme?
Die Befundaufnahme umfasst einen Sichtbefund (Erstgespräch, äußeres Erscheinungsbild, Dynamik/Statik), einen motorisch-funktionellen Befund (Funktionsanalyse, Tonusverhältnisse), Gleichgewicht, Sensibilität (Oberflächen- und Tiefensensibilität), Wahrnehmungsleistung, Selbsthilfebefund, geistig-funktionellen Befund, psychische und soziale Situation sowie einen Schmerzbefund. Der Befund wird anschließend zusammengefasst.
Welche Therapieziele werden für die Gesamtbehandlung festgelegt?
Die Therapieziele umfassen: Erhalt der Pflegefähigkeit und des physiologischen Bewegungsausmaßes, Förderung der Funktionsfähigkeit von Halte- und Bewegungsapparat des Kopfes, Förderung des passiven physiologischen Bewegungsausmaßes der Extremitäten, Förderung der Körperwahrnehmung und des Körperbewusstseins sowie Förderung der Aufrichtung und Stabilität des Rumpfes.
Wie sieht der ergotherapeutische Behandlungsplan einer Therapieeinheit aus?
Der Behandlungsplan beinhaltet Mobilisation im Bett, Mobilisation an der Bettkante und Transfer in den Rollstuhl. Jede Sequenz wird hinsichtlich Zeit, Zielsetzung, Behandlungsmittel und Behandlungsmaßnahmen beschrieben.
Welche Vorschläge zur weiteren ergotherapeutischen Behandlung werden gemacht?
Es wird eine weitere Steigerung der Vigilanz angestrebt. Zudem sind Maßnahmen zur Kontrakturprophylaxe und Mobilisation des Bewegungsapparates intensiv fortzuführen.
Welche Dokumentation ist in den Anlagen zu finden?
Es befinden sich drei in dieser Einrichtung übliche Vordrucke von therapeutischen Behandlungsdokumentationen in den Anlagen.
Was sind die Hauptsymptome, auf die in Bezug auf das apallische Syndrom eingegangen werden soll?
Es soll vor allem auf eine mögliche Steigerung der Vigilanz, auf die Verhinderung und Verminderung von Kontrakturen, auf den Aufbau der Kopf- und Rumpfstabilität und auf eine Erweiterung der aktiven Beweglichkeit eingegangen werden. Zusätzlich ist es wichtig intensiv auf die sensorische Integration von Tiefensensibilität und Körperschematik einzugehen.
- Quote paper
- Stefan Junggebauer (Author), 2002, Praktikumsbericht im motorisch-funktionellen Bereich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108751