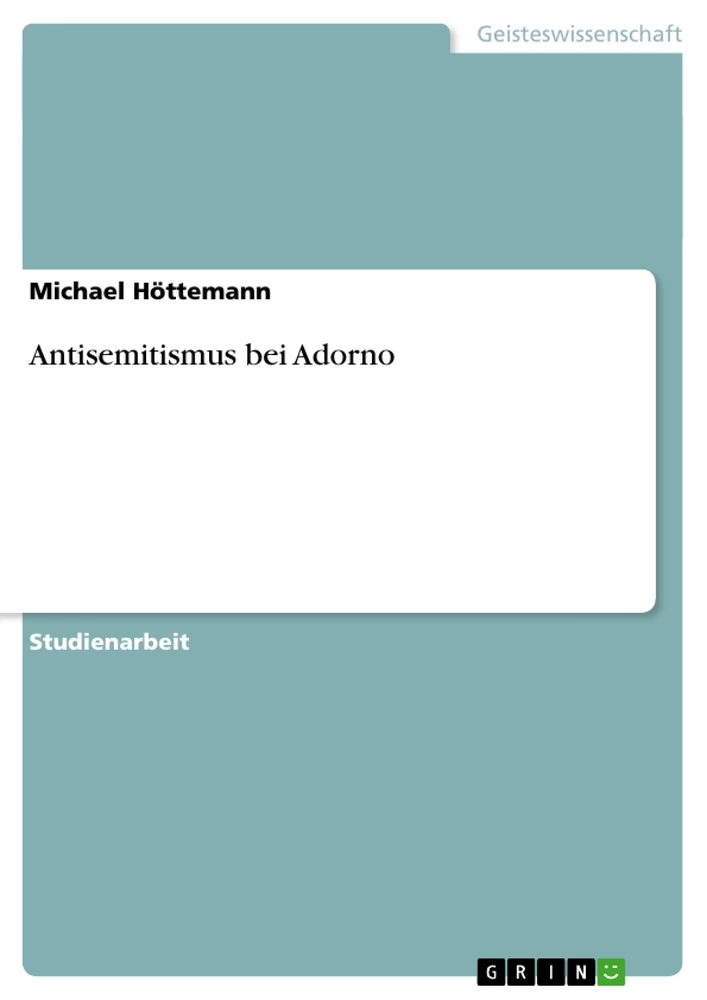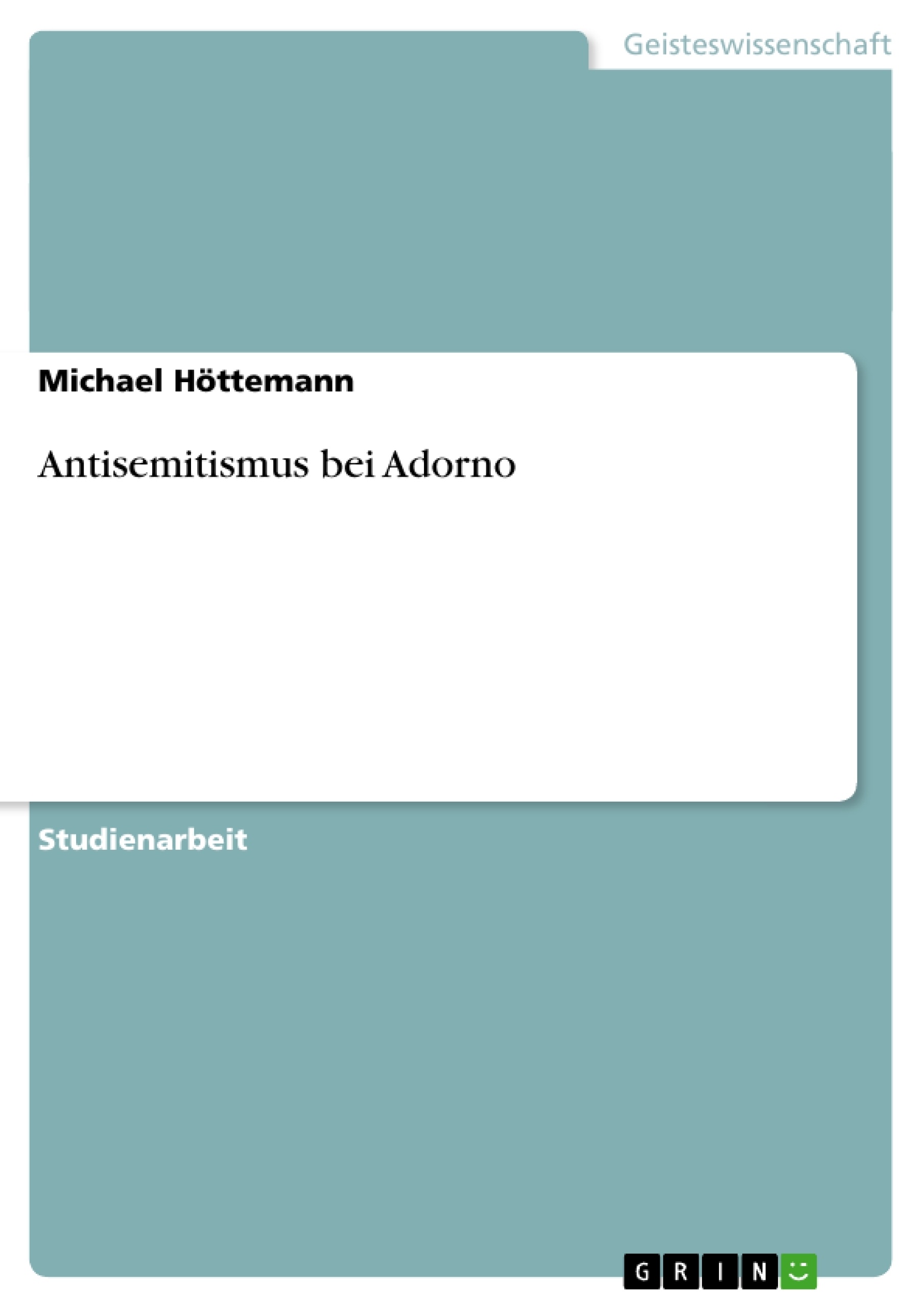Gliederung
1. Einleitung
2. Der Begriff des Antisemitismus
3. Verschiedene Ebenen und Dimensionen des Antisemitismus
3.1. Zivilisationstheoretische Grundlagen
3.2. Gesellschaftliche Ebene
3.2.1. Dimension der Staatsform
3.2.2. Sozial-ökonomische Dimension
3.2.3. Religiöse Dimension
3.3. Psychologische Ebene
3.3.1. Falsche Projektion
3.3.2. Das „autoritäre Syndrom“ und der „manipulative Typus“
4. Fazit
5. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Antisemitismusbegriff bei Adorno. Als Quellen dienen vor allem die „Elemente des Antisemitismus“, wie sie in der Ausgabe der „Dialektik der Aufklärung“ von 1947 in 7 Thesen aufgeführt sind. Des Weiteren wurden Teile des Forschungsberichts „Studien zum Autoritären Charakter“ aus den Jahren 1949-50 verwendet, hier vor allem Adornos psychologische und soziologische Interpretationsansätze der Ergebnisse. Als Grundlage und zur Einordnung und Interpretation der Ergebnisse wird das zentrale Werk Dialektik der Aufklärung herangezogen.
Adorno hat an keiner Stelle eine in sich geschlossene Analyse des Antisemitismus entwickelt. Vielmehr werden in den Elementen des Antisemitismus [1] verschiedene Aspekte eines Phänomens dargelegt, das Adorno in direktem Zusammenhang zu den Thesen der Dialektik der Aufklärung sieht. Sie sind mit dem Kommentar „Grenzen der Aufklärung“ versehen. Adorno bezeichnete sie an anderer Stelle auch als Elemente einer „Gesamt- Theorie des Antisemitismus“, d.h. sie hätten noch ergänzt werden müssen (vgl. Adorno 1986, Gesammelte Schriften 20.1, S. 371f. - Im Folgenden zitiert als GS).
Die psychologischen und soziologischen Interpretationsansätze, die in den „Studien zum Autoritären Charakter“ zu finden sind, entstanden in direktem Zusammenhang zu verschiedenen Forschungsprojekten des Instituts für Sozialforschung - in Kooperation mit anderen Forschungsinstituten in den U.S.A. - über das Vorurteil, Ethnozentrismus und Faschismus. Die Forschungsprojekte wurden von verschiedenen Wissenschaftlern getragen und Adorno liefert hier vor allem Erklärungsansätze für die empirischen Ergebnisse. Man kann diese Arbeiten nicht als Quelle für eine einheitliche Antisemitismusanalyse Adornos nutzen.
Der Versuch, der in dieser Arbeit unternommen wird, ist der, verschiedenen Aspekte zusammenzuführen, nach eigenem Ermessen zu ordnen und eine Übersicht zu ermöglichen. Ein darüber hinausgehendes, „spekulativ-interpretierendes“ Moment ist ebenfalls enthalten.
Die Arbeit besteht im Kern aus drei Teilen. Im ersten (3.1.) soll eine der philosophischen Grundthesen Adornos vorgestellt werden: Die Entstehung von Herrschaft, welche für die Trennung von Subjekt und Objekt konstitutiv ist. In einem dialektischen Vorgang wandelt sich ihre Qualität und geht zu blinder Naturherrschaft über. Dieses Konzept ist Voraussetzung für Adornos Zivilisationstheorie[2] und hat tief greifenden Einfluss auf seine gesellschaftlichen und psychologischen Annahmen, welche in den Teilen 3.2. und 3.3. folgen. Es sei vorweg gesagt, dass die Art und Weise wie sich blinde Herrschaft in der Gesellschaft und dem Individuen zeigt pathologischer, also krankhafter Art ist und weitreichende Folgen hat.
2. Der Begriff des Antisemitismus
Es soll kurz erläutert werden was in dieser Arbeit unter dem Begriff verstanden wird und auf welchem Grundkonzept er in den Studien zum Autoritären Charakter beruht.
Antisemitismus ist irrationaler Hass auf „die Juden“[3]. Dieser kann sich z.B. in Vorurteilen ausdrücken („Juden haben zu viel Einfluss in Hollywood“, „Juden sind hinterhältig“, …) und wäre dann eher auf einer Meinungsebene oder Diskursebene anzutreffen. Er kann allerdings radikalere Formen annehmen, so etwa die Exklusion von Menschen aus gesellschaftlichen, politischen oder ökonomischen Positionen und Räumen, und bis hin zu Vernichtungswünschen und deren praktischer Umsetzung (etwa in Pogromen) führen. In gewisser Weise zeichnet dieser Vernichtungswunsch sogar die Besonderheit des Judenhasses aus. Antisemitismus setzt sich in dieser Krassheit vom Phänomen des Rassismus gegen Minderheiten (Schwarze, Behinderte, u.a.) ab. Die Struktur ist nach Adorno aber bei beiden Phänomenen die gleiche (vgl. GS 20.1, S.374).
Antisemitismus ist irrational, weil - und das ist eine Grundhypothese in den Studien zum Autoritären Charakter – er unabhängig von einem Objekt existiert. Er ist strukturell begründet. Das heißt konkret, dass es relativ unbedeutend ist, ob die Gruppe (etwa „die jüdische Rasse“), die den Hass auf sich zieht, überhaupt als solche existiert, oder ob zugeschriebene Eigenschaften in irgendeiner Weise „objektiv“, also rational, begründet sind. Deshalb wurde dem Antisemitismus ein funktionaler Charakter zugeschrieben, d.h. er macht – wenn schon nicht objektiv – in irgendeiner Weise im gesellschaftlichen und psychologischen Haushalt doch „Sinn“: Er erfüllt Funktionen. Diese werden noch aufgeführt werden müssen.
Es ergibt sich weiterhin die Frage, was Juden denn „ausmacht“, dass sie der Antisemitismus als Ziel von Hassentladungen und Vernichtungswünschen wählt, wenn es doch objektiv keine Gründe dafür gibt. In den verwandten Quellen wird relativ wenig auf diese Gründe eingegangen, an entsprechenden Stellen soll auf diese aber verwiesen werden.
Ein besonderes Kennzeichen des Antisemitismus ist also, dass er unabhängig von den Menschen existiert, die davon betroffen sind. Es ist zu vermuten, dass auch andere Zielobjekte möglich wären. Das macht den Antisemitismus besonders beunruhigend. Er löst sich durch die Abwesenheit vom gewählten Objekt nicht etwa auf, sondern „schmort“ in der Gesellschaft weiter und kann jederzeit wieder ausbrechen.
3. Verschiedene Ebenen und Dimensionen des Antisemitismus
3.1. Zivilisationstheoretische Grundlagen
Der Ausgangspunkt der Entwicklung der menschlichen Zivilisation, wie sie in der Dialektik der Aufklärung nachgezeichnet wird, ist die der Trennung von Subjekt und Objekt[4]. Damit man in einer sinnvollen Weise von Zivilisation sprechen kann, muss sich zunächst einmal ein Wesen mit einem Bewusstsein über sich selbst, der Mensch, bilden, welches die Fähigkeit und den Willen zur bewussten Entwicklung hat. Hier liegt sozusagen der Stein des Anstoßes. Die nachfolgenden Argumentationen sind deshalb naturgemäß philosophischer Art.
Bewusstsein über sich selbst schließt die Entwicklung eines Bewusstseins über das „Andere“ mit ein. Erst dann vollzieht sich die Trennung von Mensch und Natur.
Dieser Prozess ist für Adorno nur denkbar durch den Einsatz und die Ausübung von Herrschaft: „Das Erwachen des Subjekts wird erkauft durch die Anerkennung der Macht als das Prinzip aller Beziehungen“ (Adorno & Horkheimer 2003, Dialektik der Aufklärung S.15 - Im Folgenden zitiert als: D.d.A.).
In dem Moment in dem sich das Subjekt als einzelnes Wesen im Gegensatz zu einer es überwältigenden, bedrohenden Natur versteht, wird es zunächst in irgendeiner Weise versuchen diesen Nachteil „abzumildern“. Dafür muss Natur berechenbar gemacht werden. Berechenbar kann an dieser Stelle als Vorstufe zu „beherrschbar“ verstanden werden. Bei diesem Unterfangen, der Naturbeherrschung, kann man begrifflich zwei Stufen der zivilisatorischen Entwicklung bei Adorno voneinander trennen: Die erste ist das mythische Zeitalter, die zweite das aufgeklärte Zeitalter[5].
Im mythischen Zeitalter sind die Versuche des Menschen die Natur zu beherrschen noch recht rudimentär. So ist die Natur der Sitz von Dämonen und Geistern, transzendentalen Übermächten, deren Kontrolle sich dem Menschen entziehen, welche aber durch Rituale zu besänftigen oder sogar zu verschrecken sind. Eine der Grundfunktionen im Mythos ist deshalb der Einsatz von Mimesis[6], einem „symbolischen Anschmiegen an die Natur“. Durch „Sich-Ähnlichmachung“ ist es dann etwa dem Schamanen möglich mit Dämonen oder Geistern in Kontakt zu treten, diese zu besänftigen oder sogar (zeitweise) zu verjagen.
Im aufgeklärten Zeitalter stehen dem Menschen weitaus effektivere Methoden zur Naturbeherrschung zur Verfügung. Der Einsatz von Verstand und Technik führt dazu sich Natur vom Leib zu halten, Ackerböden besser auszubeuten, sich vor dem Zorn der Götter zu schützen. Die letztgenannten verlieren dann sowieso mit dem Einzug der bürgerlichen Aufklärung völlig an Bedeutung. In dieser menschlichen Epoche steht die Entwicklung der Herrschaft über die Natur an einem symbolischen Endpunkt. Die Vernunft wird an die Stelle der Gottheit gesetzt. Sie allein wird zum obersten Prinzip aller Dinge in der Welt. Die Mythen werden systematisch überwunden und durch Formel, Regel und Wahrscheinlichkeit (vgl. D.d.A., S. 11) ersetzt. Für den aufgeklärten Bürger wird so Religion zum Aberglauben oder bekommt Zweckcharakter[7]. Die Frage nach Wissenschaftlichkeit und alles durchdringender Erklärung wird zur obersten Maxime.
Als zentrale, dialektische Merkmale der zivilisatorischen Entwicklung ergänzt nun Adorno, dass der Mythos schon Aufklärung war. „Der Mythos wollte berichten, nennen, den Ursprung sagen: damit aber darstellen, festhalten, erklären.“ Die letzten drei Elemente stehen dabei für Merkmale aufgeklärten Denkens. Umgekehrt fällt Aufklärung in dem Moment in den Mythos zurück in dem sie „vergisst“ wozu sie eigentlich bestimmt war, nämlich ein Individuum zu schaffen, das frei, gleich und selbst bestimmt ist (es geht also der Idee nach um diese Forderungen, denen die Vernunft dienen soll). Da aber die Vernunft selbst zum obersten Prinzip avanciert, geht das Ziel, die Emanzipation des Individuums, verloren: „Rücksichtslos gegen sich selbst hat die Aufklärung noch den letzten Rest ihres eigenen Selbstbewusstseins ausgebrannt. Nur solches Denken ist hart genug, die Mythen zu zerbrechen, das sich selbst Gewalt antut.“ (D.d.A. S.10)
Das Resultat aus diesem dialektischen Prozess ist fatal. Das Individuum unterwirft sich einer Logik, die von Horkheimer auch „instrumentelle Vernunft“[8] genannt wird, einem „Denken“, dass nur auf Zwecke nicht auf Ziele ausgerichtet ist. Es wird so von diesem Denken beherrscht, anstatt durch das Denken zu herrschen. Dazu eine weitere Textstelle: „Ihren eigenen Ideen vom Menschenrecht ergeht es dabei nicht anders als den ältesten Universalien. […] Das rührt daher, dass Aufklärung auch in den Mythen noch sich selbst wieder erkennt.“ (D.d.A. S.12). Ein wichtiger Aspekt, der in der späteren Argumentation Adornos noch eine wichtige Rolle spielen wird, schwingt hier mit: Dass in einer vollends aufgeklärten Welt genau die vernünftigen Errungenschaften (z.B. die Menschenrechte) zur Diskussion gestellt werden können, die ursprünglich von der Aufklärung erst ermöglicht werden sollten. Wenn so etwa humanistische Werte als Mythos erkannt werden sollten, treibt die Aufklärung dazu an, sie völlig auszuschalten.
Am Ende der Argumentationskette steht die blinde Herrschaft der Natur, der Naturzwang. Das Individuum fällt auf bloßen Objektstatus zurück. Mit Natur ist in diesem Fall nicht die Natur gemeint von der das Subjekt sich zu Beginn des Zivilisationsprozesses distanziert. Vielmehr ist diese Natur als ein nach blinden, nicht beeinflussbaren Regeln funktionierendes Prinzip zu verstehen: „Jeder Versuch, den Naturzwang zu brechen, indem Natur gebrochen wird, gerät nur umso tiefer in den Naturzwang hinein.“ (D.d.A., S.19)
Diese Argumentationskette ist elementar für eine Erklärung von Adornos Vorstellung über die Funktion des Antisemitismus. Die gleiche dialektische Gedankenfigur auf der Ebene der zivilisationstheoretischen Ebene zieht sich weiter durch die gesellschaftstheoretischen Annahmen und bis auf das psychologische Fundament des Individuums. Das recht abstrakte Modell der blinden Naturherrschaft hat also schwerwiegende Auswirkungen auf alle Formen menschlichen Lebens und Zusammenlebens.
3.2. Gesellschaftliche Ebene
Versteht man unter Adornos Ausführungen die Erklärung der Entstehung und der Voraussetzungen für jede menschliche Geschichte, so kann man die gesellschaftstheoretische Dimension als diejenige betrachten, in der sich diese dialektischen „Gesetze“ in geschichtlichen Epochen „kristallisieren“. Es geht also darum, wie der dialektische Grundgedanke der Zivilisationsgeschichte unter konkreten geschichtlichen Hintergründen zu verschiedenen Gesellschaftsformen führt. Adorno geht in seinen verschiedenen Ausführungen zur Gesellschaft vor allem auf die Epoche ein, die vom Kapitalismus geprägt ist. Auf der einen Seite steht die bürgerliche Gesellschaft, auf der anderen die industrielle bzw. spätkapitalistische [9] Gesellschaft.
In der Ersten emanzipieren sich die bürgerlichen Schichten vom Adel und führen eine liberale, sich frei entfaltende, Wirtschaftsform, den Kapitalismus, ein. Zusammen mit der Wirtschaftsform entsteht auch ein neues Verständnis von (Menschen-)Recht und Gesetz. Es entstehen erste Industrien, die unter der Kontrolle dieser Schicht florieren. Die spätkapitalistische Wirtschaft zeigt dann eine Zusammenballung von ursprünglich vielen kleinen Fabriken zu großen industriellen Trusts. Die bürgerliche Schicht verliert die Kontrolle über die Produktionsmittel, welche von Konzernen, Aktiengesellschaften, Banken, etc. übernommen werden.
Für Adorno ist der Kapitalismus - unter Anderem - durch die Beherrschung von Menschenmassen charakterisiert. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied zwischen bürgerlicher und spätkapitalistischer Herrschaftsform: In der einen sind es noch Individuen, die über andere Individuen herrschen. In der anderen ist das Individuum „verloren“ gegangen. In den großen Kapitalgesellschaften sind Manager austauschbar, Besitzer nicht bestimmbar, es herrscht reine Bürokratie. So kommt es dazu, dass niemand konkretes mehr über anderes herrschen kann: „Indem die bürgerliche Wirtschaft die Gewalt durch die Vermittlung des Marktes vervielfachte, hat sie auch ihre Dinge und Kräfte so vervielfacht, dass es zu deren Verwaltung nicht bloß der Könige, sondern auch der Bürger nicht mehr bedarf: nur noch Aller“ (D.d.A., S.49).
Für Adorno sind beide Formen von Gesellschaft falsche Gesellschaftsordnungen. Es gibt eine Differenz zwischen dem idealisierten Selbstbild der aufgeklärten Gesellschaft und der tatsächlichen Realisierung dieser Ideale. Adorno nimmt vor allem die Ideale der bürgerlichen Gesellschaft unter die Lupe, weil diese direkt durch die Forderungen der bürgerlichen Aufklärung ausgedrückt werden: Freiheit, Gleichheit und Autonomie. Schon zu Frühzeiten des bürgerlichen Kapitalismus waren diese Ideale nur für wenige einlösbar. Für das Gros der Gesellschaft blieben diese Forderungen ein unerfüllter Traum. Aber auch die Bürgerschaft selbst hatte sich die Erfüllung ihrer Ideale nur durch die Unterordnung unter das kapitalistische Prinzip „erkauft“. Dieses entfaltet sich im Spätkapitalismus zur totalen bürokratischen Kontrolle. Die Gesellschaft hält allerdings weiterhin an der „Methode“ (dem Kapitalismus), die zur Emanzipation führen sollte, fest. Statt einer Gesellschaft, die aus vielen Individuen besteht, besteht dann die Gefahr der Entstehung einer integralen Gesellschaft, welche die Subjekte bis ins tiefste Innerste formt und ihnen keine Möglichkeit mehr gibt, sich von ihr zu emanzipieren[10]. Egal welche Tendenzen in einer solchen Gesellschaft vorherrschen (etwa zerstörerische wie im Faschismus), sie „schlagen“ dann direkt bis auf das Subjekt durch. Man beachte die Parallele zur Idee der blinden Naturherrschaft.
Es wird aus Adornos Texten deutlich, dass der freie Kapitalismus Voraussetzung für die Emanzipation der Bürger war. Nur implizit scheint sich auszudrücken, dass auf der anderen Seite die Tendenzen des Spätkapitalismus, einem total verwaltetem Kapitalismus, zum Faschismus führen können. Für Adorno gibt es auf jeden Fall eine Kontinuität der Entwicklung der Aufklärung, die im Faschismus im Rückfall in die Barbarei kulminiert. In dieser Idee erkennen wir eine weitere Kernidee Adornos gesellschaftstheoretischer Annahmen: Vernichtungswille wird aus der falschen Gesellschaftsordnung heraus produziert.
3.2.1. Dimension der Staatsform
In der ersten Antisemitismusthese in der Dialektik der Aufklärung geht Adorno auf den Antisemitismus des bürgerlichen (demokratischen) Liberalismus und des vom totalitären (antidemokratischen) Faschismus ein. Beide Formen des Antisemitismus haben unterschiedliche Qualitäten.
Die bürgerliche Gesellschaft hat die Forderung nach Gleichheit und sieht die „Einheit der Menschen als prinzipiell bereits verwirklicht“ (D.d.A., S.177f.). Die Existenz von angepassten, aber nicht assimilierten Juden[11] „verleumdet“ dagegen einen solchen Zustand. Adorno schreibt ihnen das „unabänderliche Festhalten an ihrer eigenen Ordnung“ zu, das sie zur „herrschenden [Ordnung] in ein unsicheres Verhältnis“ bringt (D.d.A., S.178).
Eine Quelle von Antisemitismus findet sich also latent in der Bürgerschaft, welche ihre Ideale durch die Existenz der jüdischen Minderheit mitten in ihrer Gesellschaft – also einer Gruppe, die trotz ihrer Unterschiede „dazugehören“ will - kompromittiert sieht. Allerdings wird Juden hier noch die Möglichkeit zur Assimilation - welche eine vollständige sein muss - gegeben.
Eine andere Qualität von Antisemitismus zeigt dagegen der Faschismus. In ihm wird nicht die Existenz einer noch nicht assimilierten Minderheit als ein „Problem“[12] gesehen, sondern er schreibt dieser Minderheit zu, sich gar nicht assimilieren zu können. „Der Jude“ wird als Gegenrasse geschaffen, er wird das „negative Prinzip als solches“ (D.d.A., S.177). Assimilation ist deshalb im Faschismus keine Lösung des „Judenproblems“: Die physische Vernichtung steht hier im Zentrum des politischen Programms! Diese ist möglich weil ihnen – und das wurde in den Ausführungen zum Menschenrecht in 3.1 gezeigt – substanzielle Grundrechte in „begründeter Weise“ entzogen werden können.
Wir haben weiterhin gesehen, dass die Dialektik der Aufklärung aus sich heraus „die“ falsche Gesellschaftsordnung hervorbringt. Für Adorno ist der Faschismus die Gesellschaftsordnung, die die barbarischen Tendenzen der Aufklärung am stärksten „auslebt“. Das Bild, das der Faschismus von „den Juden“ prägt, drückt insgeheim sein eigenes Wesen aus, er projiziert (siehe 3.3.1). Dieses Wesen ist die negative Kehrseite der dialektischen Aufklärung – besser, eine „Grenzerscheinung“ ihrer selbst: Es trachtet nach „ausschließliche(m) Besitz, Aneignung, Macht ohne Grenzen, um jeden Preis“ (D.d.A., S.177). Im Faschismus darf nichts anders sein: „Mit der Vernichtung all dessen, was der verwirklichten Universalität scheinbar entgegensteht […], ist auch der unaufhebbare Widerspruch zwischen bestimmten Versprechen und ihrer offenkundigen Nicht-Realisierbarkeit scheinbar aufgehoben.“ (Stein 2001, S.51). Das bestimmte Versprechen wäre hier die Freiheit durch Aufklärung für alle, die Realität und die totalitäre, faschistische Herrschaft über alle.
Man sieht also, dass der Antisemitismus des bürgerlichen Liberalismus und des totalitären Faschismus in einem Kontinuum (vgl. Stein 2001, S.52) miteinander verbunden sind. In beiden Gesellschaftsformen wird das Allgemeine durch das Besondere kompromittiert. Die Reaktion ist allerdings unterschiedlich. Auf Seiten der Bürger steht die Forderung nach vollständiger Assimilation, auf der Seite der Faschisten die vollständige Vernichtung.
3.2.2. Sozial-ökonomische Dimension
In der zweiten und dritten Antisemitismusthese fragt Adorno nach sozialen und ökonomischen Gründen für den Antisemitismus. Zunächst begegnet er historischen Gegebenheiten: Dass etwa im Mittelalter jüdische Siedlungen geplündert wurden, später im Nationalsozialismus in Deutschland jüdisches Eigentum „arisiert“ wurde. Er konstatiert zunächst, dass – wenn man den Antisemitismus als Massenphänomen betrachtet – er keinen ökonomischen Gewinn für die breite Masse bringt, höchstens für bestimmte Eliten. Trotzdem macht Antisemitismus auch im ökonomischen System des Kapitalismus „Sinn“. Dies ist von zwei Seiten her zu betrachten. Von der Seite der Arbeiter und von der der Kapitalisten.
Adorno war Vertreter der Marxschen Ökonomie. Marx hat durch seine Mehrwerttheorie gezeigt, dass in kapitalistischen Produktionsverhältnissen der Arbeiter ausgebeutet wird. Der große Teil der Arbeiter wird um einen Anteil am Mehrwert „betrogen“. Ihm wird – trotz liberaler Wirtschaft – die ökonomische Unabhängigkeit verweigert. Für Adorno ist der Kapitalismus vor allem eins: „die Verkleidung von Herrschaft in Produktion“ (D.d.A., S.182). Antisemitismus ist so Ausdruck der Wut der um ihren gerechten Anteil „geprellten Massen “. Sie suchen Verantwortliche für ihre Lage, erkennen aber nicht das das kapitalistische System „an sich“ als Problem, sondern finden lediglich die Vertreter des Kapitals auf der Bühne der Zirkulationssphäre, also dem Markt. Hier stechen jüdische Händler, Kaufleute, Bankiers, etc. ins Visier. Adorno sagt nicht, dass diese besonderen Einfluss in der Zirkulationssphäre hätten, vielmehr fallen sie auf „ohne Schutz“ (D.d.A., S.180).
So waren etwa Juden seit dem Mittelalter in Europa durch Einschränkungen ihrer Rechte in bestimmte Berufsgruppen hineingezwungen worden[13]. In diesem Kontext soll auf den Unterschied zwischen „schaffenden und raffenden“ Kapital – zwei Begriffen die durch die Nationalsozialisten geprägt wurden – hingewiesen werden. Mit schaffendem Kapital wird gesellschaftliche Produktivität und körperliche Arbeit, mit dem raffenden, Müßigkeit und Raffgier verbunden. Juden wird beim antisemitischen Stereotyp die Zugehörigkeit zum raffenden Kapital zugeschrieben. Juden fallen so nicht nur – wie in der liberalen Gesellschaftsordnung – als Besonderes im Allgemeinen auf, sondern auch als Vertreter einer Produktionsweise, die ungerecht ist. Dies zieht den Hass des „kleinen Mannes“ auf sie. Mit den ökonomischen Verhältnissen im Hinterkopf kann man also sagen, dass alle Juden die Verantwortung für etwas übernehmen müssen, für das nur ein kleiner Teil von ihnen – und dann auch nur zu einem Bruchteil – „mitverantwortlich“ ist. „Er [„der Jude“] ist in der Tat der Sündenbock […] in dem umfassenden Sinn, dass ihm das ökonomische Unrecht der ganzen Klasse aufgebürdet wird“ (D.d.A., S.183).
Man kann aus diesen Ausführungen eine wichtige soziale Funktion, die sich aus ökonomischen Umständen ergibt, ableiten: Antisemitismus dient auf Seiten der Massen der Gleichmacherei: „Denen […] soll es ebenso schlecht gehen, wie dem Volk“ (D.d.A., S.179). Hier zeigt sich der Aspekt des Neids und der Destruktivität gegenüber dem Kapitalismus und seinen (vermeintlichen) Vertretern. „Der eigentliche Gewinn […] ist die Sanktionierung seiner [des Antisemiten] Wut. […] Für das Volk ist er [der Antisemitismus] Luxus“ (D.d.A., S.179).
So dient er auf der Seite der Arbeitermassen als „Ablassventil“ für eine Frustration, die durch ökonomische Unterdrückung zustande kommt. Auf Seiten der Kapitalisten erfüllt er den Zweck von sich als Zielobjekt der Massen (wie im bewussten Klassenkampf der Fall) abzulenken und ihre eigene Herrschaft zu sichern.
3.2.3. Religiöse Dimension
Um den Beitrag der Religion zum Antisemitismus zu erläutern, wird in der vierten Antisemitismusthese Adornos zum einen auf die Bedeutung von Religion in der modernen Gesellschaft verwiesen. Danach werden die beiden Religionen Judentum und Christentum in ihrer Bedeutung analysiert um am Ende die These des Hasses der Vaterreligion durch den Sohn zu vertreten.
Adorno konstatiert zunächst, dass die Bedeutung von christlicher (gelebter) Religion in deutlicher Weise abgenommen hat. Deshalb spielt ursprünglicher religiöser Antisemitismus (wie z.B. die Anklage, „die Juden“ hätten Jesus ermordet) in der Gesellschaft kaum noch eine Rolle. Dennoch ist für Adorno die Bedeutung von christlichem Judenhass nicht völlig verloren gegangen. Er sagt, dass die Art und Weise, wie der völkische Antisemitismus vehement seine religiösen Wurzeln verneint, ein Fortbestand von religiösem Antisemitismus vermuten lässt. Dieser müsste in „transformierter“ Weise irgendwo wieder zu finden sein. Dafür stellt Adorno die These auf, dass sich die christliche Religion in der Moderne verdinglicht hat und so inhaltslose Teilelemente, wie religiöser Eifer oder eben der Hass auf Juden, Einzug in die allgemeine Kultur erlangt haben und dort noch weiter wirken. „Bei den deutschen Christen blieb von der Religion der Liebe nichts übrig als der Antisemitismus.“ (D.d.A., S.185) Der Faschismus nutzt hierbei religiöse Urgefühle und gliedert sie in seine eigene Ideologie ein[14].
Das Judentum ist für Adorno eine fortgeschrittene Religion, die sich von den Religionen animistischer Zeiten gelöst, deren Gott „allerdings die Züge des Naturdämons noch nicht völlig abgeworfen“ hat (D.d.A., S.185). Während animistische Naturreligionen bestimmte Eindrücke, wie etwa Blitze, verschiedenen Göttern zuordneten, so besteht der jüdische Gott als einer der ersten auf seine Alleinherrschaft, seine Omnipotenz. So erscheint er nicht als transzendentales Wesen in der Natur, sondern wird zum Schöpfer der Natur selbst. Diese Fortschritte gegenüber Naturreligionen führen dazu, dass die Angst der Gläubigen vor dem Ewigen, Unendlichen, Unbenennbaren und Unvorstellbaren beträchtlich steigt (vgl. Stein 2001, S.82). Der Mensch steht nun nicht mehr vielen Göttern gegenüber, die er durch einfache Magien zeitweise bannen oder besänftigen kann. Es gibt nur noch einen und der herrscht über alles. Zugleich schrumpft aber dadurch auch die Angst vor der Natur, welche „nur“ eine Schöpfung des allmächtigen Gottes ist. Das (religiöse) Individuum erkauft sich die Herrschaft über die Natur durch die Anerkennung der vollständigen Macht des „Geistes“ als grundlegendes Prinzip. Ein weiterer Aspekt ist allerdings beim Judentum zu ergänzen: Durch das Bildverbot Gottes wird die Spannung zwischen der nichtdarstellbaren Idee von Gott und dem Wunsch der Aufklärung alles zu erklären, erhalten. Es wird sozusagen verboten Gott zu erklären. Nur dadurch bleibt er allmächtig.
Im Christentum wird mit diesem Verbot in gewisser Weise gebrochen. Durch die Anbetung von Jesus, der auf der einen Seite als Gott, auf der anderen als Mensch bewundert wird, als seltsame „Doppelfigur“, wird das Ewige, Unendliche, Unbenennbare und Unvorstellbare zu einem gewissen Anteil in die reale Welt gebracht. Daraus folgt für Adorno: „Um soviel wie das Absolute dem Endlichen genähert wird, wird das Endliche verabsolutiert“ (D.d.A., S.186). Hieraus ergibt sich ganz konkret, dass das Christentum, im Gegensatz zum Judentum, die Herrschaft in der Welt als Heilswissen verklärt: „Natur und Übernatur seien in [der Liebe] versöhnt.“ (D.d.A., S.187).
Für Adorno ist dieses christliche Heilswissen jedoch trügerisch. Die Erlösung wird beim Christentum versprochen. So recht kann der Gläubige aber an das Wunder von Jesus Auferstehung – als Beweis seiner Göttlichkeit – jedoch nicht glauben. So folgt aus der Argumentation, dass der spezifische Grund für den christlichen Fortbestand von Judenhass der ist, dass die Christen „sich ihr ewiges Heil am weltlichen Unheil derer bestätigen [müssen], die das trübe Opfer der Vernunft nicht brachten“ (D.d.A., S.188). „Die Anhänger der Vaterreligion werden von denen des Sohnes gehasst als die, die es besser wissen“ (ebd.). Hier klingt auch schon die Nähe Adornos zur Tiefenpsychologie Freuds an, welche in der Auflehnung des Sohnes gegen den Vater den Ödipuskonflikt erkennt, der die Rebellion gegen die väterliche Autorität ausdrückt.
3.3. Psychologische Ebene
Wir befinden uns jetzt sozusagen auf der Mikroebene menschlicher Entwicklung. Im ersten Teil, den zivilisationstheoretischen Grundlagen, wurde versucht zu zeigen, nach was für einem Schema Adorno bei seinen Überlegungen zu menschlicher Entwicklungsgeschichte und -formen vorgeht. Auf der Ebene der gesellschaftlichen Entwicklung haben sich dann Kristallisationen dieser dialektischen Vorgänge im historischen Kontext gezeigt. Nun stellt sich die Frage, was mit und in der gesellschaftlich kleinsten Einheit, dem Individuum, geschieht. Dieses muss daraufhin untersucht werden, wie sich bei ihm der dialektische Widerspruch von der menschlichen Subjektwerdung zeigt und inwiefern es durch die dialektische Gesellschaft geprägt wird und auf sie reagiert. Hierfür wird zunächst auf die Tiefenpsychologie Freuds, danach auf eine weitere der Antisemitismusthesen eingegangen. Zuletzt soll das „autoritäre Syndrom“ und der „manipulative Typus“ beschrieben werden, wie sie in den Studien zum Autoritären Charakter dargestellt sind.
Wie schon erwähnt, lehnt sich Adorno an die Tiefenpsychologie Freuds an und übernimmt zum Teil seine Begriffssysteme. So findet man in den Studien zum Autoritären Charakter Begriffe wie Ich, Es, Über-Ich, Projektion, Verschiebung, Neurose oder Psychose. In dieser Hausarbeit kann nur auf einige von ihnen Bezug genommen werden.
Es soll zunächst die Konstellation von Ich, Es und Über-Ich betrachtet werden . Nach Freud gibt es diese drei Instanzen, die im Individuum vereint sind und verschiedene Funktionen erfüllen. Das Es ist die Quelle aller natürlichen Energien, die im Individuum zu finden sind und als Triebe bezeichnet werden. Sie stehen durch ihre Naturhaftigkeit und durch ihre Unbewusstheit dem durch Rationalität geprägten Verstand gegenüber. Dieser wird durch das Ich repräsentiert. Das Ich ist die Instanz, die vor allem durch das bewusste Denken geprägt ist. Es vermittelt zwischen den Trieben, den Anforderungen der Realität und dem Über-Ich. Im Letzteren sind gesellschaftliche Normen und Werte verinnerlicht, welche durch die Bestrafung und durch Sanktionen des Vaters während der Sozialisationsphase im Elternhaus dem Individuum mit auf den Weg gegeben werden. Wenn das Ich eine Handlung vollzieht, welche den Forderungen des Über-Ichs entgegensteht, kommt es zu Schuldgefühlen. Wenn das Ich eine Handlung unterlässt, welche den Wünschen des Es entspräche, aber zu einem Konflikt mit Normen des Über-Ichs führen würde, kann es zur Unterdrückung von Trieben kommen und etwa Neurosen hervorrufen. Eine Balance zwischen diesen drei Instanzen ist also notwendig um eine seelische Ausgewogenheit auf der einen und das Funktionieren in der Gesellschaft auf der anderen Seite zu garantieren.
Die freudsche Tiefenpsychologie scheint sich auf den ersten Blick gut mit den dialektischen Grundgedanken Adornos verbinden zu lassen. Hier sind nämlich im Individuum selbst zwei sich widersprechende Instanzen angelegt. Das Über-Ich könnte so als die Einheit der Gesellschaftlichkeit und das Es als Einheit der Natur im Individuum angesehen werden. Das Ich muss durch Reflektion diese Widersprüche zu versöhnen suchen.
Ausgangspunkt für die Analyse der weiteren Quellen soll folgende Frage sein: Wie verhält und formt sich ein Individuum, das in einer Gesellschaft lebt, in der bestimmte Forderungen an es - wie etwa Autonomie oder Freiheit - erhoben werden, die aber praktisch nicht erfüllbar sind, weil sie durch eben die gleiche Gesellschaft (3.2), ja sogar durch den grundlegendem Widerspruch von Herrschaft und Freiheit selbst (3.1), verhindert werden?
Eine einleitende These, die Adorno im Kontext der Forschungsergebnisse in den Studien zum Autoritären Charakter aufstellt, ist, dass in einer Gesellschaft Klassen nicht nur die Beziehungen unter den Menschen regeln, sondern auch ihre Psyche formen (vgl. Adorno 1973, S.306f.). Dies gilt in der Gegenwart umso mehr, weil die Massenkultur eine Normung von Einflüssen auf das Individuum vornimmt und bestimmte Typen von Menschen – wie die, die später vorgestellt werden - geradezu „produziert“. Weiterhin stellt Adorno fest, dass die „Objektivierung sozialer Prozesse, die in Wahrheit überindividuellen Gesetzen gehorchen, […] zu einer geistigen Entfremdung des Individuums von der Gesellschaft zu führen [scheint], die vom einzelnen als Desorientierung empfunden wird und die von Furcht und Unsicherheit begleitet ist“ (Adorno 1973, S. 123). Wir haben die „Objektivierung sozialer Prozesse“ schon bei den Ausführungen zu den geprellten Arbeitermassen gesehen, die im „Juden“ das bestimmende Objekt kapitalistischer Ausbeutung wähnen (siehe 3.2.2). Dieselbe Objektivierung führt nach Adorno auch zur Ich-Schwäche. Dieses psychologische Ich ist dadurch gekennzeichnet, dass es in der gesellschaftlichen Realität nicht zu seinem Recht kommt und infolgedessen verkümmert: Dem Individuum wird von der Gesellschaft kein Raum zur Emanzipation von der Gesellschaft gegeben. Die Menschenmassen, welche solche Ich-Schwäche zeigen, neigen dazu für faschistische Propaganda empfänglich zu sein und ihre Wut an gesellschaftlich schwach Gestellten auszulassen. „Die Ich-Schwäche heute, die gar nicht nur psychologisch ist, sondern in der der seelische Mechanismus die reale Ohnmacht des Einzelnen gegenüber der vergesellschafteten Apparatur registriert, wäre einem unerträglichen Maß an narzisstischer Kränkung ausgesetzt, wenn sie nicht, durch Identifikation mit der Macht und Herrlichkeit des Kollektivs, sich einen Ersatz suchen würde“ (GS 10.2, S. 580).
3.3.1. Falsche Projektion
Das Individuum kann Objekte nur „begreifen“ und beurteilen, weil es projiziert. Für Adorno ist dies eine völlig normale Funktion der Wahrnehmung, die zunächst notwendige Voraussetzung für die oben genannten Fähigkeiten ist. Es kann vorweg gesagt werden, dass erst der „Ausfall der Reflexion darin“ (D.d.A., S.199) zu einer solchen falschen Projektion führt, welche mit dem Antisemitismus im engen Zusammenhang steht. Das Individuum hört also auf seine Projektionen zu reflektieren und schlägt einen „verhängnisvollen“ Weg ein. Dieser wird in der sechsten Antisemitismusthese beschrieben.
Um diese verkürzte Erklärung zu erläutern, bedarf es eines kurzen Abrisses über den Mechanismus der Projektion. „Die Projektion von Eindrücken der Sinne ist ein Vermächtnis der tierischen Vorzeit [...] mit der die höheren Tierarten […] reagierten, unabhängig von der Absicht des Objekts“ (D.d.A., S.197). Es ist also eine Funktion der Wahrnehmung, die bestimmte Intentionen oder Motive anderen zuschreibt, ob sie wirklich da sind oder nicht. Triebkraft einer solchen Projektion ist die Angst vor den (möglichen) bedrohenden Absichten anderer.
Nach Adorno „klafft“ so zwischen der inneren Wahrnehmung des Subjekts von einem Objekt und dem „Wesen“ des Objekts selbst „ein Abgrund, den das Subjekt auf eigene Gefahr überbrücken muss“ (D.d.A., S. 198). Er will damit ausdrücken, dass die Wahrnehmung eines Objekts nie mit dem wirklichen Wesen gleichgesetzt werden kann, der Versuch das Objekt zu „begreifen“ aber trotzdem unternommen werden muss, im tierischen Reich im Sinne des Schutzes, im Auftrag der menschlichen Vernunft im Sinne der Erkenntnis über sich selbst und Anderes[15]. Dies geschieht mit Hilfe der bewussten Projektion, einer Projektion also, die sich über ihre eigene Beschränktheit im Klaren ist, sie aber trotzdem ausführt und reflektiert. Adorno stellt nämlich weiterhin fest, dass „in nichts anderem als in der Zartheit und dem Reichtum der äußeren Wahrnehmungswelt […] die innerer Tiefe des Subjekts [besteht]“ (ebd.). Der Reichtum des Außen ist also konstitutiv für den Reichtum des Inneren.
Bei der falschen Projektion hört das Individuum auf zu reflektieren. Es schreibt dem Objekt Eigenschaften zu und setzt diese absolut. „Es verliert die Reflexion nach beiden Richtungen: da es nicht mehr den Gegenstand reflektiert, reflektiert es nicht mehr auf sich und verliert so die Fähigkeit zur Differenz“ (D.d.A., S.199). Nach dieser Aufhebung des Innen und Außen ist für das blinde, projizierende Subjekt keine Grenze mehr vorhanden, es verfällt der „hemmungslosen Projektion“. Dabei verlagert das Subjekt seine inneren Ängste und Widersprüche immer mehr in die Außenwelt. „Wenn Mimesis sich der Umwelt ähnlich macht, so machte falsche Projektion die Umwelt sich ähnlich“ (D.d.A., S.196). Nun kommt die Tiefenpsychologie Freuds ins Spiel. „Unter dem Druck des Über-Ichs projiziert das Ich die vom Es ausgehenden […] Aggressionsgelüste als böse Intentionen in die Außenwelt“ (D.d.A., S.201) Was nun als Ziel erkannt wird, ist wieder „der Jude“. Das Subjekt, von Herrschaft in der Gesellschaft erfasst und unterdrückt, projiziert die eigene Frustration und die eigenen destruktiven Herrschaftstriebe in die Gruppe, die keine „Macht“ hat und trotzdem „glücklich“ ist (vgl. D.d.A., S.209).
3.3.2. Das „autoritäre Syndrom“ und der „manipulative Typus“
Es wird an dieser Stelle auf zwei Charaktertypen eingegangen, welche von Adorno in den Studien zum Autoritären Charakter beschrieben werden. Neben diesen gibt es auch einige andere Syndrome, vorurteilsreiche wie vorurteilslose, auf die allerdings nicht näher eingegangen wird. Das autoritäre Syndrom und der manipulative Typus eignen sich insofern, weil in ihnen mehrer Aspekte sichtbar werden, die sich in gewisser Weise aus den schon genannten Argumentationssträngen, dem zivilisationstheoretischen wie dem gesellschaftstheoretischen, ergeben. In den Studien zum Autoritären Charakter werden die psychologischen Ursachen für diese Charaktertypen in der frühen Kindheit bzw. dem Sozialisationsalter gesucht, welche hier nicht interessieren[16].
Demnach ist die Typisierung selbst eine Funktion in der Gesellschaft – sie formt Subjekte, die nach ihren „Regeln“ funktionieren sollen. Je mehr ein Mensch einem Typus entspricht, desto mehr kann man von einem „integrierten“ Subjekt sprechen. Man sieht hier schon allein durch den Begriff „integriert“ die inhaltliche Verwandtschaft zu Adornos Vorstellung einer integralen Gesellschaft, auf welche weiter oben schon eingegangen wurde.
Zunächst soll das autoritäre Syndrom dargestellt werden. Dieser Typus ist vor allem durch Gefallen an Gehorsam und dem Wunsch nach Unterdrückung anderer gekennzeichnet – durch masochistische Triebe auf der einen und sadistische auf der anderen Seite. Er benutzt den Antisemitismus als Feld um seine Aggressionen auszuleben, die er insgeheim gegen das Über-Ich, also der psychoanalytischen Instanz, die die repressive gesellschaftliche Einheit im Individuum darstellt, hegt. Da das Ich dieses Typus Konflikte mit dem Über-Ich scheut, muss es sie auf sadomasochistische Weise lösen. Dies ist dann also vor allem in einer solchen Gesellschaft möglich, in der es klare Hierarchien und Fremdgruppen gibt, auf die sich der Hass entladen kann. Die Opfer müssen in diesem Fall „akzeptabel“ sein. Sie dürfen nicht Teil der Gesellschaft sein, welche den repressiven Druck auf das Individuum ausübt: „Die Juden“ als Stereotyp sind aufgrund der ihnen zugeschriebenen Fremdartigkeit für die Kanalisierung der Triebenergien geeignet. Für Adorno trifft dieser Typus vor allem auf Menschen zu, deren wirkliche Klassenlage sich von der erstrebten unterscheidet, etwa dem unteren Mittelstand.
Der manipulative Typus zeichnet sich vor allem durch die Unfähigkeit aus Erfahrungen zu machen. Er hat eine „nüchterne Intelligenz“ und emotionale Beziehungen zu anderen fehlen. „Starre Begriffe werden zu Zwecken statt zu Mitteln, und die ganze Welt ist in Leere, schematische, administrative Felder eingeteilt.“ (Adorno 1973, S.334)
Dieses führt zu einer Verdinglichung der Wahrnehmung anderer Menschen. Sie werden als Objekte angesehen, die nach Bedarf manipuliert oder vernichtet werden dürfen. In einem eindringlichen Satz formuliert Adorno, dass dieser Typus eher an der „Konstruktion von Gaskammern“ als am „Pogrom“ interessiert sei (Adorno 1973, S.335). Es zeigt sich also eine sehr technische Betrachtungsweise der Welt. Deshalb wundert es nicht, dass der Manipulative vor allem daran interessiert ist, dass „ etwas getan wird“ (Hervorhebung im Original). Der Antisemitismus hat hier vor allem die Bedeutung „zu funktionieren“. Juden werden zum Opfer, weil ihr angeblicher Individualismus irritiert. Der Manipulative erkennt in ihrem Stereotyp also etwas, das ihm selbst fehlt (vgl. Adorno 1973, ebd.).
Die Entstehung eines solchen Typus begründet Adorno an anderer Stelle durch den Wegfall der Familie als Sozialisationsinstanz, welche durch die anonyme Erziehung der Massenkultur ersetzt wird: „Heute entscheidet in der Erziehung weniger die väterliche Brutalität so wie im Fall Hitlers, sondern eine bestimmte Art von Kälte und Beziehungslosigkeit, die die Kinder in ihrer frühen Kindheit erfahren“ (vgl. GS 20.1, S. 372f.).
Setzt man nun diese beiden Typen in den Kontext der vorhergehenden Ausführungen, so erscheinen zwei Folgerungen möglich: (1) Im autoritären Typus erscheint der falsch projizierte Hass auf die Unterdrückung der eigenen Gesellschaft, (2) im manipulativen Typus existiert das Ich eigentlich gar nicht mehr wirklich, und das integrierte Subjekt führt seine Zerstörungstendenzen gegen alles aus, was ihm nicht gleicht.
Wir finden hier also sowohl den Begriff der Falschen Projektion, wie auch den Hass auf alles, was nicht gleich ist, vor. Wir haben auch das letztere Element schon an verschiedenen Punkten angetroffen[17].
4. Fazit
Adornos Antisemitismusbegriff ist enorm tiefschichtig. Er begnügt sich nicht damit das Phänomen zu beschreiben. Seine Deutung und Verständnis greift auf die Bedeutung der fundamentalen Annahmen der Dialektik der Aufklärung zurück. Diese ziehen sich – nach meinem Verständnis – zumindest implizit, wie ein roter Faden durch alle dargelegten Ebenen. Dabei entstehen Brüche, wie ich sie zum Beispiel zwischen den zivilisations- und gesellschaftstheoretischen Ebenen auf der einen und den empirischen Ergebnisse der psychologischen Ebene auf der anderen Seite meine ausmachen zu können. Die Formung des Individuums durch die Gesellschaft lässt sich nicht empirisch belegen. Deshalb fehlen bei den psychologischen Ergebnissen in den Studien zum Autoritären Charakter die Beweise der gesellschaftlichen Einflüsse. Sie werden in viel schwächerer Form als in der Dialektik der Aufklärung als Annahmen formuliert. Ich denke, dies rührt aus der Inkompatibilität von Adornos (normativer) Gesellschaftstheorie zu empirischen (analytischen) Erhebungen. Seine Theorie lässt sich nicht nachweisen und bleibt ein Gedankenmodell. Dieses ist allerdings in sich sehr schlüssig und liefert sinnvolle Erklärungen. So liegt gerade in den Ausführungen des letzten Teils ein Teil der Spekulation bzw. des logischen Schlusses auf meiner Seite.
Zum Abschluss soll noch einmal der Versuch unternommen werden einen zusammenfassenden „Eindruck“ über den Antisemitismus in Worte zu fassen: Antisemitismus ist das Phänomen, das sich zeigt, wenn Herrschaft blind wird und nach den eigenen Ursachen schlägt – ohne sie jedoch zu treffen. Er ist der Zivilisation nicht entgegengestellt oder zeichnet einen „Rückfall“, sondern ist das schlimmstmögliche Produkt der „kultivierten“, „aufgeklärten“ Welt selbst – der Kommentar der Antisemitismusthesen als „Grenzen der Aufklärung“ weist schon darauf hin. Antisemitismus ist gekennzeichnet durch die Unfähigkeit wahre Erfahrungen zu machen und so mit der Verschiedenheit der Welt zurechtzukommen. Juden verursachen ihn in keiner Form, es trifft sie nur aus „Tradition“ und Zweckmäßigkeit.
„In der Befreiung des Gedankens von der Herrschaft, in der Abschaffung der Gewalt, könnte sich erst die Idee verwirklichen, die bislang unwahr blieb, dass der Jude ein Mensch sei“ (D.d.A., S.209). Antisemitismus und dessen zugrunde liegender Strukturen zu überwinden hieße für eine Gesellschaft demnach, selbst erst wirklich „menschlich“ zu werden.
Es konnte mit dieser Arbeit kein komplettes Bild aller Antisemitismusthesen geliefert werden. So fehlen etwa die Antisemitismusthesen, die sich mit Idiosynkrasie – verkürzt, dem Ekel vor dem eigenen Ursprung, Ticketdenken, der Orientierung an bestehenden ideologischen Systemen, auseinandersetzen. Beide Aspekte hätten noch sinnvolle Ergänzungen, gerade für den zivilisationstheoretischen und gesellschaftlichen Teil, geleistet. Aufgrund des beschränkten Umfangs dieser Hausarbeit musste aber auf sie verzichtet werden.
5.Literaturverzeichnis
Zitierte Literatur:
Theodor W. Adorno & Max Horkheimer, (2003): Dialektik der Aufklärung, Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag.
Theodor W. Adorno (1986): Meinung Wahn Gesellschaft, In: Rolf Tiedemann (Hrsg.), Gesammelte Schriften, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
Theodor W. Adorno (1986): Zur Bekämpfung des Antisemitismus heute, In: Rolf Tiedemann (Hrsg.), Gesammelte Schriften, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
Theodor W. Adorno (1973): Studien zum Autoritären Charakter, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
Eva Stein (2002): Subjektive Vernunft und Antisemitismus bei Horkheimer und Adorno, Oldenburg: BIS – Verlag.
Gesichtete Literatur:
Theodor W. Adorno (2002): Antisemitismus und faschistische Propaganda, In: Ernst Simmel (Hrsg.), Antisemitismus, Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag.
Theodor W. Adorno (1986): Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft?, In: Rolf Tiedemann (Hrsg.), Gesammelte Schriften, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
Thorsten Bonacker (1998): Ohne Angst verschieden sein können. Individualität in der integralen Gesellschaft, In: Müller-Doohm et al. (Hrsg.), Die Gesellschaftstheorie Adornos. Themen und Grundbegriffe, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
[...]
[1] Die ersten drei Antisemitismusthesen wurden von Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und Leo Löwenthal gemeinsam verfasst, die weiteren von Adorno und Horkheimer.
[2] Den Begriff der Zivilisationstheorie stammt nicht von Adorno. Durch sie soll hier eine „Urgeschichte“ der Gesellschaft umrissen werden.
[3] Der Begriff Jude wird hier einmal mit und einmal ohne Anführungszeichen („“) verwendet. Im ersten Fall ist das Konstrukt „Jude“ gemeint, welches rassenideologisch oder sonst wie begründet wird und sich dadurch auszeichnet, dass die Gekennzeichneten Ziele von Vorurteilen und von Hassentladungen werden. Ohne Anführungszeichen ist die objektiv bestehende Gruppe von Juden gemeint – so unterschiedlich sie sein mögen – die Menschen, die sich so identifizieren bzw. durch relativ einheitliche (religiöse) Traditionen, etc. in der Wissenschaft so bezeichnet werden können.
[4] Es wären hier auch andere gegensätzlich Begriffspaare, wie Mensch – Natur, etc., als Synonyme möglich.
[5] Adorno und Horkheimer setzen das aufgeklärte Zeitalter nicht erst bei der Entstehung des bürgerlichen, aufgeklärten Geists des 18./19. Jahrhunderts an, sondern schon viel früher, beim platonischen „Logos“, erkennen sie ihren Ursprung.
[6] Adorno unterscheidet in der Dialektik der Aufklärung verschiedenen Formen der Mimesis. Als Synonym soll „Nachahmung“ hier ausreichen.
[7] In einem Interview in den Studien zum Autoritären Charakter wird z.B. von einem Probanden darauf verwiesen, dass Religion nur die Funktion haben soll ein ausgewogene Leben (nicht zu viel zu essen, zu trinken, etc.) zu führen.
[8] Die Schrift von Max Horkheimer, aus der der Begriff stammt, heißt „Zur Kritik der instrumentellen Vernunft“ und wurde 1944 publiziert.
[9] Es wird hier auf den Einleitungsvortrag zum 16. Deutschen Soziologentag mit dem Titel „Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft?“ verwiesen (vgl. GS 8, S. 354).
[10] Zum Problem der integralen Gesellschaft siehe auch: Thorsten Bonacker (1998): Ohne Angst verschieden sein können. Individualität in der integralen Gesellschaft, In: Müller-Doohm et al. (Hrsg.), Die Gesellschaftstheorie Adornos. Themen und Grundbegriffe, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
[11] Der Unterschied zwischen angepassten und assimilierten Juden wird hier wie folgt gesehen: Angepasste Juden folgen den Zielen der bürgerlichen Emanzipation, wollen aber an ihrer Religiosität festhalten. Assimilierte Juden sind dagegen in der Bürgerschaft aufgegangen und können nur noch aufgrund ihrer Herkunft als solche bezeichnet werden.
[12] Die Charakterisierung der Beziehung zwischen Juden und Christen als „Problem“, muss selbst problematisiert werden. Die Unterstellung, dass es ein Problem gibt, welches zwischen den beiden Gruppen herrscht, zeigt selbst schon latent antisemitische Züge. Durch den Begriff wird der Anschein von rationaler Betrachtung der Beziehungen zwischen Juden und Christen erzeugt; er sagt aber implizit aus, dass „die Juden“ das Problem seien.
[13] Das einige dort erfolgreich waren, ist dabei allerdings nicht primär in Anbetracht allgemeiner „jüdischer Fähigkeiten“ sondern vielmehr in Hinblick auf die Repressionen unter denen sie zu leiden hatten, zu bewerten. So blieb z.B. der „Schutzjude“ abhängig vom Fürsten (vgl. D.d.A., S.184).
In den Elementen des Antisemitismus taucht weiterhin der Begriff der Kolonisatoren auf, mit dem die Bedeutung der jüdischen Händler bei der Verbreitung von kapitalistischen Handelsstrukturen hervorgehoben wird. Im Falle des Schutzjuden fällt so „der Jude“ als vermeintlich Bevorzugter, im Falle des Kolonisators als Ausbeuter des kleinen Mannes auf.
[14] Zum Thema Nationalsozialismus als politische Religion siehe auch: Eric Voegelin (1939): Die politischen Religionen, Stockholm, ND 1993, 1996.
[15] Projektion ist notwendig, damit das Subjekt überhaupt erst Subjekt werden kann. An dieser Stelle wird noch einmal auf den Abschnitt der zivilisationstheoretischen Grundlagen (3.1.) verwiesen, in welchen die Trennung von Subjekt und Objekt als konstitutiv für jede menschliche Geschichte festgestellt wird.
[16] Insofern ist nochmals deutlich darauf hinzuweisen, dass diese Charaktertypen in den Studien zum Autoritären Charakter nicht in den argumentativen Kontext gestellt werden, wie die folgenden Ausführungen nahe legen könnten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Antisemitismusbegriff bei Adorno?
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Antisemitismusbegriff bei Theodor W. Adorno, hauptsächlich gestützt auf die "Elemente des Antisemitismus" aus der "Dialektik der Aufklärung" und Teile des Forschungsberichts "Studien zum Autoritären Charakter". Adorno entwickelte keine geschlossene Analyse, sondern beleuchtete verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit den Thesen der Dialektik der Aufklärung.
Welche Quellen werden für die Analyse von Adornos Antisemitismusbegriff verwendet?
Die Analyse stützt sich hauptsächlich auf die "Elemente des Antisemitismus" aus der "Dialektik der Aufklärung" (1947) und Teile des Forschungsberichts "Studien zum Autoritären Charakter" (1949-50). Das zentrale Werk "Dialektik der Aufklärung" dient als Grundlage für Einordnung und Interpretation.
Was ist der funktionale Charakter des Antisemitismus nach Adorno?
Antisemitismus wird als irrationaler Hass auf "die Juden" verstanden, der unabhängig von einem realen Objekt existiert. Er wird als strukturell begründet angesehen und erfüllt im gesellschaftlichen und psychologischen Kontext funktionale Zwecke, d.h., er macht "Sinn" im gesellschaftlichen und psychologischen Haushalt, auch wenn nicht rational begründet.
Was sind die zivilisationstheoretischen Grundlagen des Antisemitismus nach Adorno?
Der Ausgangspunkt ist die Trennung von Subjekt und Objekt. Die Entwicklung des Bewusstseins erfordert die Ausübung von Herrschaft über die Natur, welche in einem dialektischen Prozess zu blinder Naturherrschaft übergeht. Dies hat pathologische Folgen für die Gesellschaft und das Individuum.
Wie äußert sich Antisemitismus auf gesellschaftlicher Ebene nach Adorno?
Im Kapitalismus wird Herrschaft durch die Vermittlung des Marktes vervielfacht, was zu einer Entfremdung des Individuums von der Gesellschaft führt. Im Faschismus kulminiert die Entwicklung der Aufklärung in einem Rückfall in die Barbarei, wo der Vernichtungswille aus der falschen Gesellschaftsordnung resultiert.
Welche Rolle spielt die Staatsform beim Antisemitismus nach Adorno?
Im bürgerlichen Liberalismus wird die Existenz nicht assimilierter Juden als Verleumdung der verwirklichten Einheit der Menschen gesehen. Im Faschismus wird "der Jude" als Gegenrasse geschaffen, was zur physischen Vernichtung führt, da Assimilation keine Option darstellt.
Welche sozial-ökonomischen Gründe für Antisemitismus werden von Adorno genannt?
Antisemitismus dient als Ausdruck der Wut der um ihren gerechten Anteil gebrachten Massen, die nicht das kapitalistische System selbst, sondern die Vertreter des Kapitals auf dem Markt (z.B. jüdische Händler) als Verantwortliche sehen. Er dient auch als Ablassventil für Frustration und zur Ablenkung von der eigenen Herrschaft durch die Kapitalisten.
Wie erklärt Adorno die religiöse Dimension des Antisemitismus?
Obwohl die Bedeutung der christlichen Religion abgenommen hat, wirkt der religiöse Antisemitismus in transformierter Form fort. Das Christentum verklärt die Herrschaft in der Welt als Heilswissen, aber der Hass auf "die Juden" dient als Bestätigung des eigenen Heils am weltlichen Unheil derer, die das "trübe Opfer der Vernunft" nicht brachten.
Wie wird die psychologische Ebene des Antisemitismus bei Adorno betrachtet?
Adorno lehnt sich an die Tiefenpsychologie Freuds an und betont die Bedeutung der Klassen für die Formung der Psyche. Die Objektivierung sozialer Prozesse führt zur Ich-Schwäche und Empfänglichkeit für faschistische Propaganda. Die Menschen suchen einen Ersatz für die narzisstische Kränkung durch Identifikation mit der Macht des Kollektivs.
Was ist falsche Projektion und welche Rolle spielt sie im Antisemitismus?
Falsche Projektion ist das Zuschreiben absoluter Eigenschaften an ein Objekt ohne Reflexion, wodurch das Individuum die Fähigkeit zur Differenz verliert. Es verlagert seine inneren Ängste und Widersprüche in die Außenwelt und projiziert Aggressionsgelüste auf "den Juden".
Was sind das "autoritäre Syndrom" und der "manipulative Typus" nach Adorno?
Das autoritäre Syndrom ist durch Gehorsam und Unterdrückung gekennzeichnet, wobei Antisemitismus als Feld dient, um Aggressionen auszubelben. Der manipulative Typus zeichnet sich durch die Unfähigkeit aus, Erfahrungen zu machen, und sieht Menschen als Objekte, die manipuliert oder vernichtet werden dürfen. Antisemitismus dient hier dazu, dass "etwas getan wird", und Juden werden zum Opfer, weil ihr vermeintlicher Individualismus irritiert.
- Arbeit zitieren
- Michael Höttemann (Autor:in), 2004, Antisemitismus bei Adorno, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108790