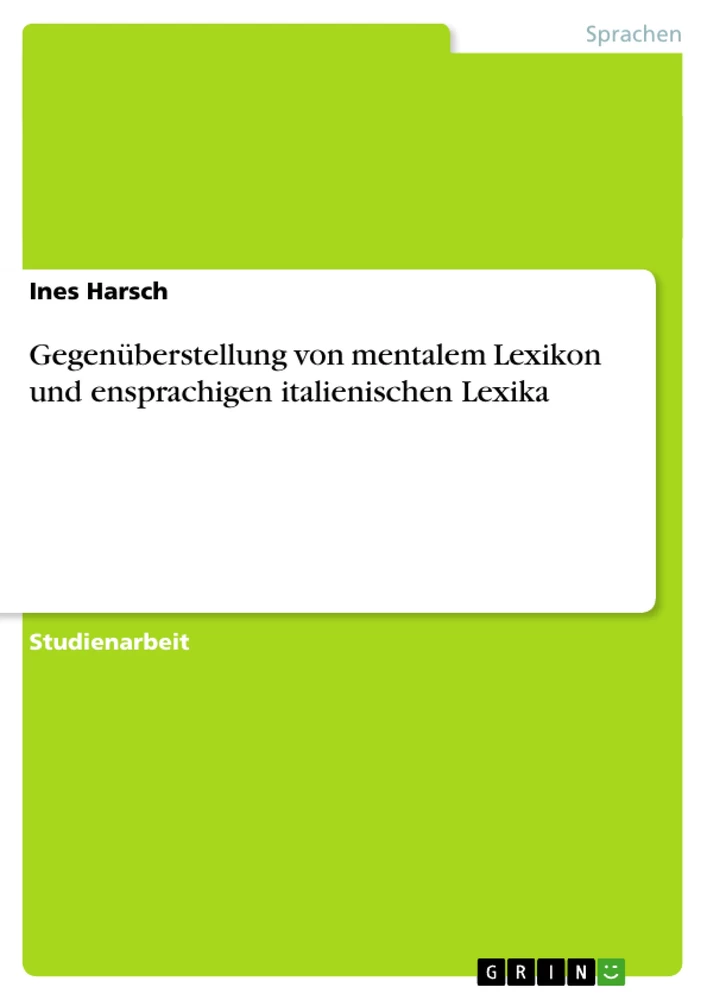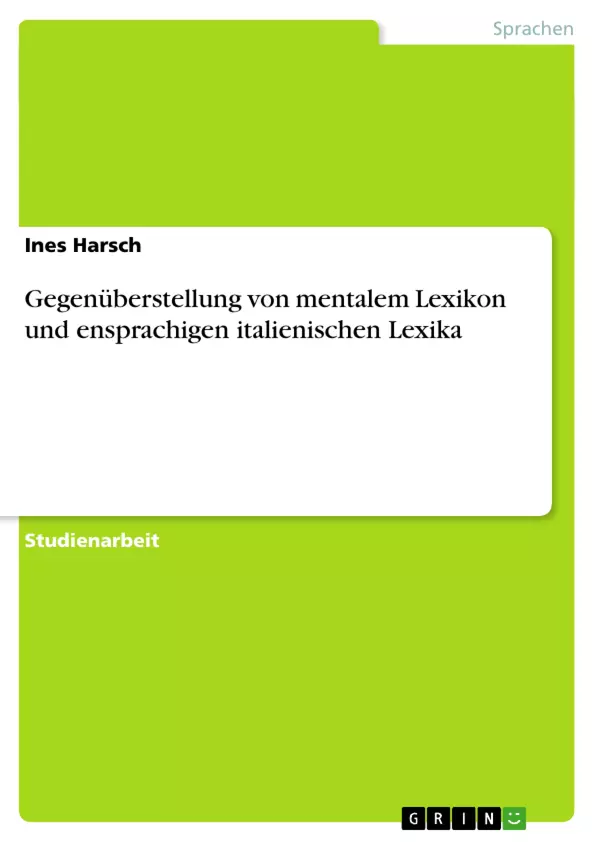Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Das mentale Lexikon
2.1 Definition des mentalen Lexikons
2.2 Verschiedene Modelle des mentalen Lexikons
2.3 Beziehungen innerhalb des mentalen Lexikons
2.3.1 Zusammenhänge auf der paradigmatischen Ebene
2.3.2 Zusammenhänge auf der semantischen Ebene
2.4 Wortformrepräsentationen im mentalen Lexikons
2.5 In welcher Form werden Wörter gespeichert?
3 Das Wörterbuch
3.1 Die Form des Wörterbuchs
3.2 Der Wörterbucheintrag
3.3 Eventuell auftretende Probleme
3.4 Vermittelte Information
4 Praktische Untersuchung anhand der Wörterbücher
„Zingarelli“ und „Sabatini Coletti“
4.1 imparare
4.2 riferire
4.3 fare
5 Unterschiede und Gemeinsamkeiten mentales Lexikon-Lexikon
6 Schluss
7 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
„Mentales Lexikon“ und „Lexikon“ - wenn man diese beiden Begriffe hört, könnte man denken, dass es sich bei dem „mentalen Lexikon“ um ein „mentalisiertes“, vorher in Schriftform vorliegendes Lexikon handelt. Dass dies jedoch nicht der Fall ist wird sehr schnell klar, wenn man sich bewusst macht, dass unter dem mentalen Lexikon die komplette Speicherung aller Wörter im Kopf eines bestimmten Sprechers verstanden wird. Da ein einzelner Sprecher niemals all die Informationen in seinem Kopf speichern kann, die in einem Wörterbuch gegeben werden, andererseits ein Wörterbuch auch nicht all die Informationen bieten kann, die einem Sprecher zu einem bestimmten Wort zur Verfügung stehen, ist es interessant zu schauen, inwieweit sich die beiden „Speicherungsformen“ entsprechen, bzw. welche Unterschiede es gibt.
Deshalb will ich in der vorliegenden Arbeit die Organisation und Inhalt betreffenden Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen dem mentalem Lexikon und einem einsprachigen italienischen Lexikon herausarbeiten. Als Vertreter für die Lexika habe ich die einsprachigen Werke „Zingarelli“ und „Sabatini Coletti“ gewählt, die beide ungefähr 30 000 Einträge zu verzeichnen haben. Zunächst werde ich den Aufbau des mentalen Lexikons und eines Lexikons in Schriftform skizzieren, danach einige ausgewählte Wörterbucheinträge untersuchen und zum Schluss auf die bemerkten Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten eingehen. Da ich mich bei meinen Untersuchungen nur auf Verben beschränkt habe, besitzen die von mir beobachteten Phänomene nur im Bezug auf Verben Gültigkeit, bei Substantiven und anderen Wortarten können eventuell ganz unterschiedliche Ergebnisse zustande kommen.
2.1 Definition des mentalen Lexikons
Die Geschwindigkeit beim Abruf von Wörtern aus dem mentalen Lexikon vollzieht sich bei Muttersprachlern mit einer Geschwindigkeit von ca. 200 Millisekunden, was nur durch
„Voraktivierungen“1 bestimmter Netzstrukturen möglich ist. Das heißt, das Wort ist an
einem bestimmen Platz gespeichert, und bei Erwähnung des Themas oder des Kontextes wird dieser Bereich des Gehirns aktiviert und die Information an die Oberfläche befördert. Unter dem mentalen Lexikon versteht man allgemein die aktive Speicherung der lexikalischen Einheiten2 im Kopf, genauer gesagt, im Langzeitgedächtnis. Der Begriff
„lexikalische Einheiten“ anstelle von „Wörtern“ soll verdeutlichen, dass hier nicht nur von Lexemen als Speichereinheiten ausgegangen werden soll, sondern auch von Affixen und Flexiven. Jeder erwachsene Mensch hat ca.30 000-50 000 aktive Wörter ( plus Affixe und Flexive) in seinem Kopf gespeichert und kann auf einen unendlich größeren passiven Wortschatz zurückgreifen. Das mentale Lexikon bezeichnet jedoch nicht nur die Speicherung der reinen Wortform, sondern es enthält auch phonologische, artikulatorische, morphologische und syntaktische Informationen über ein Wort.
2.2 Verschiedene Modelle des mentalen Lexikons
Grundsätzlich werden zwei Typen von Lexikonmodellen im Kopf unterschieden. Zum einen gibt es das sogenannte „modulare Stufenmodell“ (z.B. nach Levelt), zum anderen das „interaktive Netzwerkmodell“ (z.B. Dell oder Kielhöfer).
Im modularen Modell wird zwischen Worterkennung und – produktion einerseits und der Repräsentation in semantischen und phonologischen Sublexika andererseits unterschieden. Das heißt, die Worterkennung läuft in verschiedenen Zeitstufen ab.
Die Netzwerkmodelle hingegen unterscheiden nicht zwischen Speicherung und Verarbeitung, hier findet die Speicherung in den verarbeitenden Netzen statt und Verarbeitung ist nur die Aktivierung bestimmter Teile des Netzwerks. Beide Modelle hingegen tendieren (aufgrund von Worterkennungsexperimenten) zu der Annahme, dass die lautliche Seite eines Wortes getrennt von seiner Bedeutungsseite gespeichert wird.
Die Ordnung im mentalen Lexikon entsteht durch gewisse Beziehungen die die Wörter auf verschiedenen Ebenen zueinander haben, wobei jedes einzelne Wort zu vielen verschiedenen Klassen gehören kann. Die verschiedenen Modelle gehen hier von unterschiedlichen Annahmen der lexikalischen Repräsentation aus. So sieht Levelt die Knoten im Netzwerk als semantisch spezifizierte Lemmata und Garrett definiert sie als
„Worteinheiten deren Bedeutung sich aus den Relationen zwischen den unanalysiert gespeicherten Einheiten ergeben.“3 Nach Kielhöfer muss man sich die Speicherung der Wörter in einer Art Netzform vorstellen, die er folgendermaßen definiert: „Alle Wörter sind untereinander mehrfach verknüpft, wobei die Worte die Knoten des Netzes bilden und jedes Wort wiederum zu verschiedenen Teilnetzen gehört. Aufgrund der Polysemie ist die Position der Wörter in diesem Netz nicht festgelegt, sondern kann immer wieder wechseln.“4
2.3 Beziehungen innerhalb des mentalen Lexikons
Ich werde jetzt am Beispiel Kielhöfers diese Beziehungen etwas näher untersuchen:5 Er unterscheidet dabei folgende 7 Klassen:
1) Zusammenhang auf der paradigmatischen Ebene:
- Begriffsfelder die sich am Konzept orientieren ( casa, villa, appartamento)
- Wortfelder (paradigmatische Ordnung anhand sprachspezifischer Bedeutungsmerkmale: appartamento und edificio nur teilweise gleich)
2) Zusammenhang auf der semantischen Ebene:
-Sachfelderbeziehung zwischen den Sachen auf die die Wörter referieren (esame, professore, studente) wobei dies vor allem bei konkreten Wörtern vorkommt.
-Wortfamilien (studente, studiare, studioso) durch Ableitung und Komposition.
-Klangfelder ( ähnliche Wortlänge, Phonemstruktur, Silbigkeit...) was aber eher selten vorkommt.
-sogenannte affektive Felder: diese Ausprägung nach Kielhöfer ( z.B. étudiant und gauchiste im Frankreich der 60’er Jahre) ist jedoch ziemlich selten.
3) Zusammenhang auf der syntagmatischen Ebene:
- Wörter die typischerweise nacheinander kommen (cane und abbaiare)
2.3.1 Zusammenhänge auf der paradigmatischen Ebene Die Prototypentheorie
In letzter Zeit hat vor allem für die Speicherung von Substantiven die sogenannte
„Prototypentheorie“ sehr an Bedeutung gewonnen. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Mensch bei jeder Begegnung mit einem „realen“ Ding Verbindungen zwischen den wahrgenommenen und assoziierten Merkmalen herstellt und sich auf diese Weise mentale Kategorien bilden, die dann später auf neue „Vertreter“ dieser Gattung angewendet werden. Da diese Prototypen jedoch individuell und kulturell sehr verschieden sind, ist es eher angebracht von einem „Prototypeneffekt“6 zu sprechen. Diese Auffassung sagt aus, dass die Prototypen im Kopf, die eine Mischung aus Beobachtungen, kulturellen Werten, Erinnerung und Phantasie sind, nicht unbedingt der Realität entsprechen und dazu dienen, sich mithilfe von unbewussten mentalen Modellen in der Vielfalt der realen Welt zurechtzufinden. Viele Substantive werden mental also unter einem bestimmten
„Prototypen“ gespeichert, wobei der Prototyp selbst heterogener Natur, und die Prototypentheorie prototypischer Struktur ist.
[...]
1 Kielhöfer, B., Wörter lernen, behalten und erinnern; Neusprachliche Mitteilungen,1994, S.211-220.Zitiert nach: http://ella.phil.uni-freiburg.de/RomSeminar/Deztscher/Zula/HTML/node5.html
2Meibauer, Rothweiler(1999:10)
3Meibauer, Rothweiler (1999:11)
4 Kielhöfer,B., Wörter lernen, behalten und erinnern; Neusprachliche Mitteilungen,1994, S.211-220. Zitiert nach: http://ella.phil.uni-freiburg.de/RomSeminar/Deztscher/Zula/HTML/node5.html
5 ebenda
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen dem mentalen Lexikon und einem traditionellen Lexikon laut diesem Text?
Der Text erklärt, dass das mentale Lexikon die komplette Speicherung aller Wörter im Kopf eines Sprechers ist, während ein traditionelles Lexikon (wie "Zingarelli" oder "Sabatini Coletti") ein schriftliches Werk ist. Ein Sprecher kann niemals alle Informationen eines Lexikons speichern, und ein Lexikon bietet nicht alle Informationen, die ein Sprecher über ein Wort hat.
Welche Lexika werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit untersucht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen dem mentalen Lexikon und den einsprachigen italienischen Lexika "Zingarelli" und "Sabatini Coletti".
Was versteht man unter dem Begriff "mentales Lexikon"?
Unter dem mentalen Lexikon versteht man die aktive Speicherung der lexikalischen Einheiten (Wörter, Affixe, Flexive) im Langzeitgedächtnis eines Menschen. Es enthält nicht nur die Wortform, sondern auch phonologische, artikulatorische, morphologische und syntaktische Informationen.
Welche Modelle des mentalen Lexikons werden unterschieden?
Es werden zwei Typen von Lexikonmodellen unterschieden: das modulare Stufenmodell (z.B. nach Levelt) und das interaktive Netzwerkmodell (z.B. Dell oder Kielhöfer).
Wie sind Wörter im mentalen Lexikon geordnet?
Die Ordnung entsteht durch Beziehungen der Wörter auf verschiedenen Ebenen. Kielhöfer unterscheidet 7 Klassen, z.B. Zusammenhang auf der paradigmatischen Ebene (Begriffsfelder, Wortfelder), semantischen Ebene (Sachfelderbeziehungen, Wortfamilien, Klangfelder, affektive Felder) und syntagmatischen Ebene (Wörter die typischerweise nacheinander kommen).
Was ist die Prototypentheorie und wie hängt sie mit dem mentalen Lexikon zusammen?
Die Prototypentheorie besagt, dass der Mensch bei Begegnungen mit Dingen Verbindungen zwischen Merkmalen herstellt und mentale Kategorien bildet. Viele Substantive werden mental also unter einem bestimmten „Prototypen“ gespeichert.
Auf welche Wortarten bezieht sich die Untersuchung hauptsächlich?
Die Untersuchung beschränkt sich hauptsächlich auf Verben. Die beobachteten Phänomene gelten möglicherweise nicht für Substantive oder andere Wortarten.
- Quote paper
- Ines Harsch (Author), 2003, Gegenüberstellung von mentalem Lexikon und ensprachigen italienischen Lexika, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108862