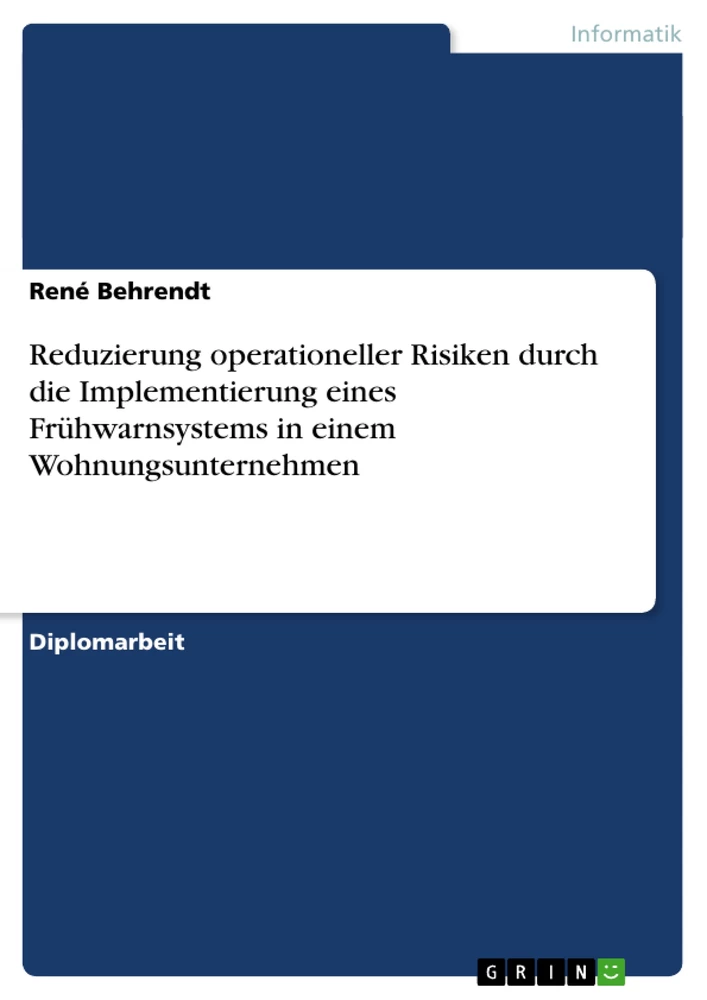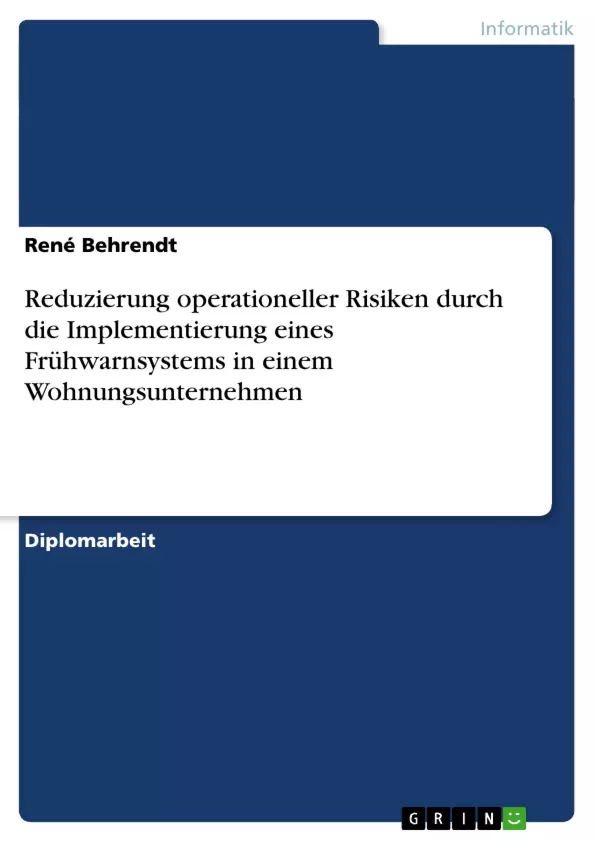Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Grundlagen
2.1 Was ist Risiko?
2.2 Risikoarten
2.3 Risikokategorien
2.4 Operationelles Risiko
3 Risikopolitik
4 Risikomanagement
4.1 Strategie
4.2 Risikobetrachtung und -beurteilung
4.2.1 Risikoidentifikation
4.2.2 Risikomessung und -bewertung
4.2.3 Risikolimitierung
4.3 Risikosteuerung
4.4 Dokumentation
5 Systematisches Risikomanagement
5.1 Elemente des Risikomanagements
5.2 Frühwarnsystem
6 Risikomanagement in der Wohnungswirtschaft
6.1 Wirtschaftliche Determinanten
6.2 Rechtliche Determinanten
7 Implementierung des Frühwarnsystems in der Praxis
7.1 Beschreibung des Wohnungsunternehmens
7.1.1 Risikopolitik
7.1.2 Organisation
7.1.3 Geschäfts- und Tätigkeitsfelder
7.1.4 Risikoanalyse und Risikolimitierung
7.1.5 Ermittlung der Interdependenzen
7.1.6 Frühwarnung
7.2 Dokumentation
8 Abschlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Ehrenwörtliche Erklärung
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Systematik für Entscheidungen unter Berücksichtigung vorliegender Informationen
Abb. 2: Risikokategorien
Abb. 3: Risikomanagementprozess
Abb. 4: Szenarioanalyse
Abb. 5: Funktionale Einteilung der Dokumentation im Risikomanagement
Abb. 6: Komponenten des Risikomanagementsystems
Abb. 7: Geschäfts- und Tätigkeitsfelder in der kaufmännischen HBW eines Wohnungsunternehmens
Abb. 8: Risikoinventar
Abb. 9: Grafische zweidimensionale Darstellung von Interdependenzen bei Risiken
Abb. 10: Grafische dreidimensionale Darstellung von Interdependenzen bei Risiken
Abb. 11: Benchmark über Miet- und Leerstandsentwicklung
1 Einleitung
Die aus Investorensicht dramatische Lage auf dem Wohnungsmarkt und die daraus resultierende wirtschaftliche Situation der Wohnungsunternehmen (WU) macht den Einsatz eines Risikomanagementsystems unabdingbar. Ein systematisiertes Risikomanagement wird neben einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung und der Einführung von „BaselII“, auch vor dem Hintergrund aktueller Gesetzgebungen, wie das KontraG, HGrG, GmbHG, AktG, TransPuG und anderen, auf die zum Teil später im Text noch näher eingegangen wird, zwingend notwendig. Daraus resultierend wird nunmehr auch zunehmend von Prüfungsgesellschaften dieser Branche eine Systematisierung gefordert, da diese gem. §317Abs.2HGB zu prüfen haben, ob die Risiken der künftigen Entwicklung im Lagebericht zutreffend dargestellt sind.
Literatur ist zum RMS in der Wohnungswirtschaft kaum zu finden. Neben einer umfangreicheren Publikation vom Gesamtverband der Wohnungswirtschaft[1] gibt es kleinere Veröffentlichungen von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften[2] und Regionalverbänden.
Diese Arbeit soll an einem praxisnahen Beispiel aufzeigen, dass man mit einer strukturierten Vorgehensweise solch ein System stufenweise mit einem finanziell überschaubaren Aufwand relativ einfach implementieren kann. Hierfür nutzt der Verfasser die Möglichkeit, bei einem Wohnungsunternehmen ein Frühwarnsystem als Element des RMS zu implementieren. Es soll dem Leser verdeutlicht werden, dass dieses System nicht nur in der Führungsebene, sondern von allen Mitarbeitern akzeptiert und weiterentwickelt werden muss. Nur so kann das RMS nachhaltig funktionieren.
In den ersten Abschnitten werden allgemeine Grundbegriffe von Risiko über Risikomanagement bis hin zu einem Risikomanagementsystem erläutert. Danach wird anhand des Bereiches Hausbewirtschaftung(HBW) des Wohnungsunternehmens aufgezeigt, wie vorhandene Risiken identifiziert, gemessen, bewertet, gesteuert und mit Hilfe des Frühwarnsystems überwacht werden können.
2 Grundlagen
2.1 Was ist Risiko?
Risiko wird aus dem frühitalienischen „riscare“ abgeleitet und bedeutet substantiviert Wagnis.[3] Der Begriff Risiko unterliegt den verschiedensten Definitionen. Eine unbedingt zu betrachtende Definition ist die aus der Entscheidungstheorie, die Risiko als Unsicherheitsgrad, bei dem für das Eintreten zukünftiger Ereignisse objektive Wahrscheinlichkeiten vorliegen, definiert.[4] Hierbei wird Risiko nicht nur als Gefahr, sondern auch als Möglichkeit gesehen. Denn nur, wer bereit ist die Gefahr einzugehen, eventuell Verluste hinnehmen zu müssen, hat auch die Möglichkeit, Gewinne zu erzielen.[5] Der Entscheidungsprozess ist ein informationsverarbeitender Prozess, an dessen Ende die Auswahl einer Möglichkeit des Verhaltens in einer Situation steht.[6] Die Entscheidungstheorie besagt, dass aufgrund von Informationsmangel, wie in Abb. 1 dargestellt, im Gegensatz zu Entscheidungen unter Sicherheit, wo vorhergesagt werden kann, welche Umweltsituation eintritt, nur eine Entscheidung unter Risiko getroffen wird. Die Menge der Umweltbedingungen, denen auch eine Eintrittswahrscheinlichkeit zugeordnet werden kann, ist hierbei bekannt. Können bei bekannter Anzahl der Umweltzustände keine Wahrscheinlichkeiten zugeordnet werden, so wird eine Entscheidung nur unter Unsicherheit getroffen.[7]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Systematik für Entscheidungen unter Berücksichtigung vorliegender Informationen,
Quelle: Jung 1999, S. 123
In der Literatur wird weiterhin neben dem sogenannten reinen und dem spekulativen Risiko unterschieden. Das reine Risiko beinhaltet Schadensgefahren, bei denen ein vermögensminderndes Ereignis eintritt. Das spekulative Risiko umfasst hierbei noch unsichere Ereignisse, die sich positiv oder negativ auf den Unternehmenserfolg auswirken können. Hierauf stützen sich die nachfolgenden Ausführungen.
2.2 Risikoarten
Risiko kann in zwei Arten unterschieden werden. Zum einen gibt es das direkte Risiko, das unmittelbar durch das Eintreten eines Ereignisses entsteht, und zum anderen das indirekte Risiko, das mittelbar mit dem Eintreten eines Ereignisses einhergeht.[8]
2.3 Risikokategorien
Die nachfolgende Abbildung 2 soll nur einen groben Überblick über die kategorische Unterteilung der internen Risiken, die aus dem Unternehmen hervorgehen, und der externen Risiken, welche primär aus Umweltveränderungen resultieren, geben.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Übersicht der Risikokategorien[9]
Auf die einzelnen Kategorien wird hier nicht näher eingegangen. Die für die Frühwarnung im operativen Bereich relevanten Geschäftsrisiken werden in dieser Arbeit noch genauer betrachtet. Wichtig ist der Hinweis, dass zwischen diesen drei Kategorien Wechselbeziehungen bestehen, wobei die Wirkung hauptsächlich hierarchisch von den Kategorien I und II auf die Kategorie III ausstrahlt.[10]
2.4 Operationelles Risiko
Unter operationellem Risiko werden direkte oder indirekte wertmindernde und werterhöhende Ereignisse, die aufgrund interner Verfahren und Systeme sowie externer Ereignisse eingetreten sind, verstanden.[11]
3 Risikopolitik
Die Aufgabe der Risikopolitik im Unternehmen besteht in der Absicherung der sozialen, finanziellen und leistungswirtschaftlichen Unternehmensziele. Im Vordergrund steht, die Existenz und den Unternehmenserfolgs zu sichern. Ziel einer systematischen Risikopolitik muss es sein, unternehmerische Grundsätze zu den Fragen der Risikobereitschaft sowie der Harmonie zwischen dem Sicherheitsgrad und den Unternehmenszielen zu dokumentieren.[12]
4 Risikomanagement
Risikomanagement beschreibt den allgemeinen Umgang mit Risiken als Führungsaufgabe. Im Vordergrund steht die Zusammenfassung von Maßnahmen und Regelungen, um unternehmensrelevante Risiken identifizieren, analysieren, messen und bewerten sowie steuern zu können.[13] Risikomanagement versteht sich als kontinuierlicher Prozess (Vgl. Abb. 3).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Risikomanagementprozess
Erst durch die kontinuierliche Kontrolle, Anpassung und Weiterentwicklung wird Risikomanagement zum Prozess und gewährleistet, dass dieses im Unternehmen auf Dauer Bestand hat. Jeder Mitarbeiter ist in der persönlichen Pflicht, aktiv am Risikomanagement mitzuwirken und somit durch geeignete Maßnahmen, Schäden vom Unternehmen abzuwenden und auf sich bietende Möglichkeiten hinzuweisen.
4.1 Strategie
Grundlage eines professionellen Risikomanagements ist die Präzisierung der Risikostrategie im Unternehmen. Hierbei wird das Verhältnis der nutzbaren Möglichkeiten zu den einzugehenden Gefahren festgelegt. Danach sind die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sowie Regelungen zur Dokumentation und Berichterstattung zu treffen.[14]
4.2 Risikobetrachtung und -beurteilung
Bei der Risikobetrachtung und -beurteilung sollten die Risiken zuerst analysiert werden. Hierzu bedarf es einer genauen Identifikation der Risiken. Diese werden im Risikoinventar festgehalten, um im Nachgang mit geeigneten Instrumenten gemessen und bewertet werden zu können. Hierbei sollten bereits eventuelle Interdependenzen zu anderen Risiken ermittelt werden. Dann werden die positiven und negativen Ausprägungen des Risikos mit geeigneten Größen unter Einbeziehung der Eintrittswahrscheinlichkeit gemessen. Mit Hilfe von festgelegten Schwellenwerten können die Risiken dann betrachtet und beurteilt werden. Alle Erkenntnisse der Risikoanalyse und -beurteilung fließen in das Risikoinventar ein. Sollten sich hierbei negative Ausprägungen in Bezug auf die Erreichung der Unternehmensziele aufzeigen, sind die Risiken zu limitieren oder zielorientiert zu steuern.
4.2.1 Risikoidentifikation
Die Risikoidentifikation stellt die Grundlage im Risikomanagementprozess dar.Alle Risiken sollten präzise, nach Risikobereichen gegliedert, entdeckt und inventarisiert werden. In der Praxis werden hierzu strukturierte, nach den einzelnen Risikobereichen gegliederte Fragebögen verwendet. Somit wird ein geordneter Überblick über die identifizierten Einzelrisiken erreicht. Des Weiteren werden hierdurch auch die Auswertungen erleichtert.[15] Man sollte sich bei der Aufnahme der Risiken unbedingt an der eigenen Definition des Risikobegriffs orientieren, da ansonsten, am Beispiel der Entscheidungstheorie, die Gefahr besteht, dass zum einen der Unsicherheitsgrad und zum anderen ein unsicheres Ereignis gemessen und bewertet wird. Dies hat eine uneinheitliche Risikobetrachtung und Risikobeurteilung zur Folge.
[...]
[1] siehe hierzu GdW (2000)
[2] siehe hierzu Deloitte & Touche/Deutsche Baurevision (2002)
[3] Vgl. Bernstein (2002), S. 18
[4] Vgl. Sellien/Sellien (1988), S. 1278
[5] Vgl. Nottmeyer (2002), S.27
[6] Vgl. Peters/Brühl/Stelling (2000), S.23
[7] Vgl. Jung (1999), S. 123
[8] Vgl. Keitsch (2000), S. 20
[9] In Anlehnung an Keitsch, D.: Risikomanagement, 2000, S. 11
[10] Vgl. Keitsch (2000) S. 12
[11] Vgl. SAP Deutschland AG & Co. KG (2002), S. 58
[12] Vgl. RiskNet: Online im Internet (23.05.2003), URL: http://www.risknet.de/Risk_Management/Risikopolitik/risikopolitik.html
[13] Vgl. Körner / Maier (2002), S. 271
[14] Vgl. Mikus (2001), S. 15
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Dokuments?
Dieses Dokument behandelt das Thema Risikomanagement, insbesondere in der Wohnungswirtschaft. Es beschreibt die Grundlagen des Risikomanagements, die Risikopolitik, den Risikomanagementprozess und die Implementierung eines Frühwarnsystems in der Praxis.
Was sind die Hauptbestandteile des Risikomanagementprozesses, die in diesem Text hervorgehoben werden?
Die wichtigsten Bestandteile des Risikomanagementprozesses sind Risikobetrachtung und -beurteilung (einschließlich Risikoidentifikation, Risikomessung und -bewertung, Risikolimitierung), Risikosteuerung und Dokumentation.
Welche Arten von Risiken werden in diesem Dokument unterschieden?
Das Dokument unterscheidet zwischen direkten und indirekten Risiken, sowie zwischen reinen und spekulativen Risiken. Es werden auch interne und externe Risikokategorien unterschieden.
Was ist ein operationelles Risiko laut diesem Text?
Operationelles Risiko wird definiert als direkte oder indirekte wertmindernde und werterhöhende Ereignisse, die aufgrund interner Verfahren und Systeme sowie externer Ereignisse eingetreten sind.
Was ist das Ziel der Risikopolitik in einem Unternehmen?
Die Risikopolitik zielt darauf ab, die sozialen, finanziellen und leistungswirtschaftlichen Unternehmensziele abzusichern. Im Vordergrund steht die Sicherung der Existenz und des Unternehmenserfolgs.
Welche Rolle spielt ein Frühwarnsystem im Risikomanagement?
Ein Frühwarnsystem ist ein wichtiges Element des Risikomanagementsystems. Es dient dazu, potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen zur Risikosteuerung einzuleiten.
Warum ist Risikomanagement in der Wohnungswirtschaft wichtig?
Risikomanagement ist in der Wohnungswirtschaft aufgrund der dramatischen Lage auf dem Wohnungsmarkt und der daraus resultierenden wirtschaftlichen Situation der Wohnungsunternehmen unerlässlich. Es wird auch aufgrund aktueller Gesetzgebungen und der Forderungen von Prüfungsgesellschaften immer wichtiger.
Welche Rolle spielen die Mitarbeiter im Risikomanagementprozess?
Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, aktiv am Risikomanagement mitzuwirken und durch geeignete Maßnahmen Schäden vom Unternehmen abzuwenden und auf sich bietende Möglichkeiten hinzuweisen.
Wie wird Risiko in diesem Dokument definiert?
Risiko wird aus dem frühitalienischen „riscare“ abgeleitet und bedeutet substantiviert Wagnis. Aus der Entscheidungstheorie wird Risiko als Unsicherheitsgrad definiert, bei dem für das Eintreten zukünftiger Ereignisse objektive Wahrscheinlichkeiten vorliegen.
Welche Determinanten beeinflussen das Risikomanagement in der Wohnungswirtschaft?
Das Risikomanagement in der Wohnungswirtschaft wird von wirtschaftlichen und rechtlichen Determinanten beeinflusst.
- Quote paper
- René Behrendt (Author), 2003, Reduzierung operationeller Risiken durch die Implementierung eines Frühwarnsystems in einem Wohnungsunternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108895