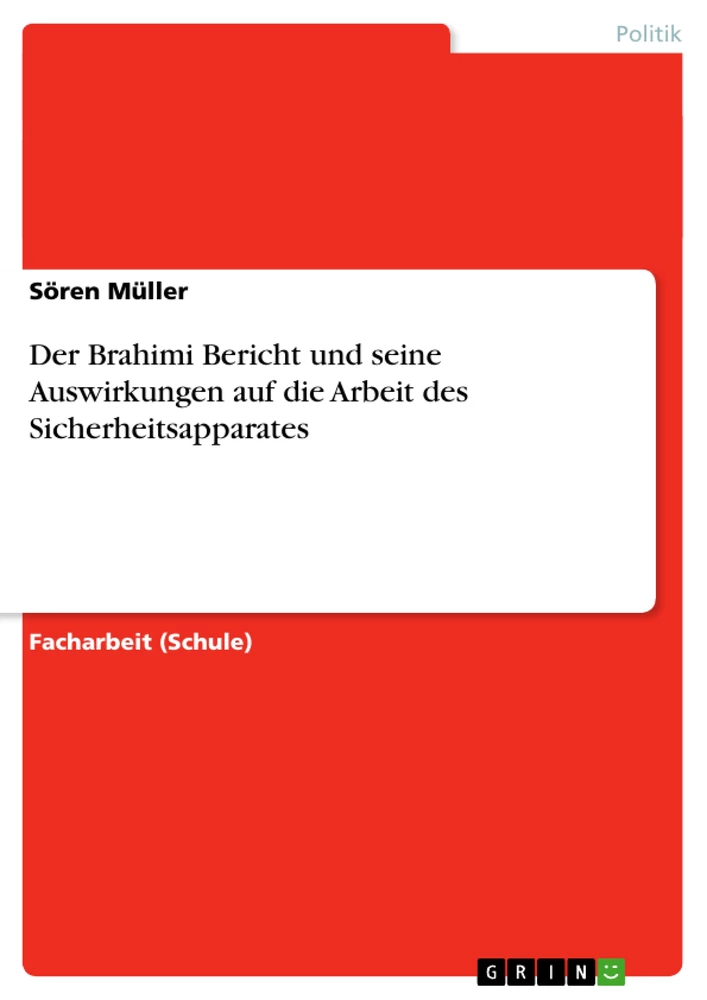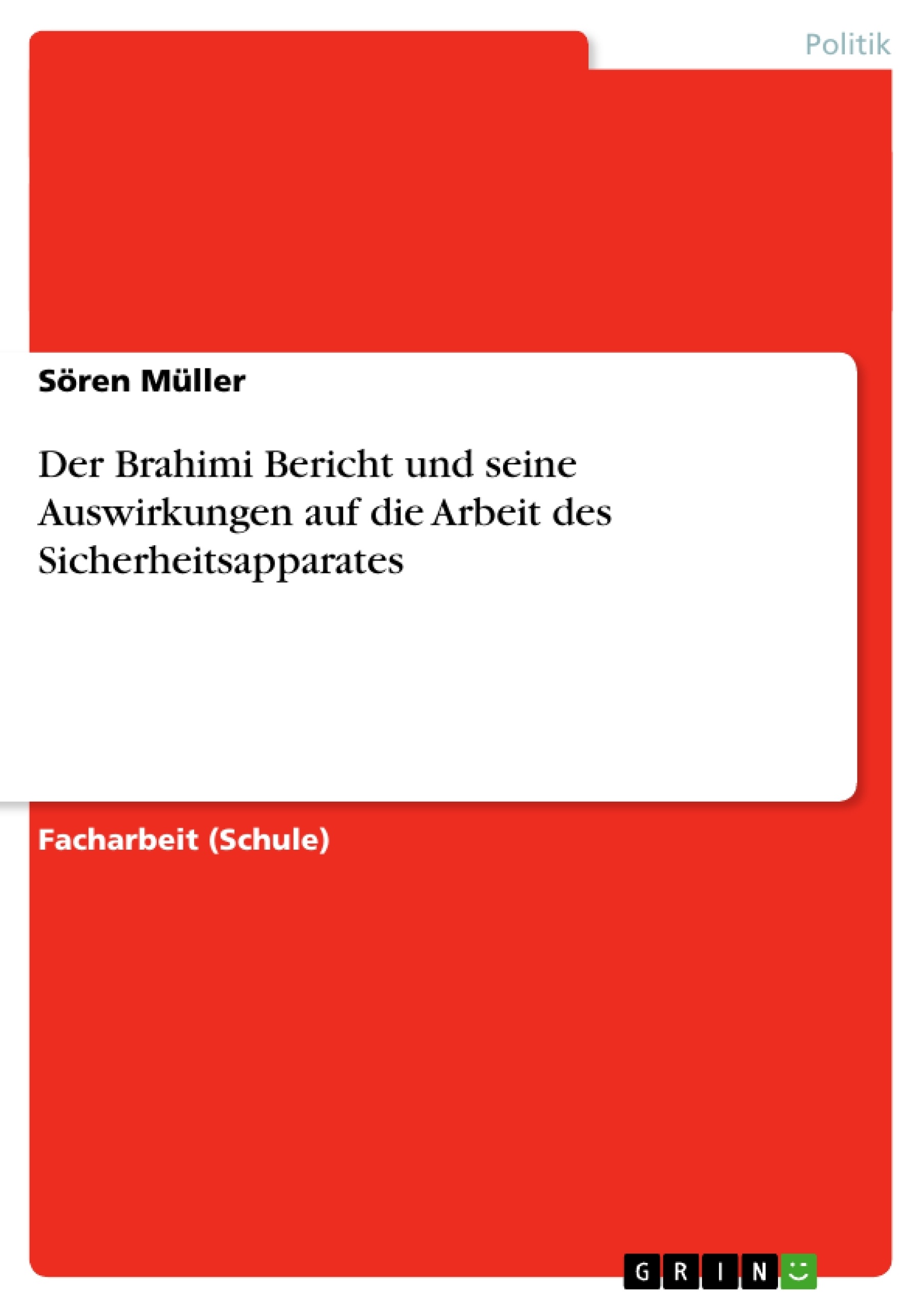Inhalt
Aufgabenstellung
1. Einführung und Problemstellung
2. Konfliktschlichtung und Konflikteindämmung nach der UNO-Charta
2.1 Entstehungsbedingungen der Charta
2.2 Defizite aus heutiger Sicht
3. Der Brahimi-Report
3.1. Grundlagen zu Erarbeitung
3.2. Erkenntnisse und Forderungen
3.3. Benennungsgrundlage für „6 ½“?
3.4. Auswirkungen und Umsetzungschancen
4.Fazit
5. Quellen/Literaturliste
Aufgabenstellung
Der Brahimi Report, Dokument höchster Wichtigkeit im Gefüge des UNO-Systems oder nur ein weiteres Papier im Dokumentendschungel? Die Mandatsvergabe von Friedensmissionen der Vereinten Nationen nach Charta, ihre Entstehungsbedingungen und Defizite aus heutiger Sicht. Die Intentionen und der Inhalt des Brahimi-Berichts, seine Folgen und Aussichten in der Gegenwart.
1. Einführung und Problemstellung
Kriegerische Auseinandersetzungen haben, besonders in den letzten 15 Jahren, ihr Gesicht völlig verändert. Zwischenstaatliche Konflikte kommen nicht mehr vor (Ausnahme: 2. Golfkrieg 1991), „kleine“ innerstaatliche Übergriffe auf Minderheiten bilden jetzt die große Aufgabe im supranationalen Konsens. Aufgrund der Beendigung des Kalten Krieges, der die Welt wenigstens ordnete und alle Konflikte nebenbei überschattete, kamen große Erwartungen auf die UNO zu. Anstatt, wie die weitläufige Meinung war, das sich alle Regierungsgesandten der Welt sich an einen Tisch setzen und alle Probleme der Welt lösen, passiert genau das Gegenteil. Zu keiner Zeit, in der Geschichte der Vereinten Nationen, wurden so viele Resolutionen verabschiedet wie nach Beendigung des Kalten Krieges. Die Einsätze, die der Sicherheitsrat nun zur Schlichtung der Konflikte mandierte, waren aber von Grund auf anders als alles, was in der Charta vorgesehen war. Auf Bürgerkriege verzichteten die Verfasser völlig. Eine Änderung der Verfahrensweise zur Konfliktbeilegung bzw. zur Entschärfung oder Befriedung einer Auseinandersetzung, allerdings ohne die Charta selbst zu verändern, war notwendig geworden. Denn die Charta der Vereinten Nationen zu ändern, ist nahezu unmöglich. Um dieses zu erreichen, müsste eine Mehrheit von 2/3 der Generalversammlung dieser Änderung zustimmen. Vorher allerdings benötigt jeder Staat die Zustimmung seines Parlamentes- ein vorstellbar überaus langer Zeitraum. Also benötigte man eine pragmatischere, realistischere Lösung. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan, gab den Auftrag eines Reports, der klären sollte, wie eine Verbesserung der Einsätze unter UNO Mandat zu erreichen sei, um für die Probleme des 21. Jahrhunderts gewappnet zu sein. Mit Hilfe vieler Experten aus den verschiedensten Bereichen schrieb der ehemalige algerische Außenminister, Lakhdar Brahimi, den nach ihm benannten „Brahimi-Report“.
Die Wirkung des Reports auf die Mandatsvergabe und die Arbeit der Blauhelme können kaum überschätzt werden.
2. Konfliktschlichtung und -eindämmung nach der UNO-Charta
2.1. Entstehungsbedingungen der Charta
Die Vereinten Nationen sind ein Kind des 2. Weltkrieges.[1] Gegründet wurden sie am 26.Juni 1945 in San Francisco. Die 51 Gründungsmitglieder (51. ist Polen, welches aber auf Grund des Nachkriegszustandes nicht beteiligt sein konnte und später als Gründungsmitglied aufgenommen wurde) einigten sich auf die, von Großbritannien und den USA, entworfene Charta. Nazideutschland und Japan sind besiegt, die Stimmung ist euphorisch, solch eine Grausamkeit soll niemals mehr über die Menschheit kommen, darin sind sich alle einig (siehe Präambel der Charta). Aber die Differenzen der beiden übrig gebliebenen Supermächte USA und UdSSR der nächsten Jahrzehnte werden beispiellos sein. Nur diese beiden Staaten sind zu dieser Zeit als „Supermächte“ zu bezeichnen. Im Laufe der Jahre werden diese beiden Systemfeinde ein so großes atomares Waffenarsenal entwickeln, dass der jeweils andere keine Chance hat den Gegner mit einem Schlag auszulöschen. Keiner will seine Machtstellung aufgeben. In dieses weltpolitische Gefüge wird die Charta „hineingeboren“. Unter der Federführung der USA (Truman) und Großbritanniens (Churchill) wird die Charta als Dokument des gegenseitigen Respekts und der Völkerfreundschaft verfasst. In der Charta ist das Recht der Völker, über sich selbst zu bestimmen, festgelegt. Sie soll zwischen souveränen Staaten in jeder nötigen und möglichen Art und Weise vermitteln, sei es bei kriegerischer Auseinandersetzung oder internationaler Rechtssprechung.
Diese Einteilung in souveräne Staaten ist die große Problematik, mit der sich der Brahimi-Bericht befasst. In der Charta ist die Souveränität eines jeden Staates unantastbar. Was innerhalb der Grenzen eines Staates geschieht, geht theoretisch niemanden etwas an. Inzwischen gibt es Bestrebungen, diesen Status zu Gunsten der Menschenrechte zu verschieben. „Das internationale Recht zu humanitären Missionen erfordert ein neues Verständnis von staatlicher und individueller Souveränität“[2]. Der Schutz der Menschen vor Krieg, Krankheit und Armut ist bis heute das zentrale Thema der Arbeit in den Vereinten Nationen. Als Beispiel gelten UNICEF, die Weltbank, der Treuhandrat usw..
2.2. Defizite aus heutiger Sicht
Der Umstand, dass die Charta nur von souveränen Staaten ausgeht, ist Ursache, dass Bürgerkriege eigentlich völlig aus dem Kompetenzbereich der UN fallen. Laut UN-Charta muss eine Gefahr für den Weltfrieden bzw. für die Stabilität und Souveränität eines Staates existieren, bzw. muss ein Staat den Sicherheitsrat um Hilfe bitten, damit dieser ein Mandat vergeben kann. Bei einem Bürgerkrieg ist dieser Umstand nicht erfüllt. Der Begriff des Konfliktes ist zu eng definiert, der Handlungsraum für die UN ist eng geknüpft.
Lange Zeit war dieser Umstand nicht folgenschwer, da während des Kalten Krieges keine Konflikte in diesem Rahmen aufgetreten waren.
Nach dem Ende des Kalten Krieges hat sich die Situation schlagartig verändert. Ehemalige Satellitenstaaten der Sowjetunion begehren nach Unabhängigkeit (Tschetschenien); andere Staaten entfachen durch ihren Hass kriegerische Auseinandersetzungen mit benachbarten Völkern (Jugoslawien).
Die UN ist machtlos, Da sich in ihrer Charta kaum Artikel finden, die ihnen eine Vollmacht gäben, einzuschreiten. Solch eine Situation trat 1992 in Somalia auf.
3. Der Brahimi-Bericht
3.1. Grundlagen zur Erarbeitung
Die Vereinten Nationen waren in ihren friedenssichernden, friedensstiftenden sowie friedenserhaltenden Mandaten Anfang bis Mitte der neunziger Jahre zum Teil erfolglos, wie der Einsatz in Somalia 1992 verdeutlichte. Nachdem der somalische Präsident Siad Barre 1991 bei einem Putsch entmachtet wurde, brach ein Bürgerkrieg aus, in dessen Folgen über 1.000.000 Menschen flohen und über 5.000.000 Menschen unter Hunger und Krankheiten litten. Im Januar 1992 verhängte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ein Waffenembargo über Somalia und konnte daraufhin bei Gesprächen einen Waffenstillstand erreichen. UNOSOM (United Nations Operation in Somalia) wurde etabliert. Die Auseinandersetzung ging unvermindert weiter, inzwischen waren 1.500.000 Menschen verhungert. Die USA boten 1992 dem Sicherheitsrat an, die Führung einer Truppe zur Befriedung Somalias, zu übernehmen. Nachdem im Laufe dieser Mission mehrere tödliche Übergriffe auf US-amerikanische Soldaten verübt wurden, brach man die Mission sehr schnell ab und überließ Somalia seinem Schicksal.[3]
Als späte Konsequenz daraus wurde dem ehemaligen algerischen Außenminister Lakhdar Brahimi durch Kofi Annan im Jahre 2000 der Auftrag erteilt, mithilfe eines Expertenteams einen Bericht zu verfassen, der die faktische Entwicklung kriegerischer Auseinandersetzungen und den Einsatz der Blauhelme analysieren sollte. Der Report war weitaus erfolgreicher als man sich das im allgemeinen vorstellen konnte (siehe Fazit), da bisher ähnlich angelegte Berichte („Agenda for Peace“ von Boutros Boutros-Ghali, 1992) im Vorfeld des Brahimi-Berichts „im Sande verliefen“. (Dieser stellte sich im Nachhinein als zu optimistisch heraus) Boutros- Ghali schätzte die politische Lage zum Ende des Kalten Krieges nicht richtig ein und sah die nun folgenden Probleme nicht in ihrer ganzen Vielfalt.
Brahimis Report ordnete die politische Diskussion um Reformmöglichkeiten der Friedenssicherung im Rahmen der UNO, indem er wirkliche Änderungen in der Verfahrensweise und vor allem in der Mandatsvergabe des Sicherheitsrates forderte. Die konkreten Vorschläge der Kommission um Brahimi sollen im folgenden dargestellt werden.
3.2. Erkenntnisse und Forderungen
Im Bericht wurde festgestellt, dass die durch den Sicherheitsrat der UN mandatierte Friedensmissionen mehrfach beim Schutz der Menschen vor Krieg versagten. Er fordert nun grundlegende Änderungen in Strategie und Konzeption der Blauhelmmissionen, in der Entscheidungsfindung für Einsätze, deren Planung und Unterstützung in technischer Hinsicht sowie den Einsatz modernster Technik. Einige zentrale Punkte sind in einer ausführlichen Zusammenfassung beschrieben:
1. Prävention von Konflikten[4]
- Der Brahimi-Bericht fordert eine vermehrte Nutzung von „konflikt-findenden“ Mandaten, um anschwellende Auseinandersetzungen im „Kern zu ersticken“.
Wenn die Mitarbeiter der Vereinten Nationen in verschiedenen Regionen, in denen schon Spannungen vorherrschen, nach Gründen dieser suchen dürfen, kann man möglicherweise deren „Verschärfung“ vermeiden, indem man diese Probleme „ad hoc“ bespricht und schon vor einem möglichen Ausbruch des Konfliktes agieren kann.
2. Friedensschaffende Maßnahmen
- Brahimis Report empfiehlt den Einsatz internationaler Experten für Menschen- und Bürgerrechte und des Polizeiwesens.
Um eine möglichst rasche Selbstverwaltung eines Einsatzgebietes zu sichern, werden zivile Experten verschiedener Fachgebiete eingesetzt, um den Aufbau von z.B. Polizei- und Gerichtsstrukturen zu überwachen und zu unterstützen. Des weiteren dienen sie zur Überwachung der, möglicherweise notwendigen, Demokratisierung eines Staates.
3. Klar definierte realistischere Mandate
- Resolutionen müssen den Notwendigkeiten von Einsätzen auch gerecht werden.
Dies bedeutet, es muss eine realistischere Planung der Einsätze erreicht werden. Diese muss aus Gründen der Rationalität, nicht aus Gründen des guten Willens, erstellt werden. Es kam in der Vergangenheit vermehrt vor, dass Mitarbeiter der Vereinten Nationen als Puffer zwischen Kriegsgegnern fungierten, wobei ihnen im Falle eines Angriffes das Recht auf Selbstverteidigung nicht gegeben war und sie als Geiseln genommen wurden. Der Brahimi-Report fordert daher eine Konkretisierung des jeweiligen Sicherheitsrat- Mandates, um solche Situationen zukünftig zu vermeiden bzw. in ihrer Quantität zu beschränken.
4. Bessere Aufklärung
- Umformung des Executive Committee on Peace and Security (ECPS) zum Executive Committee on Peace and Security Information and Strategic Analysis Secretariat (EISAS).
Dies bedeutet, dass das, vormals reaktive Gremium zu einem aktiven Gremium gewandelt wird. Es ist nicht mehr auf Informationen anderer angewiesen, sondern kann sich diese nun selber beschaffen. Dadurch könnte die Effektivität der UN-Friedensmissionen gestärkt werden, da die Gefahren schneller erkannt werden können.
5. Zeitlich festgelegte Entsendungsstandards
- Es müssen Experten verschiedenster Fachgebiete (Militär, Polizei, internationales Recht, Mandatsspezialisten und Experten für Menschenrechte) innerhalb von 30 Tagen bei traditionellen Einsätzen und innerhalb von 90 Tagen bei komplizierteren Einsätzen verfügbar sein. Diese sollten von den Staaten „zur Verfügung gestellt“ werden, und nicht vom Sekretariat bei jedem Staat erfragt werden. Durch diese Verfahrensweise können viel Zeit und Geld gespart werden.
Der Brahimi-Report verdeutlichte, das diese Vorschläge nur Wirkung zeigen können, wenn die Mitgliedsstaaten bei der Umsetzung der Empfehlungen finanziell, politisch und mit „know-how“ unterstützend wirken würden. Die Verantwortung für Frieden in der Welt hängt vom Engagement der Mitgliedsstaaten ab.
3.3. Benennungsgrundlage für „6 ½“?
Als während der Suez-Krise 1956 das Peace-Keeping durch den starken Einsatz des damaligen UN-Generalsekretärs Dag Hammarskjöld entwickelt und zur Umsetzung gebracht wurde, war sie eine Idee zur Sicherung des Friedens. Im Gegensatz zu früheren Missionen sollte UNEF I ( United Nations Emergency Force), so der Name der entsandten Truppen, den Waffenstillstand nicht nur überwachen, sondern, wenn nötig, erzwingen.
Diese erste Form des Peace-Keeping ist als Maßnahme des Artikels 6 der Charta anzusehen. Dazu einige Auszüge aus dem Kapitel VI der Charta der Vereinten Nationen „zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten“:
Artikel 33: [5]
(1) Die Parteien einer Streitigkeit, deren Fortdauer geeignet ist, die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu gefährden, bemühen sich zunächst um eine Beilegung durch Verhandlung, Untersuchung, Vermittlung, Vergleich, Schiedsspruch, gerichtliche Entscheidung, Inanspruchnahme regionaler Einrichtungen oder Abmachungen oder durch andere friedliche Mittel eigener Wahl. [...]
Artikel 36:
(1) Der Sicherheitsrat kann in jedem Stadium einer Streitigkeit im Sinne des Artikels 33 oder einer Situation gleicher Art geeignete Verfahren oder Methoden für deren Bereinigung empfehlen. [...]
Artikel 37:
(1) Gelingt es den Parteien einer Streitigkeit der in Artikel 33 bezeichneten Art nicht, diese mit den dort angegebenen Mitteln beizulegen, so legen sie die Streitigkeit dem Sicherheitsrat vor.
(2) Könnte nach Auffassung des Sicherheitsrats die Fortdauer der Streitigkeit tatsächlich die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit gefährden, so beschließt er, ob er nach Artikel 36 tätig werden oder die ihm angemessen erscheinenden Empfehlungen für eine Beilegung abgeben will. [...]
Das 6.Kapitel erlaubt also nur einen Einsatz ziviler Maßnahmen bzw. die in Artikel 33/1 benannten Regelungen. Hier gehen in erster Konsequenz alle Versuche einer Streitschlichtung von den beiden Konfliktparteien aus, die sich vom Sicherheitsrat ergänzen lassen. Das 7. Kapitel befasst sich bereits mit der Situation, dass ein bewaffneter Konflikt bevorsteht oder bereits stattfindet (siehe Kapitel VII/ Artikel 39). In diesem Falle hat die Charta eindeutig die Kompetenzen der Weltgemeinschaft festgelegt. Dazu einige Auszüge aus Artikel VII der Charta der Vereinten Nationen: „Die Maßnahmen bei Bedrohung oder Bruch des Friedens und bei Angriffshandlungen“:
Artikel 39:
Der Sicherheitsrat stellt fest, ob eine Bedrohung oder ein Bruch des Friedens oder eine Angriffshandlung vorliegt; er gibt Empfehlungen ab oder beschließt, welche Maßnahmen auf Grund der Artikel 41 und 42 zu treffen sind, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren oder wiederherzustellen.[...]
Artikel 41:
Der Sicherheitsrat kann beschließen, welche Maßnahmen - unter Ausschluss von Waffengewalt - zu ergreifen sind, um seinen Beschlüssen Wirksamkeit zu verleihen; er kann die Mitglieder der Vereinten Nationen auffordern, diese Maßnahmen durchzuführen. Sie können die vollständige oder teilweise Unterbrechung der Wirtschaftsbeziehungen, des Eisenbahn-, See- und Luftverkehrs, der Post-, Telegraphen- und Funkverbindungen sowie sonstiger Verkehrsmöglichkeiten und den Abbruch der diplomatischen Beziehungen einschließen.
Artikel 42:
Ist der Sicherheitsrat der Auffassung, daß die in Artikel 41 vorgesehenen Maßnahmen unzulänglich sein würden oder sich als unzulänglich erwiesen haben, so kann er mit Luft-, See- oder Landstreitkräften die zur Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen durchführen. Sie können Demonstrationen, Blockaden und sonstige Einsätze der Luft-, See- oder Landstreitkräfte von Mitgliedern der Vereinten Nationen einschließen.
Artikel 43:
(1) Alle Mitglieder der Vereinten Nationen verpflichten sich, zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit dadurch beizutragen, daß sie nach Maßgabe eines oder mehrerer Sonderabkommen dem Sicherheitsrat auf sein Ersuchen Streitkräfte zur Verfügung stellen, Beistand leisten und Erleichterungen einschließlich des Durchmarschrechts gewähren, soweit dies zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlich ist. [...]
Wie in der gesamten Charta wird auch hier ganz besonders auf die Verantwortung jedes Staates für die Umsetzung der gemeinsamen Zielen hingewiesen. Ob der Bestand eines bewaffneten Konflikts oder die Bedrohung durch solchen erfüllt ist, entscheidet einzig und allein der Sicherheitsrat. Nur er besitzt eine Definitionsbefugnis[6] bzw. ein Definitionsmonopol. Die Definitionsbefugnis bedeutet, dass der Sicherheitsrat bestimmen kann wann eine Gefahr für den Weltfrieden oder die Souveränität eines Staates vorliegt. Ist ein Flüchtlingsstrom schon eine Gefahr für die Souveränität eines Staates? Oder Bedarf es dazu einer gewollten und feindseligen Aggression?
Das Definitionsmonopol ist die völkerrechtliche Machtbasis des Sicherheitsrates. Es gibt nur ihm die Erlaubnis, über Krieg und Frieden zu entscheiden, er hat das Privileg, eine kriegerische Handlung zu rechtfertigen. Diese Monopolstellung ist eindeutig im Artikel 39 (siehe oben) bestimmt.
Weshalb werden Brahimis Forderungen aber nun als Kapitel 6 ½ bezeichnet? Zentrale Forderungen Brahimis sind die Umgestaltung der Friedensmissionen sowie eine realistischere Mandatsvergabe. Ohne effektive, realistische Mandate sind den Kräften vor Ort die Hände gebunden, die Hilfe kehrt sich in das Gegenteil und man muss möglicherweise den Auftrag ganz abbrechen bevor er richtig begonnen hat. Die Resolutionen müssen auch durchgeführt werden, notfalls mit Gewalt. Das ist die Forderung nach „robustem“ Peace-Keeping, in dessen Auftrag den Soldaten auch eine Anwendung von Waffen nicht untersagt ist. Zum Ersten dient es dem Schutz ihres eigenen Lebens(es gab in der Vergangenheit Mandate die den Truppen selbst dieses Recht nicht gab), zum Zweiten unterstützt es den Schutz der Menschen durch kontrollierten Waffeneinsatz. Genauso dazu gehört die strikte Unterscheidung zwischen Opfer und Täter. Oft haben die UN, aus Angst ihre Neutralität zu verlieren, beide Konfliktparteien nahezu gleichbehandelt. Die Vereinten Nationen müssen lernen, dass ihre Neutralität nicht mit einer Unparteilichkeit gegenüber dem Staat, gegen den eine Maßnahme durchgeführt wird, zu verwechseln sein darf. Dies muss auch in den Mandaten, die der Sicherheitsrat verabschiedet, verdeutlicht werden. Diese Politik ist nicht tragbar, solange weiterhin Menschen töten und getötet werden. Das, - in Artikel 6 erwähnte - Peace-Keeping ist ein friedliches Mittel, das aber mit militärischen Mitteln durchgesetzt werden kann. Artikel 7 ist, wie bereits erwähnt, die Rechtsgrundlage der UN bei Mitteln, die einseitig, also gegen einen Staat, gewandt sind. Das können zum Beispiel Wirtschaftssanktionen sein, indem man einen wichtigen Hafen sperrt und sämtliche diplomatischen Kontakte abbricht (siehe Kapitel 7, Artikel 41) . Bei „robustem“ Peace-Keeping aber werden bereits Truppen entsandt, um ein Ausbrechen des sich anbahnenden Konfliktes zu verhindern, es im Keim zu ersticken. Der oder die betreffenden Staaten befinden sich nicht im Kriegszustand. Man kann diesen Eskalationspfad über eine tabellarische Form der Charta legen:[7]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der rote Pfeil, der quer über den Ausschnitt gelegt ist, ist eine Verdeutlichung dieses Eskalationspfades. Er überstreicht alle Maßnahmen die die Vereinten Nationen im Falle eines Konfliktes anwenden dürfen.
3.4. Auswirkungen und Umsetzungschancen
Der Bericht führte zu den verschiedensten Änderungen in der Konzeption der Mandate und deren Umsetzung. Die sogenannten „on-call“ Listen (siehe 3.2. Punkt 1 „Erkenntnisse und Forderungen“) sind inzwischen installiert. Die Mandate, die im allgemeinen immer wieder verlängert werden (siehe Anhang 1), sind inzwischen in den meisten Punkten auf die Forderungen Brahimis angepasst worden: Jeder Blauhelm, der heutzutage unter einem Mandat der Vereinten Nationen im Einsatz ist, hat das vollständige Recht auf Selbstverteidigung. Der Forderung nach mehr Mitteln für die Vereinten Nationen im allgemeinen wurde kaum nachgekommen. Es sieht weiterhin so aus, dass der Kern der Organisation weniger Geld für den Haushalt zur Verfügung hat als Polizei und Feuerwehr von New York. Der Forderung Brahimis, die Verantwortung über eine Konfliktregion nach dessen Befriedung in die Hände der entsprechenden Region zu legen wurde Rechnung getragen. Als Beispiel kann man die Balkan-Krise anführen, dessen ehemaliges Kampfgebiet nun komplett von der Europäischen Union verwaltet wird. Aufgrund der Forderungen wurde das Department for peacekeeping operations (DPKO) vergrößert, allerdings nicht annährend so stark wie der Report es fordert. Dieser Forderung wurde durch die Generalversammlung angelehnt. Die Trennung, innerhalb der Friedensmissionen, von Polizei und Militär wurde inzwischen vollzogen. Weitere Änderungen die der Brahimi-Report nach sich zog aus einer externen Quelle:[8]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4. Fazit:
Durch die Arbeit des Expertenteams um Lakhdar Brahimi konnte ein Dokument geschaffen werden, dass zwar keine Überraschungen bereithielt, jedoch die Arbeit der Truppen und vor allem der Mandatsvergabe stark beeinflusste.
Der Bericht bereitete die entsprechenden Büros und Sekretarien der Vereinten Nationen durch seine Forderungen auf die Zukunft vor. Durch die vermehrte Nutzung von „konflikt-findenden“ Mandaten kann ein Ausbrechen von Konflikten im Voraus verhindert werden. Die Änderung der Mandate zu „robusten“ Mandaten, und damit die Veränderung zum „robusten“ Peace-Keeping, wird den Schutz der Menschen vor Krieg effektiver machen.
Inwiefern diese Reformen Bestand, haben hängt davon ab, wie sich die Konflikte in Zukunft entwickeln und inwieweit die Mitgliedsstaaten sich in den Vereinten Nationen engagieren werden. Denn das Hauptproblem der Vereinten Nationen ist ihre notorische Geldnot.
Literaturliste:
Unser, Dr. Günther: ABC der Vereinten Nationen. Berlin: Auswärtiges Amt, Dezember 2000
Brahimi, Lakhdar, Der Brahimi-Report, New York 2000. A/55/305- S/2000/809, URL: www.un.org/peace/reports/peace-operations/docs/55_502e.pdf heruntergeladen am 26.10.2003
Schattenmann, Marc: Frieden und Sicherheit, in: Herz, Dietmar/ Jetzlsperger, Christian/ Schattenmann, Marc (Hrsg.): Die Vereinten Nationen. Entwicklung, Aktivitäten, Perspektiven, Frankfurt/M. 2002, S.48-95
Annan, Kofi: The legitimacy to intervene International action to uphold human rights requires a new understanding of state and individual sovereignty, in Financial Times New York, 31.12.1999 URL: www.globalpolicy.org/secgen/interven.htm heruntergeladen am 7.2.2004
Herz, Dietmar/Jetzlsperger, Christian/Schattenmann, Marc (Hrsg.): Die Vereinten Nationen. Entwicklung, Aktivitäten, Perspektiven, Frankfurt/M.: Fischer 2002
Volger, Helmut: Die Vereinten Nationen, München/Wien: Oldenbourg 1994
Volger, Helmut (Hrsg.): Lexikon der Vereinten Nationen, München/Wien: Oldenbourg 1999
Unser, Günther: Die UNO. Aufgaben und Strukturen der Vereinten Nationen, München: Beck/ dtv 1997
www.un.org
www.uno.de
[...]
[1] Reinhard Wesel, aus einer e-Mail vom 28.8.03 an den Verfasser
[2] Kofi Annan, 31.12.1999
[3] Summary of the UNOSOM mission, URL: www.un.org/Depts/dpko/dpko/co_mission/unosom1backgr1.htm , heruntergeladen am 7.2.2004
[4] Brahimi, L. (2000). Der Brahimi-Report. URL: www.un.org/peace/reports/peace-operations/ heruntergeladen am 26.10.2003
[5] Charta der Vereinten Nationen (1945). „Friedliche Beilegung von Konflikten“. URL: www.uno.de/charta/charta.htm heruntergeladen am 26.10.2003
[6] Marc Schattenmann 2002, S.52
[7] Marc Schattenmann, S. 54
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Brahimi-Report?
Der Brahimi-Report ist ein Dokument, das von Lakhdar Brahimi im Auftrag des UN-Generalsekretärs Kofi Annan erstellt wurde. Er analysiert die Effektivität von UN-Friedensmissionen und schlägt Verbesserungen vor, um die UN für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu rüsten.
Was waren die Hauptgründe für die Erstellung des Brahimi-Reports?
Der Bericht wurde aufgrund von Erfolglosigkeit der Vereinten Nationen in ihren friedenssichernden, friedensstiftenden sowie friedenserhaltenden Mandaten erstellt. Der Einsatz in Somalia 1992 ist hierfür ein Beispiel. Ehemalige Satellitenstaaten der Sowjetunion begehren nach Unabhängigkeit (Tschetschenien); andere Staaten entfachen durch ihren Hass kriegerische Auseinandersetzungen mit benachbarten Völkern (Jugoslawien). Die UN ist machtlos, Da sich in ihrer Charta kaum Artikel finden, die ihnen eine Vollmacht gäben, einzuschreiten. Solch eine Situation trat 1992 in Somalia auf.
Welche zentralen Forderungen enthielt der Brahimi-Report?
Der Bericht forderte grundlegende Änderungen in Strategie und Konzeption der Blauhelmmissionen, in der Entscheidungsfindung für Einsätze, deren Planung und Unterstützung in technischer Hinsicht sowie den Einsatz modernster Technik. Zu den zentralen Punkten gehörten die Prävention von Konflikten, friedensschaffende Maßnahmen, klar definierte und realistischere Mandate, bessere Aufklärung und zeitlich festgelegte Entsendungsstandards.
Was versteht man unter "robustem" Peace-Keeping?
"Robustes" Peace-Keeping bezeichnet eine Form der Friedenssicherung, bei der den Soldaten auch die Anwendung von Waffen nicht untersagt ist. Dies dient dem Schutz ihres eigenen Lebens und der Zivilbevölkerung. Es beinhaltet die strikte Unterscheidung zwischen Opfer und Täter und die Erkenntnis, dass die Neutralität der UN nicht mit Unparteilichkeit gegenüber dem Staat, gegen den eine Maßnahme durchgeführt wird, verwechselt werden darf.
Was ist der Unterschied zwischen Kapitel 6 und Kapitel 7 der UN-Charta?
Kapitel 6 der UN-Charta befasst sich mit der friedlichen Beilegung von Streitigkeiten, während Kapitel 7 Maßnahmen bei Bedrohung oder Bruch des Friedens und bei Angriffshandlungen behandelt. Kapitel 6 erlaubt nur zivile Maßnahmen, während Kapitel 7 auch militärische Interventionen zur Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit vorsieht.
Warum wird der Brahimi-Bericht als "Kapitel 6 ½" bezeichnet?
Der Brahimi-Bericht wird als "Kapitel 6 ½" bezeichnet, weil er eine Art Zwischenstufe zwischen den friedlichen Mitteln des Kapitels 6 und den militärischen Maßnahmen des Kapitels 7 darstellt. Er befürwortet das "robuste" Peace-Keeping, das zwar militärische Mittel zur Durchsetzung des Friedens einsetzt, aber nicht im eigentlichen Kriegszustand interveniert.
Welche Auswirkungen hatte der Brahimi-Report?
Der Bericht führte zu verschiedenen Änderungen in der Konzeption der Mandate und deren Umsetzung. Die sogenannten "on-call" Listen sind installiert. Die Mandate, die im allgemeinen immer wieder verlängert werden, sind inzwischen in den meisten Punkten auf die Forderungen Brahimis angepasst worden: Jeder Blauhelm, der heutzutage unter einem Mandat der Vereinten Nationen im Einsatz ist, hat das vollständige Recht auf Selbstverteidigung.
Welche Kritik gibt es am Brahimi-Report?
Der Forderung nach mehr Mitteln für die Vereinten Nationen im allgemeinen wurde kaum nachgekommen. Es sieht weiterhin so aus, dass der Kern der Organisation weniger Geld für den Haushalt zur Verfügung hat als Polizei und Feuerwehr von New York. Der Forderung Brahimis, die Verantwortung über eine Konfliktregion nach dessen Befriedung in die Hände der entsprechenden Region zu legen wurde Rechnung getragen. Als Beispiel kann man die Balkan-Krise anführen, dessen ehemaliges Kampfgebiet nun komplett von der Europäischen Union verwaltet wird. Aufgrund der Forderungen wurde das Department for peacekeeping operations (DPKO) vergrößert, allerdings nicht annährend so stark wie der Report es fordert. Dieser Forderung wurde durch die Generalversammlung angelehnt.
- Arbeit zitieren
- Sören Müller (Autor:in), 2004, Der Brahimi Bericht und seine Auswirkungen auf die Arbeit des Sicherheitsapparates, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108910