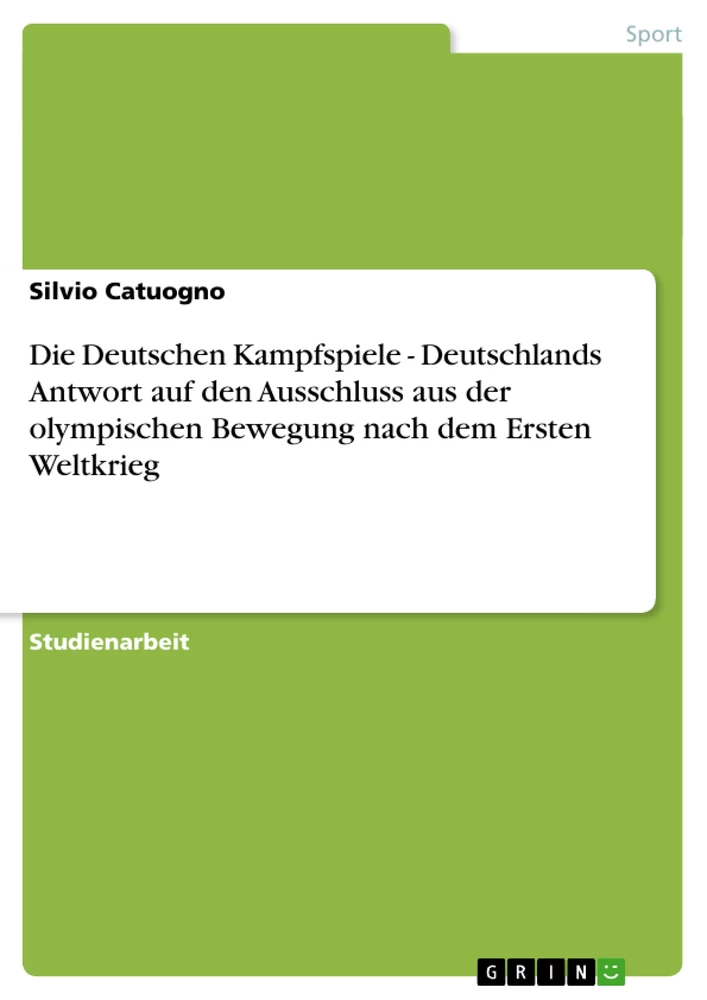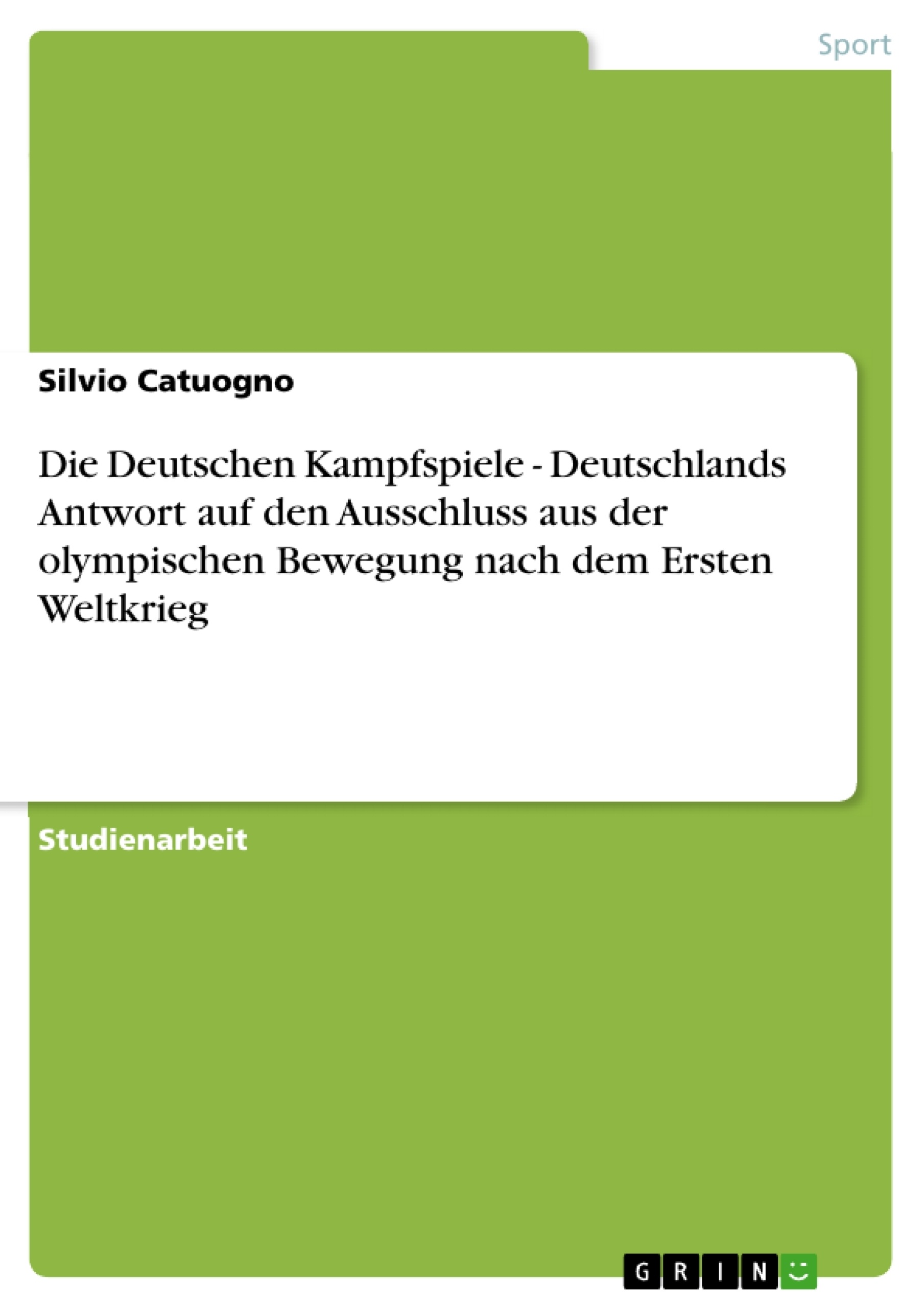In einer Zeit politischer Zerrissenheit und wirtschaftlicher Not erblühte im Deutschland der Weimarer Republik ein nationales Sportfest, das mehr war als nur ein Ersatz für die ausgeschlossene Teilnahme an den Olympischen Spielen: die Deutschen Kampfspiele. Waren sie wirklich lediglich eine Reaktion auf die internationale Ächtung, oder wurzelten ihre Ursprünge tiefer in der deutschen Geschichte und dem Bedürfnis nach nationaler Einheit? Diese Frage steht im Zentrum einer fesselnden Reise durch die Sportgeschichte der Zwischenkriegszeit, die weit mehr als nur sportliche Wettkämpfe beleuchtet. Es ist eine Geschichte von nationaler Identität, von dem Ringen um Anerkennung und der Suche nach einem verlorenen Selbstverständnis inmitten von Inflation, politischer Instabilität und den Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs. Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Kampfspielgedankens von seinen Anfängen im 18. und 19. Jahrhundert, über die nationalistischen Bestrebungen vor dem Ersten Weltkrieg bis hin zur konkreten Umsetzung in den 1920er Jahren. Dabei werden die politischen Hintergründe, die Rolle von Schlüsselfiguren wie Carl Diem und die Bedeutung der Kampfspiele für die deutsche Bevölkerung ebenso untersucht wie die ideologischen Strömungen, die diese Bewegung prägten. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den drei Austragungen der Kampfspiele in Berlin (1922), Köln (1926) und Breslau (1930), ihren sportlichen Wettbewerben, den begleitenden Festlichkeiten und ihrer Rezeption in der Öffentlichkeit. Es wird aufgezeigt, wie die Kampfspiele als Instrument der nationalen Selbstfindung und als Plattform für die Demonstration deutscher Stärke und Einheit dienten, und wie sie letztendlich im Schatten des aufkommenden Nationalsozialismus instrumentalisiert und ihrer ursprünglichen Bedeutung beraubt wurden. Entdecken Sie die vielschichtige Geschichte der Deutschen Kampfspiele, ein vergessenes Kapitel deutscher Sportgeschichte, das uns viel über die deutsche Seele und die Suche nach nationaler Identität in einer turbulenten Epoche verrät. Tauchen Sie ein in eine Welt von sportlichem Ehrgeiz, nationalem Pathos und politischer Instrumentalisierung, die bis heute nachwirkt und zum Nachdenken über die Rolle des Sports in der Gesellschaft anregt. Erfahren Sie mehr über die Ursprünge des deutschen Sports und seine Entwicklung unter dem Eindruck von Krieg, Krisen und politischen Umwälzungen. Die Deutschen Kampfspiele – mehr als nur ein "Olympia-Ersatz", ein Spiegelbild der deutschen Seele in einer Zeit des Umbruchs, ein Muss für jeden, der die deutsche Geschichte und die Bedeutung des Sports verstehen will.
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
2. Die politische Situation im Deutschen Reich nach dem Ersten Weltkrieg
3. Die Entwicklung des Sports in der Weimarer Republik
4. Die Entwicklungen der internationalen Sportbeziehungen nach dem 1. Weltkrieg
4.1 Der Ausschluss aus der internationalen olympischen Bewegung
4.2 Antwerpen 1920- Olympische Spiele ohne deutsche Beteiligung
4.3 Die Reaktionen in Deutschland und die Verwirklichung des Kampfspielgedankens
5. Die Entwicklung des Kampfspielgedankens vor und während des 1. Weltkrieges
6. Die Durchführung der Deutschen Kampfspiele
6.1 Die 1. Deutschen Kampfspiele 1922 in Berlin
6.2 Die Deutschen Kampfspiele 1926 und 1930
7. Auf der Such nach den Ursprüngen des Kampfspielgedankens im 18. und 19. Jahrhundert
8. Schlussbetrachtung
9. Literaturverzeichnis
10. Anhang
1. Einführung
Betrachtet man die Formulierung des Themas dieser Arbeit und schlägt den Begriff der „Deutschen Kampfspiele“ in einem Sportlexikon nach, so erweckt dies den Eindruck, dass die Deutschen Kampfspiele als „Olympia-Ersatz“1 ein Produkt des 20. Jahrhunderts und eine direkte Antwort Deutschlands auf den Ausschluss aus der internationalen olympischen Bewegung nach dem Ersten Weltkrieg waren.
Diese Arbeit orientiert sich inhaltlich und in ihrer Form an der Klärung der Frage, inwieweit diese Vermutung stimmt, oder ob die Ursprünge der Kampfspiele viel weiter zurückreichen als zunächst vermutet.
Inhaltlich beschäftigt sie sich zunächst mit den Entwicklungen nach dem Ersten Weltkrieg. Nach einem kurzen Überblick über die politische Situation und einer Schilderung der Entwicklung des Sports in der Weimarer Republik werden das Verhältnis Deutschlands zum Internationalen Olympischen Komitee und die daraus resultierenden Ereignisse, erläutert. Danach begibt sich die Arbeit auf die Suche nach der Entwicklung des „Kampfspielgedankens“ vor und während des Ersten Weltkriegs. Es folgt eine Verlaufsdarstellung rund um die 1. Deutschen Kampfspiele 1922 in Berlin sowie der Spiele 1926 und 1930, um danach die eigentlichen Ursprüngen des Kampfspielgedankens und die Urväter dieser Idee zu ergründen.
Ein wichtiger Aspekt dieser Arbeit ist auch die Frage, wie das deutsche Volk auf diese Ereignisse reagierte und welche Wirkung die Kampfspiele in der Bevölkerung hatten. Die Inhalte, mit denen sich diese Arbeit beschäftigt sind bewusst nicht chronologisch gegliedert, sondern orientieren sich vielmehr an der Klärung und Ergründung des „Kampfspielgedankens“, ausgehend von der Situation nach dem Ersten Weltkrieg.
Im Rahmen des Seminars „Deutschland in der olympischen Bewegung“ an der Deutschen Sporthochschule Köln spielen die Deutschen Kampfspiele eine bedeutende Rolle für die Stellung Deutschlands im Bezug auf den internationalen Olympismus in einer politisch schwierigen Zeit.
2. Die politische Situation im Deutschen Reich nach dem Ende des Ersten Weltkrieges
„Das Deutsche Volk hat auf der ganzen Linie über seine Gegner gesiegt! Der Kaiser hat abgedankt! Es lebe die Deutsche Republik!“. Mit diesen Worten verkündete der Reichstagsabgeordnete Philip Scheidemann am 9.11.1918 die Gründung der Weimarer Republik und gab somit den Startschuss in eine von Krisen sowie innen- und außenpolitischen Problemen erschütterte Zeit.
Bereits zwei Tage später, am 11. November 1918 einigten sich die Kriegsparteien des Ersten Weltkrieges im Wald von Compiegne auf einen Waffenstillstand. Doch die Bedingungen der Waffenruhe, sowie später die des Versailler Friedensvertrages, der am 28. Juni 1919 von der Deutschen Nationalversammlung angenommen wurde, trafen das deutsche Volk hart und erschütterten das Zusammengehörigkeitsgefühl. Denn der Versailler Vertrag beinhaltete nicht nur die Anerkennung der alleinigen Kriegsschuld, er umfasste auch Reparationsforderungen in immensen Höhen und brachte das vom Krieg durch viele Gefallene und materielle Verluste schon schwer getroffene Deutsche Reich an den Rand des wirtschaftlichen und finanziellen Ruins.
Hatten wenige Monate zuvor noch alle fest daran geglaubt, die Kampfhandlungen als Sieger beenden zu können, stand nun das ganze Volk der harten Realität gegenüber, den Krieg nicht nur verschuldet, sondern auch verloren zu haben.
Die Gründung der Weimarer Republik ersetzte im Rahmen der Novemberrevolution 1918 die alte Monarchie des Deutschen Kaisers und verhinderte eine Rätediktatur nach bolschewistischem Vorbild. Durch diesen Schritt entstanden drei politisch kontroverse Lager, die sich gegenseitig für die unerwartet schlechten Entwicklungen und die desolate Lage des Deutschen Reichs verantwortlich machten.
Scheidemann und die Demokraten hatten gehofft, durch die Demokratisierung des Landes bereits vor Kriegsende die Alliierten milde zu stimmen, um bei einem Friedensvertrag faire Bedingungen aushandeln zu können. Doch die Alliierten, besonders Frankreich unter Clemenceau2 und später unter Poincaré3, hatten kein Interesse an einer schnellen militärischen sowie wirtschaftlichen Erholung des Deutschen Reiches, und konnten bei den Verhandlungen um den Versailler Vertrag ihre harten Bedingungen durchsetzten. Dies wiederum veranlasste die politisch rechts orientierten Lager der neugegründeten Weimarer Republik, den für die Unterzeichnung des Waffenstillstands sowie des Versailler Vertrags verantwortlichen
Demokraten die alleinige Schuld an den strengen Auflagen zuzuschieben. Schlagwörter wie „November-Verbrecher“, „Erfüllungspolitik“ oder die „Dolchstoß-Legende“ prägten politische Debatten dieser Zeit und beeinflussten stark die öffentliche politische Meinung. So hatte die junge Republik neben den durch den Krieg verursachten Problemen wie der Arbeitslosigkeit, deren Höhepunkt 1931 mit 6 Millionen Erwerbslosen erreicht wurde, sowie der schnell voranschreitenden Inflation, nun auch mit innenpolitischen Krisen, Aufständen und Putschversuchen zu kämpfen. Der Kapp-Putsch, der Spartakusaufstand im Ruhrgebiet sowie der kommunistische Aufstand, alle im Jahre 1921, sind nur einige Beispiele. Nationalisten ermordeten im Jahre 1922 den deutschen Außenminister Walther Rathenau, der durch seine „Erfüllungspolitik“ versucht hatte, die französischen Reparationsforderungen zu erfüllen. 1923 folgten Separatistenaufstände im Rheinland und der Hitler-Putsch. Bereits 1920 wurde das Rheinland von französischen Truppen besetzt. Durch diese Übernahme der Kontrolle über große Teile der deutschen Kohle- und Bergbau-industrie wollte Frankreich die Zahlung der Reparationsforderungen erzwingen.
All diese Entwicklungen trugen letztendlich zum Scheitern der Weimarer Republik bei. Großen Anteil daran hatte jedoch auch das politische System, das durch fehlende Einschränkungen, wie etwa eine „Prozent-Hürde“, vielen kleinen Parteien den Einzug ins Parlament ermöglichten, und so durch die sehr unterschiedlichen Ziele der einzelnen Parteien nahezu handlungsunfähig war. So gab es zwischen 1919 und 1932 acht verschiedene Reichstage mit zwanzig verschiedenen Regierungen. Ihren Höhepunkt erreichte dieses „Vielparteiensystem“ im Jahre 1932, als 36 Parteien zur Reichstagswahl antraten.
Diese Ereignisse sind jedoch nicht nur für das Scheitern der Weimarer Republik verantwortlich. Sie müssen auch berücksichtigt werden, um die gleichzeitig ablaufenden Entwicklungen des Stellenwerts von Sport und Leibesübungen, insbesondere die Entwicklungen, die zur Durchführung eines nationalen Sportfestes unter dem Namen „Deutsche Kampfspiele“ führten, zu verstehen und in einen geschichtlichen Zusammenhang zu bringen.
3. Die Entwicklung des Sports in der Weimarer Republik
Trotz der politischen und wirtschaftlichen Probleme gab es durchaus positive Entwicklungen in der Weimarer Nachkriegszeit, die das deutsche Volk wieder zusammenschweißten und von den Alltagsproblemen ablenkten. So erlebten Kunst und Kultur in allen Bereichen einen ungeahnten Aufschwung, von dem auch die Entwicklung des Sports profitieren konnte. In der Bevölkerung herrschte das allgemeine Gefühl, sich von den alten Konventionen der Vorkriegs- und Kaiserzeit gelöst zu haben. Reformideen, die zum Teil schon vor dem Krieg entstanden, wurden nun verwirklicht, was sich vor allem in den Bereichen der musischkünstlerischen Erziehung und der Leibeserziehung bemerkbar machte.
„Die Weimarer Zeit war für den deutschen Sport fruchtbar“4. Diesen Satz prägte Carl Diem viele Jahre später im Rückblick auf die damaligen Entwicklungen.
Carl Diem, von 1917 bis 1933 Generalsekretär des „Deutschen Reichsausschusses für Olympische Spiele“ (DRAfOS), 1917 in „Deutscher Reichsausschuss für Leibesübungen“ (DRAfL) umbenannt, hatte wesentlichen Anteil an der positiven Entwicklung des Sports nach dem Ersten Weltkrieg. Viele verschiedene Verbände waren Mitglieder im DRA, wie zum Beispiel der „Verband Deutscher Sportlehrer“ oder der „Deutsche Turnlehrerverband“, sowie Vertreter von Behörden und Hochschulen, so dass in vielen Bereichen Reformen und Initiativen durchgesetzt werden konnten.
Die Wiederaufnahme von Leibesübungen in allen gesellschaftlichen Bereichen wurde als „[...]Zeichen beginnenden Wiedererwachens alter deutscher Volkskraft[...]“5 angesehen. Sämtliche Vereine und Verbände konnten ab 1919 einen rasanten Mitgliederzuwachs verzeichnen. Obwohl auch die Sportverbände nicht von den politischen und vor allem wirtschaftlichen Problemen verschont blieben, wurden immer mehr Übungs- und Wettkampfstätten errichtet. 1920 überreichte der DRA dem Reichstag einen Gesetzentwurf über den Erlass eines „Reichsspielplatzgesetzes“, dass den Ländern und Kommunen den Bau von Übungsplätzen, Sporthallen und Schwimmbädern gemäß ihrer Einwohnerzahl vorschreiben sollte. Solch ein Gesetz wurde zwar nie beschlossen, trotzdem wurde der Vorschlag von vielen Verantwortlichen aus Politik und Sport als richtungsweisend erachtet und so auch ohne gesetzliche Grundlage in die Tat umgesetzt.6 Des weiteren konnte der DRA eine staatliche Förderung von Sportvereinen und -verbänden erreichen, welche sich durch Zuschüsse, Steuerbefreiungen sowie auch Fahrpreisermäßigungen bemerkbar machte.
Mit dem wachsenden gesellschaftlichen Stellenwert von Sport und Leibeserziehung wurde auch der Ruf nach qualifizierten Übungsleitern und der wissenschaftlichen Erforschung damit verbundener Probleme und Zusammenhänge in Theorie und Praxis lauter. Die Sportwissenschaft entwickelte sich. An den Universitäten wurden Institute für Leibeserziehung eingerichtet, an einigen Schulen versuchsweise die tägliche Turnstunde eingeführt. Wie die Deutschen Turner (DT) war auch der DRA bemüht, die wachsende Begeisterung für Leibesübungen auf das gesamte Volk zu übertragen, indem sportliche Wettkämpfe als Massenveranstaltungen inszeniert wurden. So waren bei den ab dem Jahre 1920 veranstalteten Reichsjugendwettkämpfen die rasanten Entwicklungen im Bereich der Leibesübungen zu beobachten. Nahmen bei der ersten Veranstaltung 1920 noch 45.000 Jugendliche teil, so waren es 1922 schon 105.000, im Jahr 1928 schließlich sogar 350.000 Teilnehmer. Um nicht nur das Körperbewusstsein der Jugendlichen zu entwickeln, sondern auch ein Staatsbewusstsein und ein Politikverständnis zu fördern, wurden die Reichsjugendwettkämpfe jedes Jahr am Weimarer Verfassungstag, dem 11. August, abgehalten. Auch das 1912 eingeführte Deutsche Turn- und Sportabzeichen, für das im Laufe der Jahre immer mehr Männer Frauen und Jugendliche eine Prüfung ablegten, wurde erweitert. In dieser Frage gab es einige Unstimmigkeiten mit den Deutschen Turnern und einigen anderen Sportverbänden, da diese mit der Verleihung des Sportabzeichens in Bronze, Silber und Gold die Gefahr sahen, dass „die Jugend in einem Geist erzogen werde, in dem die Jugend daran gewöhnt wird, sich den Mühen, Höchstleistungen zu erzielen, nur deshalb unterziehe, damit sie dafür durch äußere Zeichen und Ehren belohnt wird“.7 So konnten die seit dem 19. Jahrhundert bestehenden Differenzen zwischen den Deutschen Turnern und dem Deutschen Reichsausschuss auch in der „Sportlichen Blütezeit“ der Weimarer Republik nicht beseitigt werden. Dies führte dazu, dass der DT 1925 seine Mitgliedschaft im DRA abgab und die Zusammenarbeit beendete. Doch es gab eine Sache, an der der DRA und die Turner trotz des schwierigen Verhältnisses weiter zusammenarbeiteten: die Deutschen Kampfspiele.
4. Die Entwicklungen der internationalen Sportbeziehungen nach dem 1. Weltkrieg
4.1 Der Ausschluss aus der olympischen Bewegung
Pierre de Coubertin, der damalige Präsident des IOC, hatte den Sitz seines Komitees 1917 nach Lausanne verlegt, um es aus den Kriegeshandlungen herauszuhalten. Gleich nach Kriegsende bemühte er sich um ein schnelles Treffen des Komitees, zum Einen, um dem 25- jährigen Bestehen der olympischen Bewegung zu gedenken, und zum Anderen, um die Situation und Position der olympischen Bewegung nach Ende des Krieges in Europa und den damit verbundenen Differenzen zu den Kriegsgegnern zu definieren. Coubertin war vom
Überleben des olympischen Gedankens überzeugt und setzte sich aus diesem Grund für eine schnelle Wiederaufnahme der olympischen Sportwettkämpfe ein.
So wurden der auf 17. Session des IOC im April 1919 in Lausanne die Olympischen Spiele für 1920 nach Antwerpen vergeben. Bereits im Jahre 1913 hatte sich eine belgische Delegation um die Bewerbung Antwerpens bemüht und 1914 ebenso wie Rom, Budapest und Amsterdam eine offizielle Kandidatur für die 7.Olympischen Spiele vorgelegt. Für die 6. Olympischen Spiele 1916 stand zu dem damaligen Zeitpunkt bereits Berlin fest, die Durchführung war aber durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges unmöglich geworden. Die Delegierten des IOC waren sich einig, dass Olympische Spiele zusammen mit Sportlern der ehemaligen Kriegsgegner nicht zu vereinbaren waren. Das IOC umgingen die Problematik einer offiziellen Suspendierung der Mittelmächte damit, dass sie beschlossen, nur die Länder zu den Olympischen Spielen einzuladen, die mit einem Vertreter im IOC vertreten waren. Da die deutschen Vertreter im Krieg gefallen waren, hatte sich dieses Problem praktisch von selbst gelöst, Österreich, Ungarn, die Türkei und Bulgarien wurden jedoch offiziell suspendiert.
In dieser Nachkriegszeit brach das IOC mit sämtlichen olympischen Idealen, für deren Einhaltung Pierre de Coubertin jahrelang gekämpft hatte. Weder die olympische Friedensbewegung wurde geachtet, noch einer von den USA angeregten und 1919 in Paris auch durchgeführten „Olympiade der Siegermächte“ widersprochen. Zumindest konnte Coubertin die vom amerikanischen General und Schirmherr dieses Sportfestes Pershing geforderte nachträgliche Anerkennung der „Olympiade der Siegermächte“ als offizielle Olympische Spiele, verhindern.8
4.2 Antwerpen 1920 - Olympische Spiele ohne deutsche Beteiligung
Schon im Vorfeld der Olympischen Spiele waren Stimmen laut geworden, die eine so rasche Wiederaufnahme der olympischen Wettkämpfe kritisierten. Begründet wurde dies mit der instabilen politischen Lage in Europa, den wirtschaftlichen Problemen und den vielen Kriegsgefallenen, die große Löcher in die Sportmann-schaften vieler Länder gerissen hatten. Doch zumindest der letzte Punkt zählte für Coubertin nicht, da bei der Entente-Olympiade 1919 bereits einige respektable sportliche Leistungen gezeigt wurden, die auf zumindest sportlich hochklassige Olympische Spiele hoffen ließen.
Diese Hoffnung wurde auch dadurch bestätigt, dass sich in Antwerpen einige neue Größen des Sports ins Rampenlicht kämpfen konnten. Bestes Beispiel hierfür waren die Erfolge des finnischen Leichtathletik-Mannschaft, angeführt vom überragenden Paovo Nurmis, der zusammen mit seinem Team neun Goldmedaillen erringen konnte, ebenso viele wie die in den Jahren zuvor so dominierenden US-Amerikaner.
Die Antwerpener Spiele wurden am 23.April 1920 mit der Winterspielwoche eröffnet und endeten nach den Sommerspielen am 12.September.
Trotz aller Probleme kann man die Spiele insgesamt als Erfolg bezeichnen, denn „die Olympischen Spiele von Antwerpen zeigten mit ihrer feierlichen Würde, dass die olympische Bewegung den Krieg gut überstanden hatte. Nach Coubertin lag der Beitrag vor allem darin, das allseitige Verständnis, die Gewissheit, nunmehr überall verstanden zu werden, erreicht zu haben.“9
Daran ist zu erkennen, dass auch das IOC versuchte, aus der Suspendierung der Mittelmächte keinen großen Skandal zu machen, um den aus der Sicht des IOC noch nicht vernichteten „Olympischen Gedanken“ wiederaufleben zu lassen und vor politischen Einflüssen zu schützen.
4.3 Die Reaktionen in Deutschland und die Verwirklichung des Kampfspielgedankens
Eine offizielle Reaktion aus Deutschland oder von Seiten des DRA auf die Suspendierung aus der internationalen olympischen Bewegung gab es nicht. Auch der Ablauf der 7.Olympischen Spiele in Antwerpen fand in der deutschen Presse kaum Beachtung.
Für viele Vertreter der Sportverbände und auch für den Reichsausschuss war eine Teilnahme an internationalen Sportwettkämpfen zu diesem Zeitpunkt undenkbar. Dies lag vor allem auch an den harten Bedingungen des Versailler Vertrags, der einen weiteren Keil in die schon schwierigen politischen Beziehungen zum Nachbarn Frankreich geschlagen hatte. Doch ging es nicht nur um die politische Brisanz der Nachkriegszeit, vor allem die Vernichtung des olympischen Gedankens durch die Kriegshandlungen unterstützen die Abwendung des DRA vom internationalen Olympismus und steuerten die Konzentration auf die Veranstaltung eines nationalen Sportfestes im eigenen Land.
Befasst man sich genauer mit den Entwicklungen, die schließlich zur Durchführung der Deutschen Kampfspiele führten, wird spätestens an diesem Punkt klar, dass man nicht nur die Geschehnisse im Rahmen der Suspendierung Deutschlands durch den IOC betrachten darf, sondern dass die Initiativen zur Durchführung eines nationalen Sportfestes in dieser Größe schon viel früher begannen.
5. Die Entwicklung des Kampfspielgedankens vor und während des 1. Weltkrieges
Bemühungen um die Durchführung nationaler Sportfeste gab es wohl schon viele Jahre früher. Das größte war das seit 1860 zur „Demonstration der Einheit und Kraft des deutschen Volkes“10 veranstaltete „Deutsche Turnfest“11. Auch die seit 1872 durchgeführten „Sedanfeste“12, die an den Sieg über die Franzosen bei Sedan 1870 erinnern sollten, werden heute als Vorbild und Vorläufer der Deutschen Kampfspiele angesehen. Doch der Begriff der „Deutsche Kampfspiele“ findet seinen Ursprung wohl im Jahr 1911. In diesem Jahr gründeten nationalistische Vertreter der Deutschen Turner und der deutschen Sportverbände den „Deutschen Kampfspielbund“ (DKB), der sich das Ziel gesetzt hatte, ein großes Sportfest auf nationaler Ebene zu organisieren. Doch dem Kampfspielbund fehlte die direkte Bindung zum weit einflussreicheren DRA, so dass die Bemühungen zunächst ohne Erfolg blieben. Da aber auch in der Satzung des 1904 gegründeten „Deutschen Reichsausschusses für Olympische Spiele“ (DRAfOS) stand, dass es Aufgabe des Ausschusses war, nationale Olympische Spiele zu schaffen, rückten der DKB und der DRA mit ihren Interessen mit der Zeit immer näher zusammen. In den Jahren zuvor waren auch die Mitglieder des DRA von der Idee Coubertins für Internationale Olympische Spiele unter dem Vorbild griechischen Antike begeistert. Als der Krieg ausbrach waren diese Bemühungen aber für die nächsten Jahre vorerst beendet. Bereits 1913 fasste der DRA schließlich den Beschluss, ein nationales Sportfest unter dem Namen „Deutsche Kampfspiele“ erstmals 1915 zu veranstalten, sozusagen auch als „Generalprobe für die 6.Olympischen Spiele in Berlin. Letztendlich verhinderte der Erste Weltkrieg die Durchführung beider Spiele. So beschloss der Wettkampfausschuss des DRA am 10.2.1916, dass die Deutschen Kampfspiele erstmals zwei Jahre nach Kriegsende in der Reichshauptstadt Berlin stattfinden sollten. Im Rahmen dieser Sitzung wurde auch klar formuliert, welchem Zweck die Deutschen Kampfspiele in erster Linie dienen sollten:
[...]„Die Deutschen Kampfspiele sollen durch ihre Wiederkehr in jedem vierten Jahr eine dauernde Einrichtung werden. In ihnen sollen sich alle deutschen Leibesübungen treibende Verbände zu einer machtvollen einheitlichen Kundgebung vereinigen. In ihnen erblickt der DRA das deutsche Volksfest der Zukunft als Ausdruck einer deutschen Volkseinheit, der leiblichen Kraft und Gewandtheit unserer Jugend und ihres stolzen und hochgemuten Sinnes. Deutsche Sitte, deutsches Fühlen, deutsches Lied, deutsche Kunst, all dies soll in ihm Ausdruck finden.“[...]13
Zu diesem Zeitpunkt glaubten alle Mitglieder des DRA und auch das deutsche Volk an ein siegreiches Ende des Ersten Weltkrieges und somit auch an den Erhalt der Monarchie. Doch auch nach dem Fall des Deutschen Kaisers im Rahmen der Novemberrevolution 1918 und trotz der innenpolitischen Krisen und Probleme der Weimarer Zeit fand die patriotische und nationalistische Überzeugung zur Durchführung nationaler deutscher Kampfspiele keinen Abbruch.
Im Jahre 1917 war dann der Begriff der „Olympischen Spiele“ auch aus dem Namen des Reichsausschusses verschwunden, der sich in den „Deutschen Reichsausschuss für Leibesübungen“ (DRAfL) umbenannte. Auf dieser Sitzung wurde auch beschlossen, dass die für 2 Jahre nach Kriegsende vorgesehenen 1. Deutschen Kampfspiele fortan alle vier Jahre in Berlin stattfinden sollten. Die Bemühungen des Deutschen Kampfspielbundes waren also erfolgreich und die Zusammenarbeit mit dem DRA fand in dem Übergang des DKB in den DRA im Jahr 1919 ihren Höhepunkt.
Auch die Deutschen Turner, die zu Beginn der Bemühungen des DKB und des DRA die Deutschen Kampfspiele nur „als unerwünschtes Gegenstück zum Deutsche Turnfesten“14 ansahen, wollten in großer Zahl an den Kampfspielen teilnehmen.
Finanzielle Probleme verhinderten im Jahre 1921 die Durchführung der Kampfspiele, so dass sie eine weiteres Mal um ein Jahr verschoben werden mussten.
6. Die Durchführung der Deutschen Kampfspiele
6.1 Die 1. Deutschen Kampfspiele 1922 in Berlin
Nach diesen Entwicklungen kam es dann 1922 tatsächlich zu der Durchführung der 1. Deutschen Kampfspiele in Berlin. Nach dem Willen von Carl Diem sollten sich die Spiele bezüglich des Zeremoniells und des Ablaufs in vielen Bereichen an den Olympischen Spielen orientieren.
Für die Kampfspiele war von vornherein eine Zweiteilung in Winter- und Sommer-spiele vorgesehen, an denen nur Deutsche und Deutschstämmige aus aller Welt teilnehmen durften. Die Winterspiele, bei denen insgesamt 800 Sportler an den Start gingen, darunter 66 Frauen, wurden in Garmisch und Partenkirchen ausgetragen und begannen am 21.Januar 1922 in Rißersee mit Deutschen Meisterschaften in den Disziplinen Eiskunstlauf (Damen und Herren), Bobfahren, Eishockey und Eisschnelllauf. Erst nach Ende dieser Wettkämpfen erfolgte am 23. Januar 1922 die Eröffnung der offiziellen Kampfwettspiele. Hierbei wurde auch Österreichern, Tirolern und Deutsch-Böhmen die Teilnahme an den sportlichen Wettkämpfen genehmigt. Es wurde in den Disziplinen Eiskunstlauf, Bobfahren, Rodeln, Eishockey, Eisschnelllauf und Nordischer Skilauf um den Sieg gekämpft.
Trotz großer Gemeinsamkeiten mit internationalen Olympischen Spielen gab es doch einige bedeutende Unterschiede. Frauen waren neben dem Eiskunstlauf in vielen weiteren Disziplinen zugelassen, wie zum Beispiel im Rodeln und Skilanglauf, was bei Olympischen Spielen erst mehrere Jahrzehnte später eingeführt wurde. Des weiteren gab es Wettkämpfe in vielen Junioren-, Alters- und Leistungsklassen. Bei der Abschlussfeier der Winterspiele am 29. Januar 1922 erhielten alle siegreichen Athleten eine Kampfspielplakette in Bronze, Silber oder Gold. Alle weiteren Teilnehmer wurden mit Erinnerungsmedaillen geehrt.
Eine Segelregatta am 25. Mai 1922 eröffnete die Sommerspiele der 1. Deutschen Kampfspiele in Berlin, zwei Wochen später folgten die Kanu-Wettbewerbe, bevor dann am 18. Juni 1922 der Hauptabschnitt mit den Disziplinen Fußball, Tennis, Rugby, Golf und Handball, und schließlich auch Rudern und Turnen, eröffnet wurde. Im Anschluss an diese Wettkämpfe wurde die erste Wettkampfwoche mit einem großen Hauptfesttag abgeschlossen, an dem die Sieger der bereits ausgetragenen Wettkämpfe, die Vertreter der Auslandsdeutschen15 die Vertreter der Sportverbände sowie 5000 Mitglieder der Deutschen Turner (DT) im Stadion einmarschierten.
Danach folgte neben der Ehrung der Sieger eine beindruckende Vorführung von über 4000 Turnern, welche bei den Zuschauern großen Anklang fand. Als Abschluss dieses Festtages hielt der Präsident des Deutschen Reichsausschusses (DRA), eine Festrede. „Deutsche Kampfspiele! Möget ihr fortwirken von vier zu vier Jahren, ein Wahrzeichen deutscher Volkskraft, ein Ausdruck deutschen Volkstums, eine immer sich fortsetzende Kette, ver- schlungen in eine schönere deutsche Zukunft!“16
Mit diesen Worten schloss Theodor Lewald seine Festrede, und seine Worte drücken sehr deutlich aus, dass für ihn und das gesamte deutsche Volk die Kampfspiele mehr als nur ein Olympia-Ersatz und ein sportlicher Wettkampf waren, sondern vielmehr auch ein Zeichen wiedererwachter Volkskraft.
In der zweiten Kampfspielwoche wurden Wettkämpfe in den Disziplinen Radfahren, Boxen, Ringen, Fechten , Schießen, Schwimmen, sowie Schwer- und Leichtathletik ausgetragen. Wie die erste Woche endete auch der zweite Teil der Sommerspiele mit einer Schlussfeier sowie einer Rede Theodor Lewalds.
Die Durchführung der 1.Deutschen Kampfspiele 1922 in Berlin war bis kurz vor der Eröffnung der Winterwoche am 21.1.1922 von der desolaten wirtschaftlichen Lage des Deutschen Reiches gefährdet. Sie waren bereits einmal um ein Jahr verschoben worden, und die geplanten Kunstwettbewerbe in Malerei, Dichtung, Architektur und Gesang fielen der finanziellen Notlage zum Opfer. Dagegen kann man die Deutsche Sportausstellung, die vom 15. Juni bis zum 2. Juli auf Vorschlag Carl Diems organisiert und die in diesem Zeitraum von etwa 35.000 Menschen besucht wurde, durchaus als Erfolg bezeichnen.
6.2 Die Deutschen Kampfspiele 1926 und 1930
1926 waren die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in der Weimarer Republik weitgehend stabilisiert, so dass die Rahmenbedingungen von vornherein weit besser waren als vier Jahre zuvor in Berlin. Jedoch hatten die Spiele durchaus eine beachtliche politische Brisanz, da sie nicht wie eigentlich vorgesehen in Berlin stattfanden, sondern im bis kurz zuvor noch von den Franzosen besetzten Rheinland. Zu dem Schritt, auf Einladung des damaligen Kölner Oberbürgermeisters Konrad Adenauer die Kampfspiele an die Westgrenze des Reiches zu verlegen, entschied sich der DRA auch, „um den Deutschen Kampfspielen eine Integrationsfunktion für das gesamte deutsche Volk [...] und für ein Nationales Olympia als anti-französische Antwort auf die Idee internationaler Olympischer Spiele“17 zu verleihen. So wurden die sportlichen Wettkämpfe der 2.Deutschen Kampfspiele auch zu einem „Befreiungsfest dieses Teils der Rheinlande“.18
Die Winterspiele fanden diesmal im Zeitraum vom 23. Januar 1926 bis zum 31. Januar 1926 in Titisee (Eiskunstlauf, Bobfahren) und Triberg (Eishockey, Eisschnelllauf, Eisschießen und Rodeln) statt. Die für den 12. bis 14. Februar in Partenkirchen geplanten Skiwettbewerbe fielen wegen Schneemangel aus.
Die Sommerspiele auf den Sportanlagen rund um das Müngersdorfer Stadion in Köln fanden vom 4. bis zum 11. Juli 1926 statt. Es wurden in zwanzig Disziplinen um den Sieg gekämpft, doch das Besondere an den 2.Deutschen Kampfspielen waren nicht nur die sportlichen Wettbewerbe. Das Ereignis, dass den meisten Sportlern und besonders den Zuschauern im Gedächtnis blieb, war der große Fackelzug am Rheinufer, der am Abend des 3.Juli zur Eröffnung veranstaltet wurde, und „an dem sich 10.000 Sportler beteiligten, 200.000 Zuschauer sollen an den Straßen gestanden haben: So ward das Fest aller Deutschen am Rhein eingeleitet.“19
1930 fanden die Spiele an der Ostgrenze des Reiches statt, die Winterspiele vom 11. bis zum 19. Januar in Krummhübel (Riesengebirge), die Sommerspiele vom 25. bis zum 29. Juni in Breslau. Diese Spiele fielen wie die Spiele 1922 in Berlin in eine Zeit wirtschaftlicher Instabilität, der sportliche Verlauf oder Ereignisse rund um die 3. Deutschen Kampfspiele finden in der Literatur kaum Erwähnung.
Auch 1934 und 1938 wurden noch Wettkämpfe unter dem Namen „Deutsche Kampfspiele“ veranstaltet. Diese gerieten jedoch unter den Einfluss der Nationalsozialisten und ihre eigentliche Aufgabe der Integration des deutschen Volkes wurde überspitzt dargestellt und zur Propaganda benutzt. „Damit fand das Nationale Olympia sein Ende.“20
7. Auf der Suche nach den Ursprüngen des Kampfspielgedankens im 18. und 19. Jahrhundert
In der Literatur werden viele verschiedene Namen genannt, die als Initiatoren oder „Urväter“ des Kampfspielgedankens angesehen werden. Klaus Scholven hat sich im Jahre 1980 im Rahmen seiner Diplomarbeit21 sehr ausführlich mit dieser Frage beschäftigt und sich auf eine intensive Suche nach Personen gemacht, die zu ihrer Zeit eine Meinung vertraten, die der des Kampfspielgedankens entsprach und die somit auch als Vorbild für diesen genommen wurden.
Johann Christoph Friedrich Guts Muths, Pädagoge und Lehrer für Geographie, Technologie, Französisch und Gymnastik, veröffentlichte 1795 eine Schrift unter dem Namen „Gymnastik für die Jugend“ in der er Leibesübungen und körperliche Ertüchtigung als ein Teil des Gesamterziehungssystems erachtete. In diesem Rahmen befürwortete er die Durchführung von großen Sportfesten für das gesamte Volk unter dem Vorbild der Olympischen Spiele der Antike: „[...]Diese öffentlichen Spiele vorzüglich waren es, die den Nationalgeist unterhielten, den Jüngling von Weichlich-keit zurückzogen, ihm Mannsinn einflößten, ihn zum Heroen bildeten [...]“.22
Hervorzuheben ist, dass Guts Muths wie kein Anderer seiner Zeit schon erkannte, welchen nationalen Wert und welche nationale Wirkung „Nationalfeste“ haben können: „[ ]Sie haben etwas Großes, Herzerhebendes, so viel Kraft auf den Nationalgeist zu wirken, das Volk zu leiten, ihm Patriotismus einzuflößen, sein Gefühl für Tugend und Rechtschaffenheit zu erhöhen und einen gewissen edlen Sinn selbst unter den niedrigsten Volksklassen zu verbreiten, dass ich sie für eine Haupterziehungsmittel halte[...]“23
Ähnliche Ausführungen findet man in den Schriften des Preußischen Generalfeldmarschalls August Neithard von Gneisenau. Im Jahre 1807 forderte er in seiner Schrift „Militärische Organisation der Schulen im Land“ das Erziehungssystem zu reformieren und Leibesübungen mit einzubeziehen , die auf Krieg und Abhärtung zielen. Zu diesem Zweck befürwortete Gneisenau auch die Einführung von Nationalfesten, die auch den allgemeinen Gesundheitszustand der Jugend verbessern sollten.
Etwa zur gleichen Zeit veröffentlichte Friedrich Ludwig Jahn eine Schrift unter dem Namen „Das deutsche Volksthum“. Jahn, der als Begründer und Urvater des Deutschen Turnens gilt, hatte von Anbeginn seiner Initiativen zur körperlichen Ertüchtigung des ganzen Volkes versucht, Leibesübungen in Verbindung mit politische Idealen zu bringen. Wie Guths Muts und Gneisenau vor ihm war Jahn von der Bedeutung von Nationalfesten überzeugt. Er sah in ihrer Durchführung neben der politischen Bedeutung und der nationalen Wirkung auf das Volk durch Abbau von Standesschranken vor allem auch die sportliche Bedeutung.24 Diesem Ideal folgten auch die von 1860 bis 1923 in unregelmäßigen Abständen durchgeführten „Deutschen Turnfeste“.
Auch die Deutschen Kampfspiele, die erst viele Jahre später ins Leben gerufen wurden, sollten neben der sportlichen Auseinandersetzung vor allem eine nationale Wirkung und eine Integrationsbedeutung für das gesamte Volk mit sich bringen.
8. Schlussbetrachtung
Die Durchführung der Deutschen Kampfspiele kann man ohne Zweifel als einen, nicht nur aus sportlicher Sicht, großen Erfolg bezeichnen. Trotz aller innen-, außen- und wirtschaftspolitischer Probleme konnten sie wie 1917 vom DRA beschlossen alle vier Jahre durchgeführt werden, und waren vor allem für das Deutsche Volk ein Zeichen wiedererstarkten Volkstums, dass vor allem durch die Kriegsniederlage und die innenpolitischen Krisen der Weimarer Zeit stark erschüttert war. Anhand der in dieser Arbeit aufgezeigten Entwicklungen ist auch zu erkennen, dass sie weitaus mehr waren als nur eine Antwort auf den Ausschluss aus dem IOC im Jahre 1919, denn die Ideen und Initiativen zur Durchführung solcher Spiele begannen viele Jahre zuvor. Die Suspendierung war vielmehr der letzte Anstoß, sich auf ein eigenes nationales Sportfest zu konzentrieren.
Die Integrationsbedeutung und die nationale Wirkung auf das deutsche Volk waren beachtlich, dies ist wohl auch daran zu erkennen, dass die Kampfspiele auch nach der Aussöhnung des DRA mit dem IOC und der Teilnahme eine deutschen Mannschaft an den Olympischen Spielen 1928 in Amsterdam noch bis ins Jahr 1938 durchgeführt wurden, auch wenn sie durch den nationalsozialistischen Einfluss ihre eigentliche Bedeutung verloren hatten.
In verschiedenen Äußerungen Carl Diems25 ist jedoch durchaus zu erkennen, dass für ihn persönlich die Deutschen Kampfspiele nur ein Ersatz für internationale Olympischer Spiele waren, was für ihn jedoch kein Grund war, die Initiativen zur Durchführung der Kampfspiele nicht zu unterstützen. Er war vielmehr ein wichtiger Fürsprecher, der jedoch die Möglichkeit einer zukünftigen Wiederaufnahme der internationalen Sportbeziehungen im olympischen Rahmen stets im Hinterkopf behielt.
Die Annährung der beiden durch den Krieg getrennten Organisationen des IOC und des DRA fand in erster Linie über den Kontakt zwischen Carl Diem und Pierre de Coubertin statt, die sich bereits 1922 in einem Briefverkehr26 austauschten.. Eine Teilnahme an den olympischen Spielen 1924 in Paris wäre so durchaus denkbar geworden, da diese Spiele jedoch in Paris stattfanden, stand für den DRA fest, dass eine Versendung einer deutschen Mannschaft nach Frankreich so kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges unmöglich war.27 Da an den Kampfspielen Sportler aus allen Verbänden und vor allem auch aus der Deutsche Turnerschaft teilnahmen, wird deutlich, dass sie ihren Zweck, nationale Spiele aller Deutschen zu sein, erfüllt hatten.
9. Literaturverzeichnis
BEYER, Erich, „Sport in der Weimarer Republik“, in: Horst UEBERHORST (Hrsg.),
Geschichte der Leibesübungen, Bd. 3/2: Leibesübungen und Sport in
Deutschland vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart, Berlin/München/Frankfurt 1981, S. 657-700
DER SPORTBROCKHAUS - Alles vom Sport von A-Z, Wiesbaden, 1971
DIEM, Carl, „Die Deutschen Kampfspiele 1922“, in: Carl-Diem-Inst.e.V. (Hrsg.),
Carl Diem- Ausgewählte Schriften, Bd.3, Beiträge zur Entwicklung und Organisationdes Sports, St. Augustin 1982, S.157-160.
DIEM, Carl, Ein Leben für den Sport, Ratingen /Kastellaun/ Düsseldorf, 1982
LENNARTZ, Karl, „Die Zeit der Weimarer Republik“, in: Manfred LÄMMER (Hrsg.) Deutschland in der olympischen Bewegung. Eine Zwischenbilanz,
Frankfurt/Main 1999, S. 85-118
KRÜGER, Arnd, „Deutschland und die olympische Bewegung (1918-1945)“ in: Horst
UEBERHORST (Hrsg.), Geschichte der Leibesübungen, Bd. 3/2: Leibesübungen undSport in Deutschland vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart, Berlin/München/Frankfurt 1981, 1026-1047
MÜLLER, Norbert/GESSLER, Sabine, „Olympische Spiele im Schatten des Ersten
Weltkriegs“, in: Norbert MÜLLER/Manfred MESSING (Hrsg.), Auf der
Suche nach der olympischen Idee. Facetten der Forschung von Athen bis Atlanta, Kassel 1996, S. 135-156
NAUL, Roland, „Nationales Olympia und Deutsche Kampfspiele“. In: Manfred
LÄMMER (Hrsg.), Deutschland in der olympischen Bewegung. Eine Zwischenbilanz, Frankfurt/Main 1999, S. 25-35
SCHOLVEN, Klaus, Die 1.„Deutschen Kampfspiele“1922- Ihr Entstehen, Verlauf und ihre Resonanz, Diplomarbeit DSHS Köln, Köln 1980
10. Anhang
Abb. 1:
arl Diem (1882-1962)
- Vorsitzender der Deutschen Sportbehörde für Athletik (1908-1913).
Generalsekretär des DRAfOS, ab 1917 des DRA (1913-1933).
- Gründer und Rektor der DSHS Köln (1947-1962)
Abb. 1 entnommen aus:
EBERHORST, Horst, Geschichte der Leibesübungen, Bd. 3/2,
Leibesübungen und Sport in Deutschland vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart, Berlin u. a. 1981,S. 677.
Abb. 2:
akat der Deutschen Kampfspiele 1922 in Berlin
Abb. 2 entnommen aus:
Original entnommen aus: Deckblatt.
Abb. 3:
SCHOLVEN, Klaus, Die 1. Deutschen Kampfspiele 1922 - IhrEntstehen, Verlauf und ihre Resonanz, Diplomarbeit DSHS Köln , Köln 1980, Anhang.
DIEM, Carl, Deutsche Kampfspiele 1922, Berlin 1922,
akat der 2. Deutschen Kampfspiele 1926 in Köln
Abb. 3 entnommen aus:
Abb. 4:
LÄMMER , Manfred (Hrsg), Deutschland in der Olympischen Bewegung - Eine Zwischenbilanz, Frankfurt/Main 1999, S. 34.
rief von Carl Diem an Pierre de Coubertin, 1922
Abb. 4 entnommen aus: LÄMMER , Manfred (Hrsg), Deutschland in der Olympischen
Bewegung - Eine Zwischenbilanz, Frankfurt/Main 1999, S. 93.
Deutsche Sporthochschule Köln
Institut für Sportgeschichte
Seminar
„Deutschland in der olympischen Bewegung“
Wintersemester 2003/04
Die „Deutschen Kampfspiele“-
Deutschlands Antwort auf den Ausschluss aus der olympischen Bewegung nach dem Ersten Weltkrieg
eine Arbeit von
Silvio Catuogno
[...]
1 DER SPORTBROCKHAUS - Alles vom Sport von A-Z, Wiesbaden, 1971
2 1917-1920 Präsident der Republik Frankreich.
3 ab 1920 Vors. der Reparationskommission, 1922-24 Ministerpräsident und Außenminister, 1926-1929 Ministerpräsident und Finanzminister Frankreichs.
4 E. BEYER, „Sport in der Weimarer Republik“, in: H. UEBERHORST (Hrsg.), Geschichte der Leibesübungen Bd 3/2, Leibesübungen und Sport in Deutschland vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart, Berlin u. a. 1981, S. 658.
5 Tätigkeitsbericht des DRA 1919-1920, zit. n. E. BEYER, „Sport in der Weimarer Republik“, S. 661.
6 Vgl. E. BEYER, „Sport in der Weimarer Republik“, S. 663.
7 E. BEYER, „Sport in der Weimarer Republik“, S. 673.
8 K. LENNARTZ, „Die Zeit der Weimarer Republik“, in: M. LÄMMER, Deutschland in der olympischen Bewegung - Eine Zwischenbilanz, Frankfurt/Main 1999, S. 91.
9 A. KRÜGER, „Deutschland und die olympische Bewegung“, in H. UEBERHORST, Geschichte der Leibesübungen Bd. 3/2, Leibesübungen und Sport in Deutschland vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart, Berlin /München /Frankfurt 1981, S. 1027.
10 Vgl. E. BEYER, „Sport in der Weimarer Republik“, S. 673.
11 Vgl. E. BEYER, „Sport in der Weimarer Republik“, S. 673.
12 R. NAUL, „Nationales Olympia und Deutsche Kampfspiele“, in: M. LÄMMER (Hrsg.), Deutschland in derolympischen Bewegung – Eine Zwischenbilanz, Frankfurt/Main 1999, S. 25.
13 E. BEYER, „Sport in der Weimarer Republik“, S. 678.
14 C. DIEM, „Der Lebensbau, Kap.1, Deutsche Kampfspiele“, in: CARL-DIEM-INSTITUT (Hrsg.), Carl Diem - Ein Leben für den Sport, Ratingen u.a. 1974, S. 108.
15 Es nahmen Auslandsdeutsche aus Böhmen, Siebenbürgen, Chile, Spanien und Argentinien an den Wettkämpfen 1922 teil.
16 K. LENNARTZ, „Die Zeit der Weimarer Republik“, S. 88.
17 R. NAUL, „Nationales Olympia und Deutsche Kampfspiele“, in: M. LÄMMER, Deutschland in der olympischen Bewegung- Eine Zwischenbilanz, Frankfurt/Main 1999, S. 34.
18 Tätigkeitsbericht des DRA 1925-26, zit. n. E. BEYER, „Sport in der Weimarer Republik“, S. 679.
19 K. LENNARTZ, „Die Zeit der Weimarer Republik“, S. 89.
20 K. LENNARTZ, „Die Zeit der Weimarer Republik“, S.89.
21 K. SCHOLVEN, Die 1.Deutschen Kampfspiele 1922 - Ihr Entstehen, Verlauf und ihre Resona nz, Diplomarbeit DSHS Köln, Köln 1980.
22 K. SCHOLVEN, Die 1. Deutschen Kampfspiele 1922, S.6.
23 K. SCHOLVEN, Die 1. Deutschen Kampfspiele 1922, S. 7.
24 Vgl. K. SCHOLVEN, Die 1. Deutschen Kampfspiele 1922, S. 14-17.
25 Vgl. K. LENNARTZ, „Die Zeit der Weimarer Republik“, S. 87-88. 16
26 Vgl. K. LENNARTZ, „Die Zeit der Weimarer Republik“, S. 92-93. Siehe auch Anhang, Abb.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit über die Deutschen Kampfspiele?
Diese Arbeit untersucht die Ursprünge und die Entwicklung der Deutschen Kampfspiele. Es wird der Frage nachgegangen, ob die Kampfspiele lediglich ein "Olympia-Ersatz" nach dem Ausschluss Deutschlands aus der internationalen olympischen Bewegung nach dem Ersten Weltkrieg waren, oder ob ihre Wurzeln viel weiter zurückreichen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit den Entwicklungen nach dem Ersten Weltkrieg, einschließlich der politischen Situation im Deutschen Reich und der Entwicklung des Sports in der Weimarer Republik. Anschließend wird das Verhältnis Deutschlands zum Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und die daraus resultierenden Ereignisse erläutert. Danach wird die Entwicklung des "Kampfspielgedankens" vor und während des Ersten Weltkriegs untersucht. Es folgt eine Beschreibung der Deutschen Kampfspiele 1922, 1926 und 1930, um die Ursprünge des Kampfspielgedankens zu ergründen. Abschließend wird die Reaktion der deutschen Bevölkerung auf die Kampfspiele analysiert.
Welche Rolle spielte die politische Situation im Deutschen Reich nach dem Ersten Weltkrieg bei der Entwicklung der Kampfspiele?
Die politische Situation im Deutschen Reich nach dem Ersten Weltkrieg, geprägt von Krisen, innen- und außenpolitischen Problemen, sowie den harten Bedingungen des Versailler Vertrages, trug dazu bei, dass sich Deutschland von internationalen Sportveranstaltungen abwandte und sich auf die Veranstaltung nationaler Sportfeste konzentrierte. Die Gründung der Weimarer Republik und die daraus resultierenden politischen Lager führten zu einer Polarisierung, die auch den Sport beeinflusste.
Welche Rolle spielte Carl Diem bei der Entwicklung des Sports in der Weimarer Republik?
Carl Diem, Generalsekretär des Deutschen Reichsausschusses für Olympische Spiele (DRA) und später des Deutschen Reichsausschusses für Leibesübungen (DRAfL), hatte einen wesentlichen Anteil an der positiven Entwicklung des Sports nach dem Ersten Weltkrieg. Er setzte sich für Reformen und Initiativen ein, die die Wiederaufnahme von Leibesübungen in allen gesellschaftlichen Bereichen förderten.
Warum wurde Deutschland von den Olympischen Spielen ausgeschlossen?
Nach dem Ersten Weltkrieg beschloss das IOC, nur Länder zu den Olympischen Spielen einzuladen, die mit einem Vertreter im IOC vertreten waren. Da die deutschen Vertreter im Krieg gefallen waren, wurde Deutschland nicht eingeladen. Dies wurde oft als eine Art Suspendierung angesehen.
Was waren die Deutschen Kampfspiele?
Die Deutschen Kampfspiele waren ein nationales Sportfest, das als "Olympia-Ersatz" für Deutschland konzipiert wurde, nachdem das Land von den internationalen Olympischen Spielen ausgeschlossen worden war. Sie wurden erstmals 1922 in Berlin ausgetragen und sollten die Einheit und Kraft des deutschen Volkes demonstrieren.
Wo fanden die Deutschen Kampfspiele statt?
Die 1. Deutschen Kampfspiele fanden 1922 in Berlin statt. Die Spiele von 1926 wurden in Köln veranstaltet und die Spiele von 1930 in Breslau.
Welche Sportarten wurden bei den Deutschen Kampfspielen ausgetragen?
Die Deutschen Kampfspiele umfassten Winter- und Sommerspiele mit verschiedenen Disziplinen. Zu den Sportarten gehörten Eiskunstlauf, Bobfahren, Eishockey, Eisschnelllauf, Skilanglauf, Segeln, Kanu, Fußball, Tennis, Rugby, Golf, Handball, Rudern, Turnen, Radfahren, Boxen, Ringen, Fechten, Schießen, Schwimmen, Leichtathletik und Schwerathletik.
Was waren die Ursprünge des Kampfspielgedankens?
Die Ursprünge des Kampfspielgedankens reichen bis ins 18. und 19. Jahrhundert zurück, mit Einflüssen von Persönlichkeiten wie Johann Christoph Friedrich Guts Muths, August Neithard von Gneisenau und Friedrich Ludwig Jahn, die sich für Leibesübungen und Nationalfeste zur Stärkung des Nationalgeistes einsetzten.
Was war die Bedeutung der Deutschen Kampfspiele für das deutsche Volk?
Die Deutschen Kampfspiele waren mehr als nur ein sportlicher Wettkampf. Sie waren ein Zeichen wiedererwachter Volkskraft, das vor allem durch die Kriegsniederlage und die innenpolitischen Krisen der Weimarer Zeit stark erschüttert war. Sie hatten eine Integrationsbedeutung und eine nationale Wirkung auf das gesamte Volk.
Was geschah mit den Deutschen Kampfspielen nach 1930?
Auch 1934 und 1938 wurden noch Wettkämpfe unter dem Namen „Deutsche Kampfspiele“ veranstaltet. Diese gerieten jedoch unter den Einfluss der Nationalsozialisten und ihre eigentliche Aufgabe der Integration des deutschen Volkes wurde überspitzt dargestellt und zur Propaganda benutzt.
- Citar trabajo
- Silvio Catuogno (Autor), 2004, Die Deutschen Kampfspiele - Deutschlands Antwort auf den Ausschluss aus der olympischen Bewegung nach dem Ersten Weltkrieg, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109008