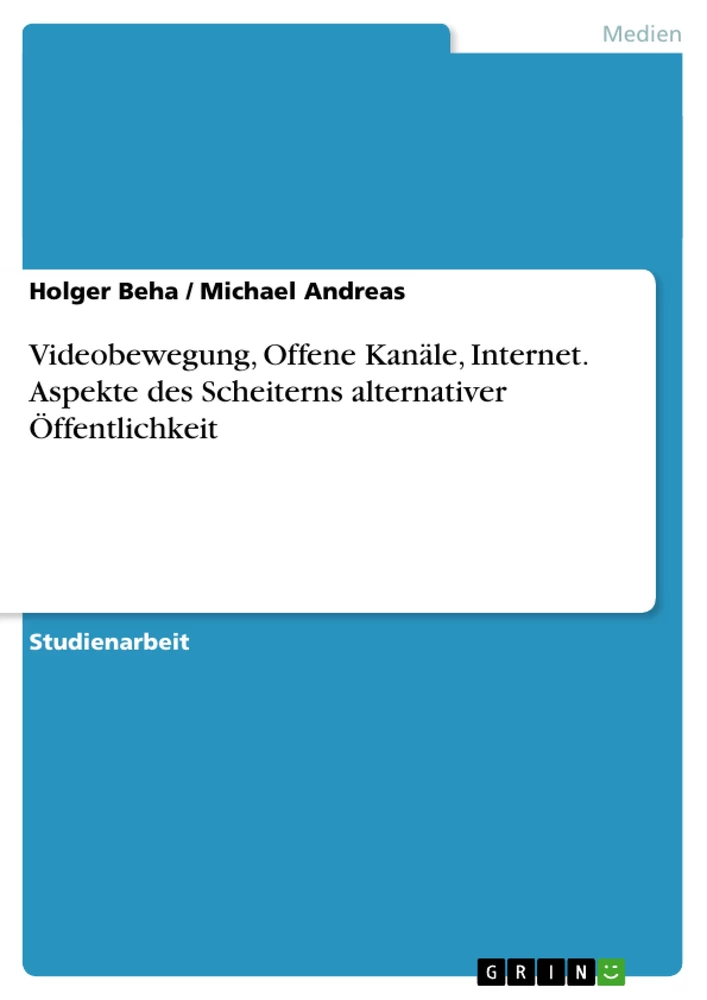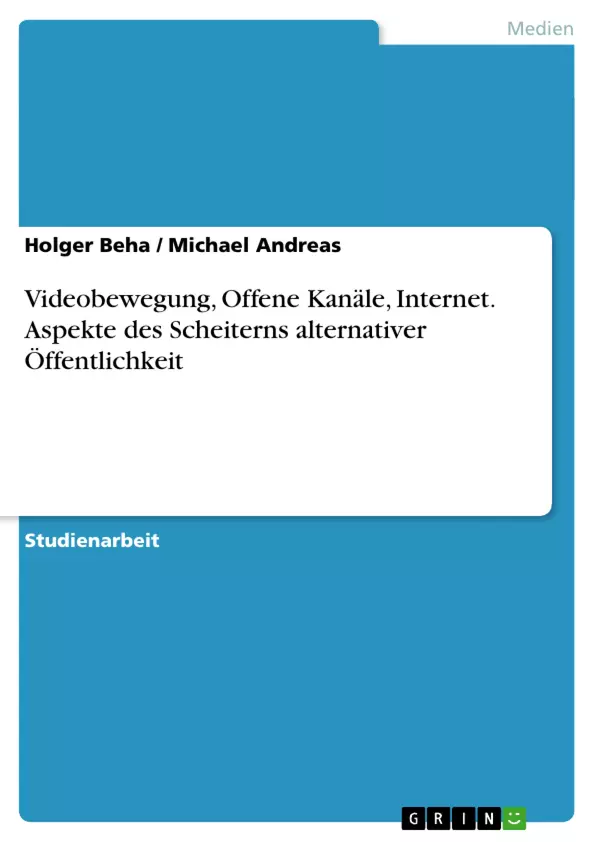Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Forderungen nach partizipativen Medienformen
Bertolt Brecht
Walter Benjamin
Hans Magnus Enzensberger
Gegenöffentlichkeit als Forderung der progressiven Subkultur
Videobewegung: Die Gegenöffentlichkeit der Audiovision
Offener Kanal: Mehr Demokratie wagen
Die Entstehung der Offenen Kanäle
Nutzung und Ziele des Offenen Kanals
1. Qualifizierung der lokalen Kommunikation
2. Soziale Qualifizierung von Bürgerinnen und Bürgern
3. Kommunikative Qualifizierung von Rezipienten
Probleme und heutiger Stand
Internet als Möglichkeit
Die Geschichte des Internets – vom Experiment zur Universalität
Die Struktur des Internets und ihre Bedeutung für die Kommunikation im Netz
Öffentlichkeit im Internet
Weltweites Netz und lokale Kommunikation
Soziale Qualifizierung?
Neue Form der Medienkompetenz
Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Einleitung
Spätestens seit der Forderung Brechts, die bisher nur sendenden Medien endlich auch in empfangende umzuwandeln, um somit auch dem Empfänger die Möglichkeit zu geben, Botschaften nicht nur empfangen, sondern auch senden zu können, hat sich die Forderung nach partizipativen Medienformen kontinuierlich durch die Geschichte gezogen. Vor allem in den 60er Jahren kam es zu einer Forcierung der Diskussion, in deren Folge alternative Öffentlichkeit entstand. Durch die neu vorhandene Möglichkeit der audiovisuellen Magnetbandaufzeichnung entstanden zahlreiche Videogruppen, die glaubten, durch die kostengünstige Bildaufzeichnung und Distributionsform des Mediums Video eine breitere Gegenöffentlichkeit erzeugen zu können. Des Weiteren entstanden aus der Diskussion um bessere Mitbestimmung des Bürgers an den bisherigen Medien letztendlich die Offenen Kanäle, die in institutionalisierter Form das im Grundgesetz verankerte Recht auf Meinungsfreiheit garantieren sollten.
Anhand eines historischen Abrisses und Aufzeigen der Merkmale und Probleme der Videobewegungen und der Offenen Kanäle soll gezeigt werden, warum sich die Videobewegungen nicht durchsetzen konnten und welche Ziele die Offenen Kanäle nicht, teilweise, oder vollständig verwirklichen konnten.
Mit der Entstehung des Internets, seinen unterschiedlichen – teilweise neuartigen – Kommunikationsformen und der letztendlichen Erfüllung der Forderungen nach einer netzartigen Distributionsstruktur von Brecht und Enzensberger, kam auch wieder verstärkt die Diskussion auf, ob und wie eine neue Gegenöffentlichkeit im „Netz“ vorhanden bzw. möglich ist. Nach einer kurzen Zusammenfassung der Geschichte des Internets und dem Aufzeigen verschiedener neuer (und alter) Formen der Kommunikation soll durch das Beleuchten einiger Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu den bisherigen Medien ein direkter Vergleich zu den Offenen Kanälen und Videobewegungen gezogen werden. Außerdem sollen dadurch Chancen und Risiken aufgezeigt werden, die das Internet für Subkulturen bietet und die Frage behandelt werden, welche Stellung das Internet vor allem im Hinblick auf das Zusammenwirken mit den bisherigen Medien in Zukunft in der Gesellschaft einnehmen wird.
Forderungen nach partizipativen Medienformen
Schon kurz nach der Etablierung des Mediums „Radio“ 1917[1] wurde Kritik an der bestehenden Form der Sendungen laut. Die Forderung nach mehr Demokratie und Mitbestimmung des Bürgers im Radio wurde zum ersten Mal im Mai 1928 anlässlich der bevorstehenden Reichstagswahlen vom „Arbeiter-Radio-Bund Deutschland e. V.“ erhoben. Die letzte der zwölf medienpolitischen Forderungen lautete: „Freigabe von Versuchssendern auch für ernsthafte Amateurgruppen“ (Kamp, o.J.).
Bertolt Brecht
Bekannter ist aber wahrscheinlich die „Rede über die Funktion des Rundfunks“, die Bertolt Brecht 1932 schrieb. Nach Brecht hatte der Rundfunk seine eigentliche Aufgabe noch nicht gefunden und war streng genommen eine der „[...] Erfindungen, die nicht bestellt sind. [...] Man hatte plötzlich die Möglichkeit, allen alles zu sagen, aber man hatte, wenn man es sich überlegte, nichts zu sagen “ (Brecht, 1932, 552; Hervorh. i. Orig.). Bisher bestand die einzige Aufgabe des Rundfunks darin, „[...] das öffentliche Leben lediglich zu verschönen“ (ebd., 1932, 553), allerdings lag die wahre Bedeutung des Rundfunks woanders. Denn wenn es gelänge, den passiven Zuhörer und Empfänger zum aktiven Mitgestalter und Sender zu machen, dann könnte das Radio wesentlich zu Veränderungen im politisch-gesellschaftlichen System beitragen. Im Wesentlichen lag hier schon die Idee einer netzartigen Distributionsstruktur vor:
„Der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem, d.h. er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen, also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn in Beziehung zu setzen“ (ebd.).
Walter Benjamin
Ähnliche Gedanken hatte auch Walter Benjamin, als er die bürgerliche (westliche) Zeitung mit der „Sowjetpresse“ verglich. Während in der westlichen Welt die Presse durch die immer breiter werdende Aufteilung ihrer Themen erst ein wachsendes Bedürfnis nach Neuigkeiten schafft und damit gleichzeitig die Aufteilung in „Autor“ und „Publikum“ definiert und aufrechterhält, wandelt sich die Sowjetpresse zunehmend zu einer Art Forum, auf dem jeder Arbeiter seine Meinung kund tun kann: „Der Lesende ist dort jederzeit bereit, ein Schreibender, nämlich ein Beschreibender oder auch ein Vorschreibender zu werden“ (Benjamin, 1977, 688).[2]
Hans Magnus Enzensberger
Sehr viel deutlicher wurde Hans Magnus Enzensberger in seinem „Baukasten zu einer Theorie der Medien“ 1970. Zum Einen knüpft er direkt an Brecht an, wenn er vom „feedback“ (Enzensberger, 1997, 99) - eben der Möglichkeit, nicht nur zu empfangen, sondern auch senden zu können - spricht, und zum Anderen an Benjamin mit seiner Forderung nach einem „emanzipatorischen Mediengebrauch“ (ebd., 1997, 116):[3]
„Das offene Geheimnis der elektronischen Medien, das entscheidende politische Moment, das bis heute unterdrückt oder verstümmelt auf seine Stunde wartet, ist ihre mobilisierende Kraft. [...] Zum ersten Mal in der Geschichte machen die Medien die massenhafte Teilnahme an einem gesellschaftlichen und vergesellschafteten produktiven Prozeß möglich, dessen praktische Mittel sich in der Hand der Massen selbst befinden. Ein solcher Gebrauch brächte die Kommunikationsmedien, die diesen Namen bisher zu Unrecht tragen, zu sich selbst. In ihrer heutigen Gestalt dienen Apparate wie das Fernsehen oder der Film nämlich nicht der Kommunikation sondern ihrer Verhinderung. Sie lassen keine Wechselwirkung zwischen Sender und Empfänger zu: technisch gesprochen, reduzieren sie den feedback auf das systemtheoretisch mögliche Minimum“ (ebd., 1997, 99).
Enzensberger erstellt für seine Vorschläge und Forderungen eine zusammenfassende Tabelle, die die Unterschiede zwischen einem (bis damals vorherrschenden) „repressiven“ und einem (gefordertem) „emanzipatorischen Mediengebrauch“ (ebd., 1997, 116) darstellt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gegenöffentlichkeit als Forderung der progressiven Subkultur
„ Subkultur, eine relativ eigenständige Kultureinheit innerhalb eines größeren Kulturganzen[...], die Teile der Gesamtkultur enthält, dazu aber neue oder überbetont entlehnte Elemente entwickelt“ (Brockhaus, 2000).
Das Schlagwort „Gegenöffentlichkeit“ wurde durch die allgemeine Aufbruchsstimmung und Reformfreudigkeit in der Bundesrepublik Ende der 1960er geprägt. Im Zuge der Studentenunruhen kam Kritik am bisherigen hierarchischen Mediengebrauch auf, die u.a. Hans Magnus Enzensberger in seinem Baukasten zu einer Theorie der Medien (Enzensberger, 1997) und Alexander Kluge Öffentlichkeit und Erfahrung. Zur Organisationsanalyse von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit formulierten. In den 60er und 70er Jahren entstand eine rege Gegenmedien-Bewegung. Die sogenannte Alternativpresse organisierte sich in Zeitschriftenredaktionen und Kleinverlagen, und es fanden alternative Bücher- und Zeitschriftenmessen statt.[4] Ähnlich den amerikanischen Beat-Poeten der 50er und 60er wollten sich die Autoren nicht dem Mainstream unterordnen und mussten dafür in Kauf nehmen, keinen oder nur Kleinstverleger zu finden. Da außerdem die Praxis des Geldverdienens mit Literatur suspekt war, machte man Bücher durch billige Reproduktionsverfahren für die breite Masse erschwinglich (Käsmayr, 1974, 15). Die Videobewegung hatte zum Ziel, dem etablierten Fernsehen mit seiner vertikalen Informationsweitergabe das dialogische Medium Video entgegenzusetzen (Schenke, 1998, 106).
Der Begriff Gegenöffentlichkeit stand für eine Forderung nach radikal demokratisierten, selbstverwalteten Medien. Jeder Empfänger sollte auch als potentieller Sender betrachtet werden, dem nur die technischen und intellektuellen Möglichkeiten zum Erstellen und Verbreiten von Nachrichten und Inhalten gegeben werden müssten. Herkömmliche Medien sollten kritisch betrachtet und mit ihnen emanzipatorisch umgegangen werden. Man sah die Möglichkeiten für einen emanzipatorischen Mediengebrauch vor allen Dingen in den (damals) neuen Medien:
„Nachrichten- Satelliten, Farb-, Kabel- und Kassettenfernsehen, magnetische Bildaufzeichnung, Video-Recorder, [...] elektrostatische Kopierverfahren, elektronische Schnelldrucker, Satz- und Lernmaschinen. [...] Alle diese Medien gehen untereinander und mit älteren wie Druck, Funk, Film, Fernsehen [...] immer neue Verbindungen ein“ (Enzensberger, 1997, 97 f.).
Die Kritik an den überkommenen Medien richtete sich v.a. gegen die Zentralisierung ihrer Produktion und die Unmöglichkeit des Konsumenten, auf die Produktion Einfluss zu nehmen. Die neuen Techniken sollten einen Austausch zwischen Sendern und Empfängern möglich machen, außerdem sollten sie jedem Empfänger (also jedem potentiellen Sender) ermöglichen, den Inhalten etablierter Medien eigene Inhalte entgegenzusetzen. Durch die Erfindung des Schnelldruckers[5] 1953 und des „Xerox 914“[6] 1959, wurde eine billige Produktion und Massenproduktion zumindest theoretisch möglich, wenn auch die von Enzensberger geforderte „Gesellschaftliche Kontrolle durch Selbstorganisation“ (Enzensberger, 1997, 116) noch nicht erreicht war.
Rolf Schwendters „Theorie der Subkultur“ (1971) definiert die Subkultur als Randgruppen der Majorität, die, im Gegensatz zur konservativen Majorität, eine Änderung des Establishments zu erreichen versuchen. Er unterscheidet progressive und regressive Randgruppen; erstere streben nach einer Veränderung der Gesellschaft, letztere nach der Wiederherstellung vergangener Gesellschaftsnormen (Schwendter, 1971, 33 ff.). Im Zusammenhang mit der Gegenöffentlichkeit ist aber auch Dieter Baackes Vorschlag, Teilnahme an einer Subkultur als Rollenverweigerung anzusehen, von Wichtigkeit (siehe Käsmayr, 1974, 6 f.).
Insofern ist die Entstehung des Schlagwortes Gegenöffentlichkeit als Phänomen der progressiven Subkultur anzusehen, da seine Befürworter nicht in der Rolle des passiven Medienkonsumenten verharren wollten und nach einer Dehierarchisierung der Massenkommunikation strebten.
Videobewegung: Die Gegenöffentlichkeit der Audiovision
Ein Teil der sich formierenden Gegenöffentlichkeit war die Videobewegung. Wie auch die Alternativpresse versuchte sie, dem etablierten Medienapparat durch eigene Produkte eine Alternative entgegenzusetzen.
Was für die Alternativpresse der Photokopierer und die Setzmaschine, war für die Videobewegung der 1969 entwickelte Portapack von Sony. Er ermöglichte eine gleichzeitige Aufnahme von Bild und Ton auf Magnetband, war batteriebetrieben und somit mobil einsetzbar (Nigg, 1990).[7] Die entscheidenden Vorteile des Portapack für die Gegenöffentlichkeit waren jedoch seine simple Handhabung, die Wiederbespielbarkeit der Kassetten und der damit relativ geringe Kostenaufwand, sowie die Möglichkeit, das Magnetband sofort nach Aufzeichnung zu betrachten. Im Gegensatz zum 16mm-Film – dem bis dahin meist verbreitetsten Medium für alternative Filmemacher – waren die entscheidenden Vorteile bei der Produktion von „Gegenfernsehen“ (Schenke, 1998, 114) also Ökonomie, Technik und Reproduzierbarkeit des neuen Mediums:
„Während die Filmemacher des Mai 68 wegen des teuren 16-mm Materials oft innerhalb von Institutionen produzierten (Filmhochschulen, Gewerkschaften), sind die Dokumentaristen der 'neuen' Jugendbewegung dank der billigen Medien Super-8 und Video weitgehend unabhängig. Dank der Schnelligkeit von Video können sie zum erstenmal auch wirklich in die Vorgänge eingreifen, nicht nur am Ort, sondern überregional. Dadurch entsteht Solidarität, Bewusstsein von Gemeinsamkeit und Stärke“ (Roth, 1982 nach Nigg, 1990).
Auch bei der Distribution des Gegenfernsehens eröffnete die Nutzbarkeit des Magnetbands für die breite Masse neue Möglichkeiten. Die von den Videogruppen produzierten Bänder konnten einfach verschickt und unter geringem Aufwand – nämlich auf einem Fernseher, ohne einen Projektor oder spezielle Vorführräume – gezeigt werden. „Video hatte den Charakter eines Werkzeugs, das ohne großen Aufwand, ohne überhöhten Kunstanspruch und ohne die Aura des Kinofilms für die verschiedensten Zwecke im soziokulturellen und politischen Alltag benutzt wurde“ (Nigg, 1990).
Im Portapack sah die Videobewegung die Möglichkeit, die Informationsweitergabe zu vertikalisieren, also das Potential des Empfängers, zum Sender zu werden, zu nutzen und in die Informationsweitergabe Rückkanäle einzubauen. Dieses sollte durch das öffentliche Vorführen und Diskutieren der Videoarbeiten erreicht werden, jenes durch das Anbieten von Seminaren über z. B. Kameratechnik (d.h. Schulung des potentiellen Senders) und über den kritischen Umgang mit den audiovisuellen Massenmedien (d.h. Schulung des Empfängers).
Die Videos behandelten zumeist Themen, die die Videobewegung in Kino und Fernsehen vernachlässigt sah, dazu gehörten Reportagen über Randgruppen und Minderheiten genauso wie über den Arbeitsalltag des „common man“. Ihre Eingebundenheit in die alternative Szene machte die Videobewegung zu deren Sprachrohr. Oftmals gingen Video-Aktivisten mit ihren Kameras auf Demonstrationen, um über sie aus der Sicht der Demonstranten (und nicht wie im Fernsehen aus der Sicht von Unbeteiligten oder gar der Polizei) berichten zu können.[8]
Heute kann man davon ausgehen, dass die Videobewegung zwar eine wichtige Zeiterscheinung war, sie letztendlich aber an ihren utopischen Ansprüchen gescheitert ist. Das von ihnen antizipierte Bedürfnis des kleinen Mannes nach Kommunikation entstand aus „eine[r] Negativ-Analyse der bestehenden Produktionsverhältnisse sowie des Rezeptionsverhaltens“ (Schenke, 1998, 114), und ihre radikale Ablehnung von Film-/Fernsehinhalten und deren Ästhetik machte sie für die ungenießbar, an die sie sich richtete: den einfachen Arbeiter, der sich an die vorherrschenden Medien Film und Fernsehen, ihre Formen und Inhalte, gewöhnt hatte und der nach schwer körperlicher Arbeit nicht mehr für freiwillige Medienarbeit zu begeistern war (vgl. ebd., 1998, 115).
Eine Professionalisierung der Videobewegung zugunsten einer besseren Rezipierbarkeit ihrer Videos oder eine Ausstrahlung der Videos über das Fernsehen, um ein größeres potentielles Publikum zu haben, hätte einen Verrat der Videobewegung an ihren eigenen Idealen bedeutet: Gerade in ihrer anderen Ästhetik, und gerade ihre Ablehnung der Produktionsverhältnisse des Big-TV und seiner Entfremdung für Produzenten und Konsumenten lag ihre subversive Kraft (vgl. ebd., 1998, 116 ff.).
Die Videobewegung spaltete sich. Einige Aktivisten versuchten sich im professionellen Film- und Publizistikbereich.[9] Andere verlegten sich auf den medienpädagogischen Aspekt. Ab Ende der 70er bildeten sich zahlreiche Medienzentren und Medienwerkstätten, die die Jugend- und Minderheitenarbeit der Videogruppen – oftmals als eingetragener Verein oder mit Unterstützung durch den Bund oder das Land[10] – fortsetzten und dabei nach wie vor das Ziel hatten, Medien als Möglichkeit zur sozialen Partizipation und Kommunikation begreifbar zu machen (vgl. Anfang, 1997).
Ein organisiertes, von der Öffentlichkeit beachtetes Gegenfernsehen durch Videogruppen findet heute jedoch nicht mehr statt.
Offener Kanal: Mehr Demokratie wagen
Die Entstehung der Offenen Kanäle
Die umfangreiche Debatte, die nicht zuletzt aufgrund der Forderungen nach Gegenöffentlichkeit entstand, beinhaltete aber auch die Frage, wie mehr Partizipation des Bürgers im Bereich der Massenmedien erreicht werden könnte. In der Regierungserklärung von Willy Brandt (Brandt, 1969), heißt es hierzu: „Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir werden unsere Arbeitsweise öffnen und dem kritischen Bedürfnis nach Information Genüge tun. [...] Mitbestimmung, Mitverantwortung in den verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft wird eine bewegende Kraft der kommenden Jahre sein.“ Letztendlich führten diese Überlegungen und Diskussionen zur Forderung nach Offenen Kanälen.
Im Mai 1978 einigten sich die elf Ministerpräsidenten auf die Einführung von vier „Kabelpilotprojekten“ in Ludwigshafen/Mannheim, Dortmund, München und Berlin,[11] nachdem ihnen von der „Kommission für den Ausbau des technischen Kommunikationssystems“ (KtK) 1976 nach fast zweijähriger Arbeit ein Bericht vorgelegt wurde, in dem „[...] Vorschläge für ein wirtschaftlich vernünftiges und gesellschaftlich wünschenswertes Kommunikationssystem der Zukunft [...]“ (Gräfer, 2000, 10) gemacht wurden. Nach Empfehlung der KtK sollten in den Pilotprojekten „[...] primär alternative Telekommunikationsformen und deren technische Varianten sowie außerdem alternative Organisationsformen der Trägerschaft [...]“ (Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen, 1976, 120) getestet werden. Zur konkreten Umsetzung bildete sich bereits in der Vorbereitungsphase die „Expertengruppe Offener Kanal“ (EOK), die dann 1980 die Schrift „Der offene Kanal: Kriterien für ein Bürgermedium“ veröffentlichte. Diese beinhaltete Forderungen und Ziele, die im Großen und Ganzen auch heute noch von allen Offenen Kanälen eingehalten werden. Am 1. Januar 1984 begann dann mit der Ausstrahlung eines Beitrags der Ludwigshafener Medienwerkstatt CUT im Kabelpilotprojekt Ludwigshafen privatrechtlicher Rundfunk (Bauer, 1987, 100).
Nutzung und Ziele des Offenen Kanals
Die Expertengruppe Offener Kanal arbeitete drei Schwerpunkte für die Zielsetzung Offener Kanäle heraus, die deutlich machen, wie der Offene Kanal genutzt und gestaltet werden sollte:
1. Qualifizierung der lokalen Kommunikation
Das erste Ziel sollte sein, „[...] das öffentliche Leben im Lokalbereich auf eine neue Weise zu beleben und das Spektrum der Meinungen zu wichtigen kommunalen Fragen zu erweitern“ (Expertengruppe Offener Kanal, 1980b, 30). Das bedeutet vor allem, dass eben genau die Themen behandelt werden, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und dem Privatfernsehen zu kurz kommen. Der Offene Kanal soll zu einer „Meinungsplattform“ (Schenke, 1998, 73) werden, für „[...] gesellschaftlich nicht Relevantes“ (Expertengruppe
Offener Kanal, 1980b, 29). Daraus ergab sich aber auch die Einschränkung, dass nur Bürgerinnen und Bürger den jeweiligen Offenen Kanal nutzen durften, die in dessen Verbreitungsgebiet lebten oder arbeiteten (ebd., 1980a, 23).
2. Soziale Qualifizierung von Bürgerinnen und Bürgern
Das zweite Hauptziel, „[...] bisher unterrepräsentierten Personen, Perspektiven und Bedürfnissen den Weg zur Teilhabe am öffentlichen Leben zu ebnen“ (ebd., 1980b, 30), bedeutete, vor allem Randgruppen eine Möglichkeit zu geben, auf ihre eigenen Probleme aufmerksam zu machen. Auf der Homepage des Offenen Kanal Berlin heißt es zum Beispiel: „Seit August 1985 senden im Offenen Kanal Berlin Frauen und Türken, Arbeitslose und Studenten, Schwule und Künstler, Iraner und Lehrer, Obdachlose und Schüler Radio- und Fernsehprogramme“ (Linke, 1996). Die eigentliche Hauptaufgabe des Offenen Kanals besteht nach Linke aber darin, diesen Gruppen eine Möglichkeit zur besseren Integration in die Gesellschaft zu bieten.[12] Auch die Expertengruppe Offener Kanal hielt es für „[...] wünschenswert, wenn Gruppen (z.B. Rentner) durch ihre Erfahrungen beim OK dazu ermutigt werden, sich „[...] ‚zu organisieren‘, Ressourcen zu erschließen, Bündnisse einzugehen“ (Expertengruppe Offener Kanal, 1980b, 31). Der Offene Kanal wird somit zu einem „Ort der Begegnung“, der auch „[...] weiterreichende sozial-kommunikative oder medienpädagogische Aufgaben übernehmen kann“ (Schenke, 1998, 72f).
3. Kommunikative Qualifizierung von Rezipienten
Das dritte Ziel behandelt schließlich den medienpädagogischen Aspekt, nämlich: „[...] die kommunikative Kompetenz der Rezipienten gegenüber Massenmedien bzw. öffentlicher Kommunikation zu stärken und besonders bei jenen Nutzergruppen zu verbessern, die im Massenkommunikationsprozeß benachteiligt sind [...]“ (Expertengruppe Offener Kanal, 1980b, 32). So ist der Wechsel vom Konsumenten zum eigenen Produzenten der entscheidende Schritt zu einem reflexiven Medienbewusstsein. „Durch die Einsichten in die Produktionszusammenhänge am Beispiel der eigenen Sendungen verlieren die elektronischen Medien ihren mysteriösen Schleier“ (Schenke, 1998, 73).[13] Dies bedeutet aber auch, dass bei dieser Zielvorgabe der Rezipient zweitrangig wird, denn die Erstellung des Beitrags ist jetzt wichtiger als die eigentliche Sendung.
Aufgrund dieser Zielvorstellungen und der Zweckvorgabe der „Erprobung und Entwicklung neuer Kommunikationsformen“ (Expertengruppe Offener Kanal, 1980, 23) besitzt der Offene Kanal noch weitere Eigenschaften, die ihn von öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern abgrenzen. Am deutlichsten ist wohl der Unterschied, dass der Offene Kanal kein festes Programmschema vorsieht, sondern das sogenannte „Prinzip der Schlange“ (ebd., 25). Um die Gleichberechtigung[14] aller Beiträger zu gewährleisten, gilt die einfache Regel: „Wer zuerst kommt, sendet zuerst“ (Schenke, 1998, 68). Dabei können die einzelnen Sendetermine mit der Projektleitung und den anderen Produzenten abgesprochen werden. Dass sich das Prinzip der Schlange und das übliche Programmschemata nicht unbedingt wiedersprechen, stellte schon Helmut G. Bauer nach dem Ende des Kabelpilotprojekts Ludwigshafen/Vorderpfalz fest:
„Die Produzenten haben frühzeitig erkannt, daß ihre Sendungen auf eine größere Resonanz stoßen, wenn sie zu bestimmten Zeiten verbreitet werden. Sie haben sich deshalb in Gesprächen selbständig und freiwillig darüber verständigt, ihre Beiträge einer Woche jeweils samstags und sonntags zu wiederholen. Bei aktuellen Ereignissen haben die Produzenten untereinander die Sendetermine abgestimmt“ (Bauer, 1987, 103).
Die Projektleitung hatte hier besondere Vollmachten, denn sie „[...] kann an einem Tag der Woche von sich aus einen Programmschwerpunkt setzen und aus diesem Anlaß hierfür das Prinzip der Sendung nach Reihenfolge des Eingangs durchbrechen“ (Expertengruppe Offener Kanal, 1980a, 25). Die aus dem Fehlen eines Programms resultierende Desorientierung des Zuschauers sollte durch die Projektleitung so gering wie möglich gehalten werden:
„Es zählt daher zu den wichtigsten Aufgaben der Versuchsleitung, über die Programmabfolge mit Uhrzeiten im eigenen TV-Kanal, in der lokalen Tagespresse, in Anzeigenblättern, durch Aushang in Vereinslokalen, Rathäusern, Jugend- und Gemeindezentren, Arbeitsämtern, Krankenhäusern, Altersheimen, durch Kontaktpflege mit Pfarrern, Lehrern, Garnisonsoffizieren, Briefträgern und Sozialarbeitern zu informieren“ (ebd., 1980b, 37).
Aus der Forderung nach Gleichberechtigung aller Produzenten ergibt sich, dass die Nutzung der Offenen Kanäle (Studios, Aufnahmegeräte, technische Einweisungen und Beratung) kostenlos sein muss. Finanziert werden die Offenen Kanäle durch einen von der jeweiligen Landesmedienanstalt zur Verfügung gestellten geringen Anteil der Rundfunkgebühren und dürfen nicht für Zwecke der kommerziellen Werbung benutzt werden.
Die Verbreitung eigener (selbstverantwortlicher) Beiträge in Offenen Kanälen stellt wohl eine neue „Ausformung des Art.5 GG“ (Bauer, 1987, 103), dem Grundgesetzartikel der Meinungsfreiheit, dar.
Probleme und heutiger Stand
Laut Bundesverband Offener Kanäle e.V. gibt es derzeit 77 sendende Offene Kanäle in Deutschland (Bundesverband Offener Kanäle, 2001). Allerdings konnten die Ziele, die die EOK damals vorschlug, nur teilweise verwirklicht werden. Zum Einen ist die soziale Integration und Qualifizierung von Randgruppen nur in Ausnahmefällen geglückt.[15] Vereinzelt herrscht in manchen Offenen Kanälen ein Männeranteil von bis zu 90% vor, außerdem wird der Offene Kanal überwiegend von der jungen bis mittelalten Bevölkerung genutzt. Davon haben mehr als 50% Abitur und sehr viele der Berufstätigen sind Angestellte oder auch Selbständige (vgl. Schenke, 1998, 134). Das Ziel, Offene Kanäle für Sendungen mit vor allem lokalen Bezug zur Verfügung zu stellen, wurde auch nicht in vollem Umfang erreicht. So geht zwar aus einer Untersuchung der LPR Hessen über Akzeptanz und Nutzung des Offenen Kanals Kassel hervor, dass knapp drei Viertel der Rezipienten vor allem ein „Programm aus Kassel für Kassel“ sehen wollen (Jaenicke, 1998), allerdings ist die Zahl der politisch orientierten Sendungen sehr gering.[16] Jedoch konnte die Medienkompetenz vieler Nutzer sichtlich gesteigert werden. Vor allem konzentrieren sich einige Offene Kanäle auf die verstärkte Zusammenarbeit mit Schulen[17] und Jugendgruppen, Kompetenzsteigerung erfolgt aber auch dadurch, dass viele Nutzer Sendungen „professioneller“ Sender so gut wie möglich kopieren wollen und dadurch angewiesen sind, die Qualitätsstandards zu erlernen (vgl. Schenke, 1998, 134 f.). Viele jugendliche Nutzer sehen Offene Kanäle aber auch „[...] als Ort ihrer individuellen beruflichen Qualifikation“ (ebd., 135), z.B. hat Christian Ulmen – mittlerweile Moderator bei MTV – bereits mit 12 Jahren eigene Fernsehsendungen im Offenen Kanal Hamburg erstellt (Ansorge-Liebetruth, 1998).
Generell hat eine Tendenz hin zum Rezipienten stattgefunden. Dafür sprechen auch die Abschwächung des Prinzips der Schlange[18] sowie die zeitweilige Aufhebung der lokalen Begrenzung[19]. Neue Herausforderungen werden sich in Zukunft vor allem durch die Einführung des digitalen Fernsehens ergeben. Durch die höheren Kosten, die zwangsläufig für die Offenen Kanäle entstehen werden[20], wird befürchtet, dass der Offene Kanal in der heutigen Form nicht mehr existieren wird: „Wie es scheint, führt kein Weg an einer Vernetzung und Zentralisierung der kleineren Bürgersender vorbei“ (Sackermann-Enskat, 1998).[21]
Internet als Möglichkeit
Die Geschichte des Internets – vom Experiment zur Universalität
Natürlich lässt sich das gegenwärtige Internet, seine Struktur und vor allem seine Bedeutung als Medium nicht ohne seine historischen und politischen Ursachen verstehen.[22] Bestimmte historische Ereignisse prägten das Internet und führten zu seiner heutigen Form.
Laut A.M. Rutkowski und der Internet Society (nach Werle, 1997, 32) lässt sich die Entwicklung des Internets in drei historische Stufen unterteilen: Die Stufe 1 umfasst den Aufbau eines Computernetzwerkes zur militärischen Nutzung und seiner Weiterentwicklung zum Netzwerk zur militärischen und wirtschaftlichen Nutzung (1968-1984). In dieser Zeit stieg die Zahl der vernetzten Computer von unter zehn auf ca. 1000.
Seit 1968 gab es Bestrebungen der amerikanischen Regierung, dezentralisierte Rechnernetze zu entwickeln, um die Rechenkapazitäten einzelner Großrechner zu erhöhen. Das ARPANET
(Netzwerk der Advanced Research Projects Agency) war eine Vernetzung großer Universitäten und Forschungseinrichtungen im Auftrag des amerikanischen Verteidigungsministerium und wurde aus öffentlichen Mitteln finanziert (ebd., 1997, 33). In den 70ern und 80ern entwickelten sich parallel zum ARPANET weitere, aber zivile Rechnernetze, die sowohl ökonomischen als auch wissenschaftlichen Interessen dienten und sich finanziell selbst trugen (ebd., 1997, 33 ff.).
Die zweite Stufe von 1984 bis 1992 beginnt mit der inhaltlichen Abtrennung des militärischen Teils des ARPANET vom Rest. Das 1986 entwickelte NSFNET wurde aus öffentlichen Mitteln finanziert und war ein reines Wissenschaftsnetzwerk, das für die sich entwickelnde „[...] Computer-Wissenschaft [...] das Labor [...]“ (ebd., 1997, 34f.) darstellte. Die unterschiedlichen Interessen aller am NSFNET beteiligten Institutionen – verschiedene Regierungs- und Legislativorgane sowie die Industrie[23] – erforderten eine spezielle Software, an die ein hoher Anspruch gestellt wurde: Das NSFNET musste multifunktional sein und somit in der Lage, verschiedene Netz-„Arten“ zu koppeln, ohne sie in ihrer individuellen Funktionalität zu behindern. Die enormen Anforderungen an das neue Netzwerk führten zu einer bemerkenswerten Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Institutionen (ebd., 1997, 39).
Mitte der 80er entwickelte[24] sich auch ein spezieller Verhaltenskodex für das Netz, der bis
heute unter dem Begriff „netiquette“ (zusammengesetzt aus dem englischen net = Netz und etiquette = ungeschriebenes Gesetz) bekannt ist. Je nach Interpretation dient diese netiquette dem Ausschluss rassistischer oder sexistischer Inhalte und der Ausgrenzung von Teilnehmern, die das Internet missbrauchen oder andere Teilnehmer belästigen.
Während von 1968 bis Anfang der 1990er die Vorläufer des Internets vor allem für die Kopplung militärischer und ziviler Forschung dienten, setzt mit der Gründung der Internet Society 1992 eine „[...] Kommerzialisierung und Privatisierung, aber auch [...] Internationalisierung des Netzes [...]“ (ebd., 1997, 41) ein. Die Internet Society hatte den Anspruch, die technische Entwicklung des Internets und seine Bedeutung für die Industrie, die Regierung und die Forschung zu stärken (vgl. Articles of Incorporation of the Internet, 3.A, nach Werle, 1997, 41).
Die zunehmende Kommerzialisierung des Internets führte zur schrittweisen Auflösung des Wissenschaftsnetzes NSFNET seit 1995 und seiner Übernahme durch private Träger. Einerseits hatte sie zwar eine rasantes Wachstum des Netzes zur Folge, andererseits führte der Rückzug des NSF aus der Vernetzung zu einem Verlust des Forschungsanspruchs.
Die Bedeutung des Internets für Privathaushalte konnte erst mit der Entwicklung benutzerfreundlicher Webbrowser[25] erreicht werden. 1998 nutzten zwischen zwei und sechs Millionen Deutsche das Internet, 2000 waren es bereits 25 Millionen (vgl. Focus-Online, 2001).
Die von der Internet Society angestrebte „Internationalisierung“ des Netzes konnte zwar auf Deutschland und Europa bzw. die erste Welt übergreifen, dennoch ist das Internet heute weit davon entfernt, so etwas wie ein internationales Medium zu sein. Die meisten Adressen im WWW sind .com, das heißt kommerzielle, oder .us-, .de-, .uk- oder .jp-Adressen[26], das heißt amerikanische, deutsche, britische oder japanische Adressen. Internetseiten aus finanzkräftigen Staaten sind im Internet durch ihr Länderkürzel überproportional häufig vertreten.[27] Von 407 Millionen Nutzern weltweit kommen über 167 Millionen aus Nordamerika, 113 Millionen aus Europa und 105 Millionen aus Asien, davon die meisten aus Japan (wobei China gerade dabei ist, seine Netzkapazitäten auszubauen). In Lateinamerika und Afrika sitzen lediglich 16,5 bzw. 3,1 Millionen Nutzer (vgl. Focus Online, 2001).
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass der anfängliche wissenschaftliche Anspruch an das Internet immer mehr zugunsten des Kommerzes zurückgegangen ist. Es ist zwar weiterhin eine wissenschaftliche Nutzung des Internets für Nachforschung und Recherche möglich, parallel dazu hat sich aber eine Netznutzung entwickelt, die im wesentlichen darauf abzielt, Konsum zu vereinfachen und private Bedürfnisse zu befriedigen: Das Internet wird im wesentlichen zur (geschäftlichen und privaten) Korrespondenz via Email, für Online-Bankgeschäfte, zur privaten Recherche oder zur Vereinfachung des bloßen Einkaufens benutzt.[28] Das heutige Internet bietet zwar Möglichkeiten für die Forschung, von denen anfänglich niemand zu träumen wagte, und diese Möglichkeiten entstanden auch aus den Folgen der Kommerzialisierung und der Privatisierung, allerdings haben private und kommerzielle Nutzung des Internets seinen ursprünglichen wissenschaftlichen Anspruch im öffentlichen Bewusstsein schon längst abgelöst.
Die Struktur des Internets und ihre Bedeutung für die Kommunikation im Netz
Das Internet in seiner heutigen Form ist sowohl Instrument als auch Medium.[29] Als Instrument unterstützt es den Menschen bei seiner täglichen Arbeit (Einkaufen, Bankgeschäfte, Nachschlagen von Informationen); das Internet als Medium zu betrachten „[…] thematisiert den Computer als Technologie der Kommunikation, durch welche die Möglichkeit zum Wahrnehmen und Kommunizieren sich abzulösen beginnt von der Voraussetzung der leiblichen Anwesenheit der Kommunizierenden“ (Krämer, 1997, 12). In diesem Sinne ist das Internet kein revolutionäres Medium, sondern die konsequente Folge der Technik- und Informationsgeschichte[30]. Erst die Erfindung der elektronischen Datenverarbeitung und ihre Kopplung mit der Telekommunikation machte die Utopie der virtuellen face-to-face-Kommunikation unter körperlich nicht Anwesenden, Marshal McLuhans 1968 (!) formulierte Vorstellung vom „globalen Dorf“ (vgl. Krämer, 1997, 13) ebenso möglich wie H. M. Enzensbergers Forderung, die „[...] technische Differenzierung von Sender und Empfänger“ (Enzensberger, 1997, 99) aufzuheben.
Interaktion im Internet befriedigt nicht nur unterschiedliche Bedürfnisse, sondern funktioniert auch über unterschiedliche Wege. Krämer (1997, 15f.) unterscheidet diese anhand der An- oder Abwesenheit der Kommunizierenden, der zeitlichen Synchronizität oder Asynchronizität der Kommunikation und der direkten Adressierung oder Öffentlichmachung von Informationen. Sie unterscheidet Email (zeitlich asynchrone, adressierte Kommunikation unter Abwesenden, also die Elektronisierung der herkömmlichen Post), das Usenet[31] (zeitlich asynchrone, aber öffentliche Kommunikation unter Abwesenden) und den Chat[32] (zeitlich synchrone Kommunikation unter Anwesenden, bei der sowohl direkte Adressierung bei z.B. Online-Konferenzen als auch öffentliche Kommunikation möglich ist)[33].
Das Chatten scheint nach Krämer (1997, 16ff.) am ehesten die Wiederherstellung der „ elementaren Kommunikation “ (Fiehler/Weingarten, 1988, 1, Hervorh. i. Orig.) zu ermöglichen. Email und Usenet interpretiert sie lediglich als Elektronisierungen der alten Medien, das Chatten hingegen erweitert den bisherigen Kommunikationsbegriff in so fern, als dass es nicht nur eine Fortführung klassischer Kommunikation auf elektronischem Wege, sondern als völlig neue Interaktionsform einer eigenständigen Beschreibung bedarf.
Die Anonymität im Netz, bedingt durch die lediglich virtuelle Anwesenheit der Kommunizierenden, ihr Treffen in einem völlig neuen Raum, der neben der realen Welt koexistiert, hat drei wesentliche Konsequenzen: Erstens führt die Kommunikation über die bloße Schrift zu einem Verlust des Subtextes des Gesagten: Weil keinem der Kommunikationspartner reale Partner gegenüberstehen, wird der bloße Text ausschließlicher Bedeutungsträger. Es gibt im Internet keine Körpersprache, keine ausdifferenzierte Betonung des Gesagten durch die Stimmlage, die Betonung etc.[34] Zweitens kommt es zu einem Verlust der Autorenschaft: Im Internet kommuniziert man nicht mehr mit Personen, sondern mit Namenskürzeln, die mit den realen Personen keinen Bezug mehr haben müssen. Durch die Anonymität im Netz kann sich jeder der Kommunizierenden eine neue, virtuelle Existenz schaffen, die der eigenen realen Existenz sogar diametral entgegenstehen kann. Drittens erfordert diese völlig neue Kommunikationssituation einen Katalog von „Spielregeln“ (Krämer, 1997, 18), der sogenannten „netiquette“ (s.o.), um eine Kommunikation überhaupt möglich zu machen. Diese Spielregeln sind allerdings nur von virtueller Bedeutung, ein Verstoß gegen sie kann nicht tatsächlich, sondern nur „[…] symbolisch geahndet werden[35], eben als ein Ausschluss vom Spiel: Wer gegen die internen Konventionen verstößt, kann aus dem Kanal hinausgeworfen werden“ (Krämer, 1997, 18).
Die Struktur des Internets ist also keine Struktur mit Bezug zur Realität, sondern nur existent im Medium selbst. Das Internet ist ein virtueller Raum, in denen reale Gesetze, Moralvorstellungen und Interaktionen außer Kraft gesetzt sind. Was in den multiplen Zentren des Netzes passiert, kann, muss aber keinen realen Bezug haben. „[The] [...] audience becomes the silent performers. If it is now asked where the real center […] is to be found, the answer is that this is impossible to determine [...]“ (Derrida, 1978, 287): Das Internet hat zwar viele Autoren, doch durch die Vernetzung ist ein Springen zwischen den unterschiedlichen Inhalten innerhalb kürzester Zeit möglich. Ein Bezug zwischen einem Internet-Autor und der realen Person hinter dem Namenskürzel kann nicht mehr als gesichert angesehen werden. Die Inhalte sind nicht mehr an die Realität gekoppelt, und die Segmentierung der virtuellen Inhalte und ihre Neukombination durch den Internetnutzer macht diesen zu seinem eigenen Autor[36].
Öffentlichkeit im Internet
Das Scheitern früherer Versuche, ein von der Öffentlichkeit beachtetes „Gegenfernsehen“ zu etablieren und das Aufkommen der neuartigen und vielfältigen Kommunikationsstruktur des Internets legt die Frage nahe, wie das Internet von einer Gegenöffentlichkeit genutzt werden kann, welche Vorteile das Internet in seinen verschiedenen Formen gegenüber den Offenen Kanälen und der Videobewegung bietet und wie diese alternativen Öffentlichkeiten ihre Ziele und Ideale mithilfe des neuen Mediums verwirklichen können.
Das Aufkommen einer Gegenöffentlichkeit gründete sich wie gezeigt nicht zuletzt darauf, dass die Kosten der Herstellung alternativer Informationen entscheidend gesenkt und die Distributionsmöglichkeiten maßgeblich verbessert werden konnten. Beide Kriterien finden sich auch im Internet. So hat zum Beispiel jeder, der im Besitz eines online-fähigen Computers ist, die Möglichkeit, kostenlos eine eigene Homepage zu erstellen[37], Emails an einen oder mehrere Empfänger zu verschicken, oder seine Meinung in einem der vielen öffentlichen Foren kund zu tun. Dabei kann die Homepage oder der Beitrag auf dem Forum weltweit aufgerufen werden, und die Kosten für das Versenden einer Email ändern sich mit der zunehmenden Entfernung des Empfängers nicht. Die „lokale Beschränkung“ der Distribution, wie sie sich zum Beispiel beim Offenen Kanal finden ließ, wird grundsätzlich aufgehoben und so kann eine sehr viel breitere Öffentlichkeit erreicht werden[38], wobei die Inhalte völlig frei gewählt werden können. Während bei den Offenen Kanälen noch das „Prinzip der Schlange“ die Gleichberechtigung aller Sender gewährleisten sollte, bietet das Internet – vor allem durch das Erstellen eigener Homepages – weitere Möglichkeiten. Aus einer Untersuchung von Christian J. Müller über die Qualität der Präsentation „großer“ und „kleiner“ Parteien aus Deutschland, Großbritannien und den USA geht hervor, dass prinzipiell „[...] Symbole, Personen und Texte bei der Mehrzahl gleichwertig präsentiert werden [...]“, so dass „[...] sich die durch die Medien hervorgerufene Personalisierung der Politik [...]“ (Müller, 1998, 157 ff.) im Internet nicht fortsetzt. Allerdings fällt es kleineren Organisationen schwerer, ihre Inhalte verständlich zu formulieren. So „[...] bevorzugt die politische Rechte mehr die militärische Kürze, während sozialistische und kommunistische Parteien zur Weitschweifigkeit neigen“ (Plake/Jansen/Schuhmacher, 2001, 58).
Gegenöffentlichkeit wird nach Ludwig durch das Internet neu definiert:
„So läßt sich vorrangiges Protestverhalten auch im sog. Kommunikations- und Multimedia-Zeitalter ohne die neuen Techniken organisieren, auch wenn die computervermittelten Kommunikationsmöglichkeiten dabei durchaus hilfreich sein können. Gesellschaftliche Problemlagen und Entwicklungen hingegen zu thematisieren, die von der massenmedial strukturierten (Mehrheits-) Öffentlichkeit aus unterschiedlichen Gründen [...] nicht aufgegriffen und auf ihren Lösungsbedarf hin diskutiert werden, läßt sich ohne den Einsatz adäquater Informations- und Kommunikationstechnologien, etwa ohne die Möglichkeit des Internet und den damit möglichen Kommunikationsmodi, praktisch nicht (mehr) realisieren: Die jeweils eigenen (Gegen-) Öffentlichkeitssysteme kostruieren sich überhaupt erst durch die neuen Möglichkeiten der digitalen und virtuellen Kommunikation“ (Ludwig, 1998, 180).
Neben der Möglichkeit, Inhalte über das „Netz“ zu verbreiten, kann das Internet auch eine unterstützende Funktion für konkrete politische Aktionen haben. Für Bieber (zitiert nach Plake/Jansen/Schuhmacher, 2001, 63) gibt es verschiedene „Interaktivitätsdimensionen“, die alle in den letzten Jahren schon erprobt wurden. Zum Beispiel können Logos auf WWW-Seiten darauf hinweisen, dass deren Betreiber mit entsprechenden politischen Kampagnen sympathisiert. Es können auch eigene Websites erstellt werden, die eine „enthüllende“ Funktion haben, d.h. „[...] die auf ein tatsächliches oder angebliches unethisches Verhalten einer Person oder einer Organisation aufmerksam machen, einschlägiges Material bereitstellen und möglicherweise zum Protest aufrufen“ (Plake/Jansen/Schuhmacher, 2001, 63), oder aber einfach nur informieren und als Koordinationszentrum für Aktionen auftreten können. Weiterhin besteht die Möglichkeit, durch elektronische Kettenbriefe sozusagen im „Schneeballprinzip“ möglichst viele Adressaten einer Protestaktion zu erreichen. Zur „[...] völligen Verlagerung in den virtuellen Raum“ (ebd., 2001, 63) kommt es zum Beispiel durch Online-Streiks[39], virtuelle Sit-ins oder Hacks. Während bei Sit-ins die Überlastung (und damit der Ausfall) einer Webseite durch möglichst viele gleichzeitige Aufrufe erreicht wird, wird der Ausfall bei Hacks durch Umprogrammieren der Quelldatei einer Webseite erreicht.
Neuere Umfragen lassen allerdings erkennen, dass „[...] das Internet aber auch in der Zukunft ein Informationsmedium [...]“ (ComCult Research, 2001) bleibt. So steht das Abrufen von aktuellen Nachrichten und Berichten mit über 76% an erster Stelle, dicht gefolgt von Computerthemen. „Daneben werden vorrangig Websites mit Entertainment-Content sowie Lifstyle-Angeboten [!] aufgesucht. Immerhin nutzen mehr als die Hälfte der Internet-Anwender mindestens einmal im Monat freizeitorientierte Websites, die Themenbereiche wie zum Beispiel Reisen und Urlaub sowie Sport abdecken“ (ebd., 2001). So kann behauptet werden, dass die meisten Nutzer die Möglichkeit der Konsumption der der Produktion vorziehen.
Weltweites Netz und lokale Kommunikation
Durch das Internet besteht - vor allem durch das Anbieten privater Homepages – auch weiterhin die Möglichkeit, „gesellschaftlich nicht Relevantes“ (Expertengruppe Offener Kanal, 1980b, 29) darzustellen, und zwar nicht mehr in einem begrenzten lokalen Umfeld, sondern weltweit. Durch die netzartige Struktur ist es aber erstmals möglich, auf seinen eigenen Homepages auf „Gleichgesinnte“ durch Links hinzuweisen und sich mit diesen in Foren auszutauschen.[40] Außerdem kann der Verfasser einer Homepage durch einen Verweis auf seine E-Mail-Adresse Nutzern Rückfragen, Kritik und Anregungen ermöglichen.[41]
Nach Plake/Jansen/Schuhmacher hat eine Verbesserung und Verkürzung der Kommunikationswege einen mehr inhaltlich als nachrichtlich orientierten Diskurs zur Folge. So hatten vor allem Alternativbewegungen, deren Protest sich hauptsächlich auf Grund von Problemen der eigenen (ländlichen) Region formierte (z.B. Atommüllgegner), einen Hang zur Regionalisierung. In diesem lokalen Rahmen ließ sich der inhaltliche Diskurs durch die face-to-face Kommunikation besser führen, als überregional (Plake/Jansen/Schuhmacher, 2001, 72 ff.). Der Austausch mit anderen Gruppen fand natürlich statt, aber hauptsächlich auf einer strategischen Ebene:
„Gemeinsame Aktionen wurden geplant, Unterstützung, auch moralischer Art, wurde verabredet, praktisch verwertbare Informationen fanden ihren Adressaten. Damit konnte erreicht werden, dass zu bestimmten Terminen Solidarisierung stattfand. Ein das gesamte Netzwerk übergreifender Diskurs kam aber unter den Bedingungen herkömmlicher Kommunikationsmittel selten zustande“ (ebd., 2001, 75).
Durch das Internet wird - vor allem in Chat-Räumen und Diskussionsforen - eine inhaltlich geprägte Auseinandersetzung zwischen einzelnen alternativen Zentren erleichtert. So können „[...] die neuen Kommunikationsräume die gleiche Dichte der Information und des Meinungsaustauschs aufweisen [...], wie sie zuvor für lokale Verdichtungen kennzeichnend war. Mit dem Internet kommt es zu einer Konzentration der Kommunikation, und zwar nicht mehr an geographisch definierbaren Zentren, sondern an virtuellen Orten“ (ebd., 2001, 76).[42]
Soziale Qualifizierung?
Durch das „weltweite Netz“ können Randgruppen zwar zweifelsfrei besser auf ihre Probleme aufmerksam machen als zum Beispiel bei einem lokal beschränkten Offenen Kanal. Durch die globale Verdichtung der Kommunikation stellt sich aber die Frage, ob der von der Expertengruppe Offener Kanal vorgeschlagene „Ort der Begegnung“, d.h. die bessere Einbindung von Randgruppen in die Gesellschaft durch den „Treffpunkt“ Offener Kanal, durch das Internet in dieser Form noch vorzufinden ist. Bei kompletter Verlagerung lebensweltlicher Probleme in den virtuellen Raum, kann die Gefahr entstehen, „[...] dass die Adressaten nicht mehr identifizierbar sind bzw. dass ihre Identität und ihr Lebensumfeld beliebig wird“ (ebd., 2001, 79). Aber auch auf der Adressantenseite findet durch das Streben vieler Minderheitengruppen nach gemeinsamer Zielerreichung (vgl. ebd., 2001, 77) und der daraus folgenden Zusammenlegung von Ressourcen eine „Entpersönlichung“ statt. Soziale Qualifikation im Sinne der EOK kann also nur stattfinden, wenn mit der Aktion im Internet ein entsprechender Bezug zur lokalen Umwelt hergestellt werden kann.
Neue Form der Medienkompetenz
Schon die Videobewegungen und die Offenen Kanälen sahen es als wichtigen Teil ihrer Arbeit an, durch Verbesserung der Medienkompetenz der Bürger zu einer gegenüber den Massenmedien besser reflektierenden und kritischer eingestellten Öffentlichkeit beizutragen. Mit dem Aufkommen des Internets taucht der Begriff der „Medienkompetenz“ immer häufiger auf, mittlerweile hat aber wohl, nicht zuletzt durch die vielfältigen neuen Möglichkeiten des Internets, eine Ausdifferenzierung dieses Begriffs stattgefunden. „Medienkompetenz“ gilt heute als eine der Schlüsselqualifikationen, die in Zukunft auch stärker in den Schulen vermittelt werden soll.[43] Als Beispiel für die zahlreichen Unterscheidungsvorschläge, die laut Baacke „ [...] keineswegs widersprechende, aber in der Nomenklatur und Gliederungsform anders geartete Vorschläge [...]“ (Baacke, 1998) sind, kann seine Aufteilung der Medienkompetenz in vier Dimensionen dienen: 1. Die medienkritische Dimension beschreibt die ständige Prüfung und Erneuerung des vorhandenen Wissens in analytischer, reflexiver und ethischer Weise. Die Kritik soll sich nicht nur auf die mediale Umwelt beschränken (analytisch), sondern soll auch auf sich selbst angewendet werden (reflexiv) immer mit Abstimmung durch das „ethische Betroffensein“ (ebd.). 2. Die Dimension der Medienkunde meint „ [...] das ‚pure‘ Wissen über heutige Medien und Mediensysteme [...]“ (ebd.). Dieses Wissen ist sowohl informativ (z.B.: „Was ist ein Offener Kanal?“) als auch instrumentell-qualifikatorisch geartet („Wie bediene ich neue Geräte?“). Die dritte Dimension umfasst die Mediennutzung, zum einen rezeptiv-anwendend und zum anderen interaktiv-handelnd. Das Rezipierte muss einerseits verarbeitet werden und andererseits besteht vielfach die Möglichkeit, „[...] interaktiv tätig zu sein“ (ebd.). 4. Die mediengestalterische Dimension kann innovativ oder kreativ sein, d.h. die „Weiterentwicklung des Mediensystems [...]“ und „[...] das Über-die-Grenzen-der-Kommunikationsroutine-Gehen“ (ebd.). Aber nicht nur Schulen sind Förderer dieser neuartigen Medienkompetenz, sondern auch andere Bereiche wie z.B. Politik und vor allem Wirtschaft zeigen starkes Interesse, die Medienkompetenz der Öffentlichkeit zu erhöhen. Allerdings beschränkt sich die Wirtschaft fast gänzlich auf die Dimension der Mediennutzung:
„So kam es hierzulande mit der Auflösung des Postmonopols zu einer drastischen Senkung der Telekommunikationskosten; erste Anbieter haben kostenlose Ortsverbindungen und sogenannte flatrates, also Pauschalpreise für die Internetnutzung, im Programm. Für Hardware-Produkte gilt, dass sie durch die Schnelligkeit des technischen Fortschritts jeweils kurz nach ihrer Markteinführung einem beachtlichen Preisverfall unterliegen. Die Distribution von Software schließlich gehorcht einer eigenen Verwertungslogik, weshalb sie zum Teil kostengünstig oder sogar kostenfrei zu beziehen ist (Shareware/Freeware)“ (Plake/Jansen/Schuhmacher, 2001, 165).
Eine alternative Öffentlichkeit könnte es sich also zur Aufgabe machen, bei der Steigerung der Medienkompetenz in allen Bereichen mitzuwirken um dem Entstehen einer „Wissenskluft“[44] entgegenzuwirken. Laut GfK entwickelt sich die „[...] Nutzung des Internets [...] mehr und mehr zu einem Bestandteil des täglichen Lebens in der Bevölkerung“ (GfK Online-Monitor, 2001, 31). So zählen mittlerweile 46% aller Bundesbürger zum weitesten Nutzerkreis des Internets und sind pro Tag im Durchschnitt 63 Minuten lang im Netz (ebd.).
Schlussbetrachtung
Das Internet in seiner heutigen Form, in seiner Meinungsvielfältigkeit und seiner Vielzahl an Möglichkeiten zu rezipieren, aber auch zu kommunizieren, dürfte das Idealbild der linken Medientheorie der 60er und 70er Jahre gewesen sein. Brechts Forderung, die Sender-Empfänger-Hierarchie aufzulösen und den Kommunikations- in einen Distributionsapparat zu verwandeln, ist paradoxerweise in einer globalen Marktwirtschaft zumindest technisch möglich geworden. Durch die immer weitere Verbreitung von Computern aufgrund von Preissenkungen durch Massenproduktion und ihrer weltweiten Vernetzung hat mittlerweile jeder[45] die Möglichkeit, seine Meinung „ins Netz zu stellen“, also öffentlich zu machen.
Nach wie vor vorhanden sind jedoch die Probleme, die die Videobewegung scheitern ließen und die Offenen Kanäle vor die Frage ihrer Existenzberechtigung stellen: Die Videobewegung scheiterte letztendlich an der Interesselosigkeit der Öffentlichkeit, die von der ästhetischen und inhaltlichen Andersartigkeit ihrer Gegennachrichten herrührte; Offene Kanäle bieten zwar jedem die Möglichkeit, seine eigene Sendung zu produzieren und zu distributieren, doch finden auch sie kein echtes öffentliches Interesse, weder bei den Kabelempfängern noch bei potentiellen nicht-beruflichen Fernsehmachern.
Für das Internet gilt: Jeder Computerbesitzer hat die Möglichkeit, sich über jedes Thema zu informieren, aber keiner tut es. Im Netz ist nur von Interesse, was auch im realen Leben von Interesse ist. Das Internet ist ein reines Informationsmedium geblieben und wird in seiner revolutionären Kraft, die es technisch bietet, nicht genutzt. Es verknüpft lediglich die alten Medien zu einem Netzwerk von Texten, Bildern und Tönen, in dem Themen, die durch die alten Medien öffentlich geworden sind, vertieft werden können.
Gerade durch seine Vielschichtigkeit entschärft sich das Internet selbst: Es ist ein riesiger Wissenspool, der jeden Nutzer dazu zwingt, sich gezielt zu informieren (da eine umfassende Information jeden Rahmen sprengen würde). Dadurch kommt es zu einer zunehmenden Individualisierung, da jeder seine eigenen Interessen verfolgen kann und der Zusammenschluss zu Gruppen, um einen gemeinsamen Themenkanon zu entwickeln, nicht mehr notwendig ist (vgl. Plake/Jansen/Schuhmacher, 2001, 88ff.). Letztendlich verliert sich der Internetnutzer selbst: Das Springen von einem virtuellen Raum in den nächsten, das parallele Umgehen mit unterschiedlichen Themen führt zu einer Auflösung der Identität der Internetnutzer. Im Internet gibt es keinen Mittelpunkt, nur Mittelpunkt e.
Literaturverzeichnis
Anfang, Günther (1997) Videoarbeit,
http://www.kreidestriche.de/onmerz/pdf-docs/anfang_videoarbeit.pdf (10.12.01)
Ansorge-Liebetruth, Beate (1998) Karriere-Sprünge! OK als berufliches Sprungbrett, http://www.offener-kanal-hamburg.de/brbal.html (6.12.01)
APC (2001a) Homepage der Association for Progressive Communications,
http://www.apc.org (12.12.01)
APC (2001b) The APC Mission, http://www.apc.org/english/about/mission/index.htm (12.12.01)
Baacke, Dieter (1998) Zum Konzept und zur Operationalisierung von Medienkompetenz,
http://www.paedagogik.uni-bielefeld.de/agn/ag9/MedKomp.htm (01.12.01)
Bauer, Helmut G. (1987) Offene Kanäle in Rheinland-Pfalz. In : Gemeinnütziger privater Rundfunk in Rheinland-Pfalz. Bürgerservice Offener Kanal. Hg. v. Bürgerservice Rheinland-Pfalz e.V. - Hörfunk und Fernsehen. Mainz, S. 100-104
Benjamin, Walter (1977) Der Autor als Produzent. Ansprache im Institut zum Studium des Fascismus in Paris am 27. April 1934. In: Benjamin, Walter. Gesammelte Schriften. Unter Mitw. von Theodor W. Adorno u. Gershom Scholem. Hg. v. Rolf Tiedemann/Hermann Schweppenhäuser. 2. Bd., 2. Teil. Frankfurt am Main, S. 683-701
Bertelsmann Stiftung (2000) Internetverantwortung an Schulen. Leitfaden,
http://www.internet-verantwortung.de/leitfaden.pdf (04.12.01)
Brandt, Willy (1969) Regierungserklärung, http://www.webpolitik.de/brotz/brandt.htm (6.12.01)
Brecht, Bertolt (1992 [1932/1933]) Der Rundfunk als Kommunikationsapparat. Rede über die Funktion des Rundfunks. In: Bertolt Brecht: Werke. Hg. v. Werner Hecht/Jan Knopf/Werner Mittenzwei/ Klaus Detlef Müller. Bd. 21. Berlin/Frankfurt am Main/Weimar. S. 552-557
Bundesverband Offener Kanäle (2001) Homepage des Bundesverband Offene Kanäle e.V., http://www.bok.de (6.12.01)
Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen (1976) (Hg.) Telekommunikationsbericht. Kommision für den Ausbau des technischen Kommunikationssystems. KtK. Bonn/Bad Godesberg, S. 120
ComCult Research (2001) "Online-Nutzung 2001". Nutzung von Themen im Netz, http://www.comcult.de/index.php4?link=forschungstudien/nutzung2001_themen.php4 (14.12.01)
Derrida, Jacques (1978) Writing and Difference, translated by Alan Bass. London, S. 278-293
Enzensberger, Hans Magnus (1997[1970]) Baukasten zu einer Theorie der Medien. In: Baukasten zu einer Theorie der Medien: kritische Diskurse zur Pressefreiheit. Hans Magnus Enzensberger. Hg. v. Peter Glotz. München, S. 97-132
Expertengruppe Offener Kanal (1980a) Regeln für den Offenen Kanal. In: Offener Kanal: Eröffnung der Diskussion. Zusammengestellt von Christian Longolius. Hg. v. Christian Longolius. Hamburg, S. 23-27
Expertengruppe Offener Kanal (1980b) Erläuterungen zu den Regeln für den Offenen Kanal. In: Longolius, S. 28-39
Fiehler, Reinhard/Weingarten, Rüdiger (1988) Technisierte Kommunikation. Opladen
Focus Online (2001) Internet-Nutzer. Wieviele Menschen sind online? http://www.focus.de/D/DD/DD36/DD36A/dd36a.htm (10.12.01)
Geflügel Online (2001) Besucherstatistik der Homepage „Geflügel Online“, http://www.voteonline5.de/cgi-real/real.cgi?action=fenster&id=28223 (18.12.01)
Gellner, Winand/Tiersch, Stephan (1993) Offene Kanäle in Rheinland-Pfalz. Ergebnisse empirischer Forschung. In : Offene Kanäle in Rheinland-Pfalz. Ergebnisse empirischer Forschung. Band 8. Hg. v. Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter (LPR) Rheinland-Pfalz. Ludwigshafen
GfK Online-Monitor (2001) GfK Online-Monitor. Ergebnisse der 7. Untersuchungswelle, http://www.gfk.de/produkte/eigene_pdf/online_monitor.pdf (14.12.01)
Gräfer, Wilfried (1980) Der aktuelle Stand der öffentlichen Diskussion über die Einführung von Offenen Kanälen. In: Longolius, S. 9-12
Hänke, Stephan (2000) Experiment geglückt. Seit 1997 tauschen die norddeutschen Offenen Kanäle kontinuierlich Fernsehprogramme aus. In: conneX – Informationsmagazin für Bürgermedien 3,1
Hansen, Leonhard (1998) Die positive Kraft und die Botschaft – Medienpädagogik, http://www.offener-kanal-hamburg.de/brlh.html (6.12.01)
Jaenicke, Angela (1996) Die offenen Kanäle. Eine Chronik. In: Offene Kanäle und Bürgerfunk in Deutschland. Rundfunk der dritten Art. Hg. v. Arbeitskreis Offene Kanäle und Bürgerrundfunk der Landesmedienanstalten AKOK. Halle
Jaenicke, Angelika (1998) Wer sieht was warum? LPR Hessen untersucht Akzeptanz und Nutzung des Offenen Kanals Kassel. In: conneX - Informationsmagazin für Bürgermedien 1,1
Kamp, Ulrich (o.J.) Offene Kanäle in Deutschland, http://www.okb.de/dokumentationen/deutsch/offene%20kanaele%20in%20deutschland.htm (6.12.01)
Käsmayr, Benno (1974) Die sogenannte „Alternativpresse“. Ein Beispiel für Gegenöffentlichkeit in der BRD und im deutschsprachigen Ausland seit 1968. Gersthofen
Kleintierzuchtverein Göggingen (2001 ) Homepage des Kleintierzuchtverein Göggingen Z 432 e.V., http://www.ktzv-goeggingen.de/ (18.12.01)
Krämer, Sybille (1998): Über die Kommunikation im Internet. Überlegungen zur telematischen Interaktion . In: Netzdiskurs. Das Internet und der Strukturwandel von Kommunikation und Öffentlichkeit. Hg. v. Christian Hartmann/Christoph Hüttig . Rehburg-Loccum, S. 11-24
Kübler, Hans-Dieter (1999) Wie zerklüftet ist Wissen? Aporien und Desiderate der Wissens(kluft)debatte. In: medien praktisch. Zeitschrift für Medienpädagogik 23/3, S. 10-17
Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter (LPR) Rheinland-Pfalz (1997) (Hg .) Lokal, regional, digital - Perspektiven Offener Kanäle in der digitalen Welt. Band 17. Ludwigshafen
Linke, Jürgen (1996) Du bist ich – Integrationsmodell Offener Kanal Berlin. Aufsatz für die Bundeszentrale für politische Bildung, http://www.okb.de/dokumentationen/deutsch/du%20bist%20ich.htm (6.12.01)
Ludwig, Johannes (1998) Öffentlichkeitswandel durch „Gegenöffentlichkeit“? Zur Bedeutung computervermittelter Kommunikation für gesellschaftliche Emanzipationsprozesse. In: Computervermittelte Kommunikation: Öffentlichkeit im Wandel. Hg. v. Elisabeth Prommer/Gerhard Vowe. Konstanz, S. 177-209
Lutter, Thomas (o.J.) Es gibt nichts neues unter der Sonne.
http://www.thomas-lutter.de/gebet/005.html, (6.12.01)
Lycos (2001) Gestalten einer Homepage, http://www.tripod.lycos.de/index_build.php (17.12.01)
Müller, Christian (1998) Parteien im Internet. In: Demokratie und Internet. Hg. v. Winand Gellner/Fritz von Korff. 1.Aufl. Baden-Baden, S. 157-169
Network Wizards (2000) Distribution by Top-Level Domain Name by Host Count, http://www.nw.com/zone/WWW/dist-bynum.html (10.12.01)
Nigg, Heinz (1990) Express yourself. Das Videoschaffen in der Jugendbewegung der 80er Jahre, http://www.memoriav.ch/fr/home/projets/f-proj-nigg4.htm (25.05.01)
Offener Kanal Berlin (2001) Homepage, http://www.okb.de (6.12.01)
Plake, Klaus/Jansen, Daniel/Schuhmacher, Birgit (2001) Öffentlichkeit und Gegenöffentlichkeit im Internet. Politische Potenziale der Medienentwicklung. Wiesbaden
Pollok, Gerhard (1999) Enzensberger, Hans Magnus. In: Encarta 99 Enzyklopädie. Microsoft.
Rehm, Margarete (o.J.) Information und Kommunikation in Geschichte und Gegenwart, http://www.ib.hu-berlin.de/~wumsta/rehm10.html (10.11.01)
Sackermann-Enskat, Michael (1998) Hindernislauf in digitalen Gefilden. Problem des digitalen OK: Die Kosten. In: conneX – Informationsmagazin für Bürgermedien 1,1
Schenke, Eckhard (1998 ) Der Amateurfilm – Gebrauchsweisen privater Filme. Diss. Göttingen, S. 66-139
Schwendter, Rolf (1971) Theorie der Subkultur. Köln/Berlin
Uricchio, William (1997) Media, Simultaneity, Convergence: Culture and Technology in an Age of Intermediality. Utrecht, S. 5-31
Werle, Raymund (1998) Vom Wissenschaftsnetz zum Kommerznetz. Zur Entstehung und Entwicklung des Internet . In: Hartmann/Hüttig, S. 25-52
Wöhler, Maike (Text)/Schmidsberger, Sabine (Grafik) (o.J.) Medienzentrum 46. Broschüre, Bremen.
Zd Net (2001) Spaniens Internet-Nutzer beenden Streik . Telefongesellschaft Telefonica gibt nach, senkt Ortsgebühren , http://www.zdnet.de/news/artikel/1998/09/18009-wc.htm (12.12.01)
o.V. (1993) Rundfunk. In: Encarta 99 Enzyklopädie. Microsoft
o.V. (2000) Subkultur. In: Der Brockhaus in einem Band. Leipzig
[...]
[1] 1917 wurden zum ersten Mal Musikstücke im damaligen I. Weltkrieg von Hans Bredow und A. Meißner zur Westfront übertragen. Der Langwellensender Königs Wusterhausen übertrug dann am 22. Dezember 1920 zum ersten Mal ein Konzert. Ab 1922 wurde dann vom „Wirtschaftsrundspruchdienst“ das erste Mal regelmäßig gesendet.
[2] Ein Vorbild sah Benjamin in dieser Hinsicht im russischen Schriftsteller Sergej Tretjakow, der selbst durch die Arbeit in einer Kommune seine Forderung: „Schriftsteller in die Kolchose!“ in die Tat umsetzte. „Tretjakow unterscheidet den operierenden Schriftsteller vom informierenden. Seine Mission ist nicht zu berichten, sondern zu kämpfen; nicht den Zuschauer zu spielen, sondern aktiv einzugreifen“ (Benjamin, 1977, 686).
[3] Dem zugrunde liegt eine Kritik an der damaligen politischen Linken bezüglich ihrer medienfeindlichen Abwehrhaltung. Die „Manipulationsthese“, die seit den 60ern die Grundhaltung der Linken bestimmt, ist nach Enzensberger „[...] in ihrem Kern defensiv, [...] setzt keine vorantreibenden Kräfte frei“ und „[...] dient auch der eigenen Entlastung“ (Enzensberger, 1997, 103). „Indem sie die Kommunikationsmedien einzig hinsichtlich ihrer – bürgerlichen – Manipulationstechniken analysierten, [...] hätten sie es versäumt, die agitatorischen Perspektiven vor allem der neuen elektronischen Medien wie weiterentwickeltem TV (z.B. Kabel-TV) und Hörfunk sowie Video und Computer u.a.m. im Kampf gegen die ‚Bewußtseins-Industrie‘ [...] und für eine emanzipatorische Medienpraxis entschieden genug wahrzunehmen“ (Schenke, 1998, 93).
[4] So fand 1968 im Keller eines Studentenhauses eine vom Sozialistischen Deutschen Studentenbund und der
Außerparlamentarischen Opposition organisierte „Gegenbuchmesse“ statt (vgl. Käsmayr, 1974, 15).
[5] Da der Datendurchsatz der Großrechner immer höher wurde, mussten entsprechende Drucker mit enormer Druckgeschwindigkeit hergestellt werden. Der erste Schnelldrucker wurde von der Remington Rand Inc. für den Großrechner UNIVAC 1 entwickelt und konnte bis zu 600 Zeilen pro Minute drucken (Rehm, o.J.).
[6] Der erste vollautomatische Photokopierer Xerox 914 wurde 1959 von der Firma Haloid herausgebracht. Er ermöglichte bis zu 6 Kopien pro Minute auf Normalpapier.
[7] Allerdings waren Kamera und Recorder noch zwei Geräte und mussten verkabelt und separat getragen werden, was die Mobilität natürlich einschränkte.
[8] So entstand z.B. das heute wohl bekannteste aller Videos der deutschsprachigen Videobewegung „Züri brännt“ des Videoladens Zürich, der aus rein subjektiver Sicht und unter Zuhilfenahme aller technischen Möglichkeiten der damaligen Trickmischer über den Zürcher Opernhauskrawall vom 30.5.1980 berichtete (vgl. Nigg, 1990).
[9] Pepe Danquardt, einer der Mitbegründer der Freiburger Medienwerkstatt, der sogar 1993 einen Academy Award für Schwarzfahrer, einen Kurzfilm über die Diskriminierung eines dunkelhäutigen Menschen in der Straßenbahn, gewann; oder Alexander Kluge, Mitbegründer des Oberhausener Manifests für den Jungen deutschen Film 1962, der seit 1988 im Privatfernsehen für unabhängige Kulturmagazine verantwortlich ist.
[10] z.B. in Bremen das Medienzentrum 46 (unterstützt durch den Bremer Senat), oder die Freiburger Medienwerkstatt.
[11] Allerdings verließen kurze Zeit später die Länder Baden-Württemberg und Bayern das Pilotprojekt. Von der Landesregierung in Baden-Württemberg wurde 1979 eine „Expertenkommission Neue Medien“ eingesetzt, deren eigentliches Ziel es war, die Probephase zu koordinieren, die aber letztendlich den Ausstieg aus dem Projekt einleitete (Jaenicke, 1996, 8).
[12] Vor allem bei diesem Punkt bedarf es laut EOK speziell ausgebildeten „Kommunikationshelfern“, die helfen sollen, die eventuell vorhandenen Hemmschwellen der Randgruppen herabzusetzen und „[...] deren Tätigkeit im OK-Gebiet die ‚von oben‘ postulierte Chancengleichheit insbesondere für die bisher Sprachlosen verwirklicht“ (Expertengruppe Offener Kanal, 1980b, 34).
[13] Um den richtigen Umgang mit der Technik zu gewährleisten und Hilfe beim Erlernen dieser Kommunikationsform zu stellen, wird eine sogenannte „Projektleitung“ eingesetzt. Der Projekt- oder Versuchsleiter sollte zusammen mit seinem Team eine Art Expertengremium bilden, das für Fragen in allen Bereichen zuständig sein soll. Jedoch war sich die Expertengruppe darüber einig, dass „[...] die Qualifikationen ‚Medienpädagoge‘ und ‚Sozialpädagoge‘ wichtiger sein sollten als die ebenfalls notwendigen Qualifikationen ‚Journalist‘, ‚Medientechniker‘ und ‚Jurist‘“ (Expertengruppe Offener Kanal, 1980b, 34).
Diese Leitung ist des weiteren verantwortlich für: Produktions- oder Sendeanmeldungen, Regelung der Sendetermine, Koordination der Studio- und Gerätekapazität und Information der Öffentlichkeit über den Programmablauf (vgl. ebd., 24).
[14] „Die Selbstdarstellung eines Rosenzüchters soll denselben Rang in Anspruch nehmen können wie der Protest von Bürgern, die sich gegen eine Straßenumbenennung wehren“ (Expertengruppe Offener Kanal, 1980b, 32).
[15] So senden im Offenen Kanal Berlin verstärkt Türken, Kurden, Serben, Kroaten, Bosnier und Slowenen, wobei Kritiker befürchten, der OK würde lediglich als Plattform benutzt, deren Konflikte untereinander auszutragen (vgl. Lutter, o.J.). Der Offene Kanal Berlin hierzu: „Der ausländische Produzent gelangt durch sein Engagement im Offenen Kanal vom Rand der Gesellschaft in deren Mittelpunkt. Er wird zur öffentlichen Institution und stellt über seine Ansichten Öffentlichkeit her. Die Öffentlichkeit reagiert und er stellt fest, daß er mit seinen Ansichten nicht allein ist oder andere andere Ansichten haben. Er lernt, sich in einer demokratischen Gesellschaft politisch auszutauschen“ (Linke, 1996).
[16] Zum Beispiel beträgt der Anteil von politischen Sendungen in rheinland-pfälzischen Offenen Kanälen lediglich 8% (vgl. Gellner/Tiersch 1993, 177).
[17] So bietet der Offene Kanal Hamburg z. B. eigene Thementage an, zu dem Schulen und auch andere Jugendgruppen Beiträge erstellen und in das Programm einbinden können (vgl. Hansen, 1998).
[18] So haben einige Offene Kanäle mittlerweile feste Sendeschienen und Programmplätze eingerichtet, wie z.B. der OK Berlin (vgl. Offener Kanal Berlin, 2001)
[19] Z.B. tauschen die Offenen Kanäle Norddeutschland seit 1997 regelmäßig Sendungen aus. Dies hat aber auch zur Folge, dass nur die „qualitativ besseren“, d.h. die besser rezipierbaren Beiträge, gesendet werden: „Die technische und inhaltliche Qualität der Beiträge ist von erstaunlich hoher Qualität. Das liegt natürlich daran, dass die Kollegen in den örtlichen Kanälen in erster Linie die ‚Sahnehäubchen‘ ihres Programms zum Thementag anmelden“ (Hänke, 2000).
[20] Um die lokale Begrenztheit der heutigen Struktur der Offenen Kanäle zu erhalten, müssten durch die veränderten Übertragungswege an jedem Standort eines OK´s eigene „Vertriebszentren“ errichtet werden. So schätzen Experten die Investitionskosten der digitalen Verbreitung auf zwei- bis sechs Millionen Mark. Die heutige analoge Verbreitung kostet lediglich 300.000 Mark (vgl. Sackermann-Enskat, 1998).
[21] siehe auch: Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter (LPR) Rheinland-Pfalz, 1997.
[22] vgl. Urichios medienhistorischen Ansatz: „[...] there is indeed good reason to interrogate our media past [...]. Such an approach has particular relevance as we face the challenges of the contemporary media scene and construct the media culture yet to come [...]“ (Uricchio 1997, 5f.).
[23] Die Industrie profitierte jedoch im Wesentlichen von der für die Herstellung des Netzes erforderliche Hard- und Software und zunächst weniger von der verbesserten Kommunikation, die sich für die einzelnen Unternehmen ergeben werden sollte.
[24] Die beteiligten Institutionen hatten keine Verhaltensregeln für das NSFNET festgelegt in der Annahme, die Teilnehmer würden selbst eine Regulierung finden (vgl. Werle, 1997, 40).
[25] Programme, die für die Nutzung des Internets erforderlich sind. Der Communicator von Netscape Communications und der Internet Explorer von Microsoft sind die heute für die private Nutzung des Internets verbreitetsten Browser.
[26] siehe: Network Wizards, 2000
[27] Ein bemerkenswertes Gegenbeispiel hierfür ist lediglich das Länderkürzel .tv für den Inselstaat Tuvalu, der Domains mit seinem einprägsamen Länderkürzel an finanzkräftige Fernsehsender der Ersten Welt verkauft (z.B. www.elton.tv oder www.viva.tv).
[28] vgl. Focus Online, 2001: Eine wissenschaftliche Nutzung des Internets findet in der dortigen Statistik überhaupt keine Erwähnung
[29] so wie auch die Tageszeitung, das Fernsehen, das Buch, der Kontoauszug etc. sowohl als Werkzeug als auch als Medium betrachtet werden können
[30] angefangen bei der face-to-face Kommunikation über die Schrift, Botensysteme, die Post, Telegraphie usf. bis hin zum Telephon, Radio oder Fernseher. Wesentliche Komponenten der technisierten Information sind „ sekundäre Symbolsysteme [...] technische Apparate […] und konservierende Speicher “ (Fiehler/Weingarten, 1988, 1, Hervorh. i. Orig.).
[31] „Das Usenet ist eine Art elektronisches schwarzes Brett, an dem Texte öffentlich abgelegt, gelesen und kommentiert werden können, und zwar zumeist […] themenzentriert[…]“ (Krämer, 1997, 15). Heute ist eher der Begriff „Online-Forum“ geläufiger.
[32] direkte Rede und Antwort via Internet in speziellen „Chatrooms“, allerdings über das Medium der Schrift
[33] Eine von Krämer nicht angeführte, allerdings auch nicht unbedingt interaktive Plattform des Internets ist die Homepage. Hier hat theoretisch jeder Internetnutzer die Möglichkeit, mit einfachen Programmierfähigkeiten auf kostenfreien Servern sich selbst, seine Familie, seinen Verein etc. in Form einer digitalen Verknüpfung von Schrift, Bild usf. zu präsentieren.
[34] Allerdings hat man als Anwender in manchen Chaträumen die Möglichkeit, Textstellen durch Kursivstellungen, Unterstreichungen oder farbige Markierungen besonders zu betonen. ICQ, ein Programm zur schriftlichen, direkten Kommunikation mit ausgewählten Partnern, bietet seinem Anwender die Möglichkeit, dem Gesagten durch die Beifügung von Symbolen (Herzen, Smileys etc.) besondere Betonung zu verleihen. Außerdem hat sich das Zeichensystem der Emoticons (zusammengesetzt aus dem englischen emotion und icon) herausgebildet, das durch die Kombination verschiedener Schriftzeichen in der Lage ist, Subtext zu vermitteln (zum Beispiel ;-) für die Ironisierung des Gesagten).
[35] Nur im Extremfall und unter hohem technischen Aufwand können im Netz begangene Verstöße gegen reale Gesetze verfolgt werden.
[36] vgl. Derridas Theorie zum Tod des Autors (Derrida, 1978)
[37] So bekommt man z.B. bei Lycos 100 MB freien Speicherplatz, um kostenlos eine Homepage betreiben zu können. Lycos bietet dabei „Online-Hilfe“ für Anfänger und Fortgeschrittene (vgl.: Lycos, 2001).
[38] Dabei ist prinzipiell eine bessere Zielgruppenorientierung möglich: „Mailinglisten und Newsgroups sind dabei kommunikative Angebote, die neben der Rezeption von Beiträgen auch die Positionierung eigener Beiträge ermöglichen [...]. Newsletters dagegen werden als Rundschreiben an Interessierte, die sich für diesen Dienst eingeschrieben haben, verschickt“ (Plake/Jansen/Schuhmacher, 2001, 49 f.).
[39] So streikten vom 3. bis zum 18. September 1998 über 1 Million Internetnutzer nach einem Aufruf des spanischen Verbands der Internet-Nutzer Asociacion de Usarios de Internet (AUI) mit Erfolg gegen zu hohe Telefongebühren der ehemals staatlichen Telefongesellschaft Telefonica (vgl. ZD Net News, 2001).
[40] Wenn man als Beispiel Kleintierzuchtvereine in Deutschland heranzieht, erkennt man, dass viele schon über eine eigene Homepage mit Diskussionsforen, Tauschbörsen und vielfältigen Informationsmöglichkeiten verfügen (z.B.: Kleintierzuchtverein Göggingen, 2001). Interessant ist auch, dass die bundesweite Homepage „Geflügel-Online“ täglich im Schnitt über 500 Zugriffe verzeichnen kann. An einzelnen Tagen sind es sogar über 3000 (Geflügel Online, 2001).
[41] Zwar wird nach jedem Beitrag, der in einem Offenen Kanal gesendet wird, auch auf den verantwortlichen Produzenten hingewiesen, allerdings ist dieser Verweis nicht - wie bei der Homepage - jederzeit abrufbar.
[42] Als Beispiel kann hier die Homepage der Association for Progressive Communication (APC, 2001a) dienen. In ihrer Zielsetzung heißt es: „The Association for Progressive Communications is a global network of non-governmental organisations whose mission is to empower and support organisations, social movements and individuals in and through the use of information and communication technologies to build strategic communities and initiatives for the purpose of making meaningful contributions to equitable human development, social justice, participatory political processes and environmental sustainability" (APC, 2001b).
[43] „Während in den USA bereits 76 Prozent der Lehrer das Internet als alltägliches Lernmittel einsetzen, sind es in Deutschland gerade 28 Prozent“ (Bertelsmann Stiftung, 2000, 4).
[44] Zur Entstehung dieses Begriffs: „Erstmals 1970 haben die Kommunikationsforscher Ph. J. Tichenor, G. A. Donohue und C. N. Olien von der Minnesota-University die bis dahin optimistische (oder auch naive) Annahme der Diffussionsforschung explizit dahingehend relativiert, daß die täglich verbreiteten Informationen der Medien nicht unbedingt und gleichmäßig zu einer allgemeinen Erhöhung des Wissensstandes der Menschen führen“ (Kübler, 1999, 13).
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptthemen dieser Analyse der Medienlandschaft?
Die Analyse untersucht die Forderungen nach partizipativen Medienformen, die Entstehung von Gegenöffentlichkeit durch die Videobewegung und Offene Kanäle, sowie die Rolle des Internets als Möglichkeit zur Verwirklichung dieser Forderungen.
Wer waren die wichtigsten Vordenker im Bereich partizipativer Medien?
Bertolt Brecht, Walter Benjamin und Hans Magnus Enzensberger werden als Schlüsselfiguren genannt, die frühzeitig die Notwendigkeit der Umwandlung von Medien zu Kommunikationsapparaten forderten, die nicht nur senden, sondern auch empfangen.
Was war die Videobewegung und welche Ziele verfolgte sie?
Die Videobewegung war Teil der Gegenöffentlichkeit und versuchte, dem etablierten Fernsehen durch eigene Videoarbeiten eine Alternative entgegenzusetzen. Sie sah im Portapack von Sony die Möglichkeit zur Dezentralisierung der Informationsweitergabe.
Warum konnte sich die Videobewegung nicht durchsetzen?
Die Videobewegung scheiterte an ihren utopischen Ansprüchen und der fehlenden Akzeptanz beim breiten Publikum, da ihre Ästhetik und Inhalte vom Mainstream abwichen.
Was sind Offene Kanäle und wie sind sie entstanden?
Offene Kanäle sind institutionalisierte Formen der Meinungsfreiheit, die aus der Diskussion um mehr Mitbestimmung des Bürgers an den Medien entstanden sind. Sie wurden in Deutschland im Rahmen von Kabelpilotprojekten eingeführt.
Welche Ziele verfolgten die Offenen Kanäle?
Die Hauptziele der Offenen Kanäle waren die Qualifizierung der lokalen Kommunikation, die soziale Qualifizierung von Bürgerinnen und Bürgern (insbesondere Randgruppen) und die kommunikative Qualifizierung von Rezipienten.
Welche Probleme und Einschränkungen gibt es bei Offenen Kanälen?
Die Ziele der Offenen Kanäle wurden nur teilweise verwirklicht. Es gibt Probleme bei der sozialen Integration von Randgruppen, der thematischen Ausrichtung auf lokale Themen und der Beteiligung verschiedener Bevölkerungsgruppen.
Welche Rolle spielt das Internet im Kontext von Gegenöffentlichkeit?
Das Internet wird als Möglichkeit zur Verwirklichung der Forderungen nach einer netzartigen Distributionsstruktur gesehen. Es bietet neue Kommunikationsformen und eine potentiell breitere Öffentlichkeit.
Wie hat sich das Internet entwickelt und welche Struktur hat es?
Das Internet hat sich von einem militärischen Experiment zu einem globalen Kommunikationsmedium entwickelt. Seine Struktur ist dezentral und ermöglicht verschiedene Formen der Interaktion, aber birgt auch Risiken der Anonymität und des Identitätsverlusts.
Wie wird Öffentlichkeit im Internet konstruiert?
Gegenöffentlichkeit im Internet wird durch die Thematisierung von Problemlagen konstruiert, die von der massenmedialen Öffentlichkeit nicht aufgegriffen werden. Es ermöglicht eine Verlagerung von Aktionen in den virtuellen Raum und unterstützt politische Kampagnen.
Welche Vor- und Nachteile bietet das Internet im Vergleich zu traditionellen Medien für Subkulturen?
Das Internet bietet eine breitere Reichweite und neue Kommunikationsformen, aber birgt auch die Gefahr der Entpersonalisierung und des Verlusts des Bezugs zur lokalen Umwelt.
Was bedeutet Medienkompetenz im digitalen Zeitalter?
Medienkompetenz umfasst verschiedene Dimensionen, darunter Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und Mediengestaltung. Sie ist eine Schlüsselqualifikation für die Teilhabe an der Informationsgesellschaft.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Analyse?
Das Internet bietet zwar potentiell die Verwirklichung der Ideale der linken Medientheorie, wird aber in seiner revolutionären Kraft nicht voll ausgeschöpft. Es dient hauptsächlich als Informationsmedium und birgt Risiken der Individualisierung und des Identitätsverlusts.
- Quote paper
- Holger Beha (Author), Michael Andreas (Author), 2002, Videobewegung, Offene Kanäle, Internet. Aspekte des Scheiterns alternativer Öffentlichkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109015