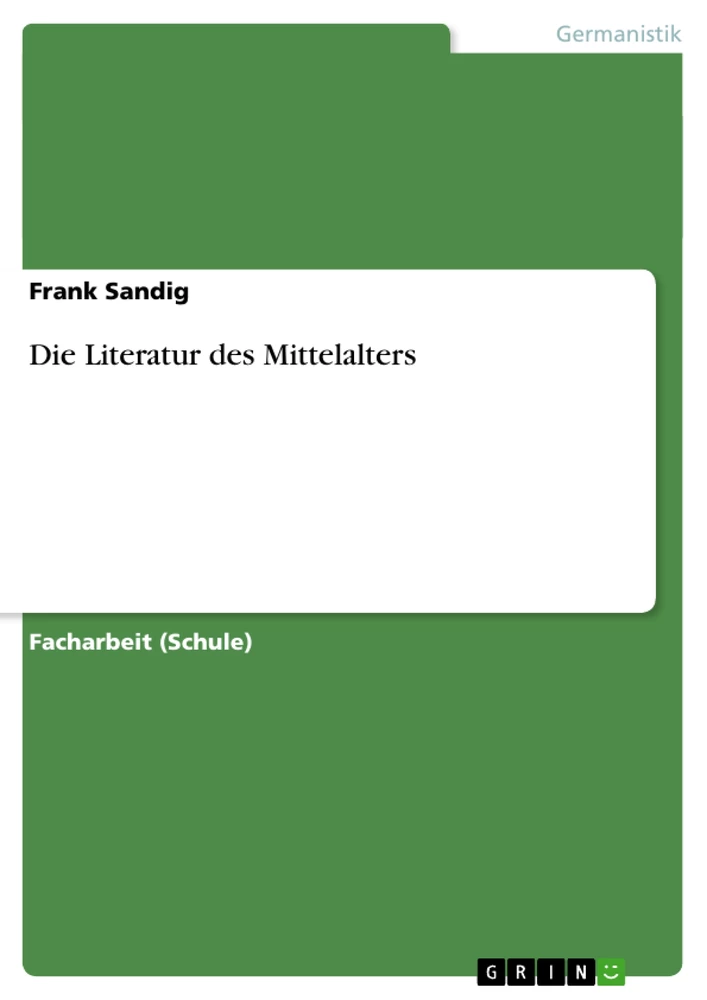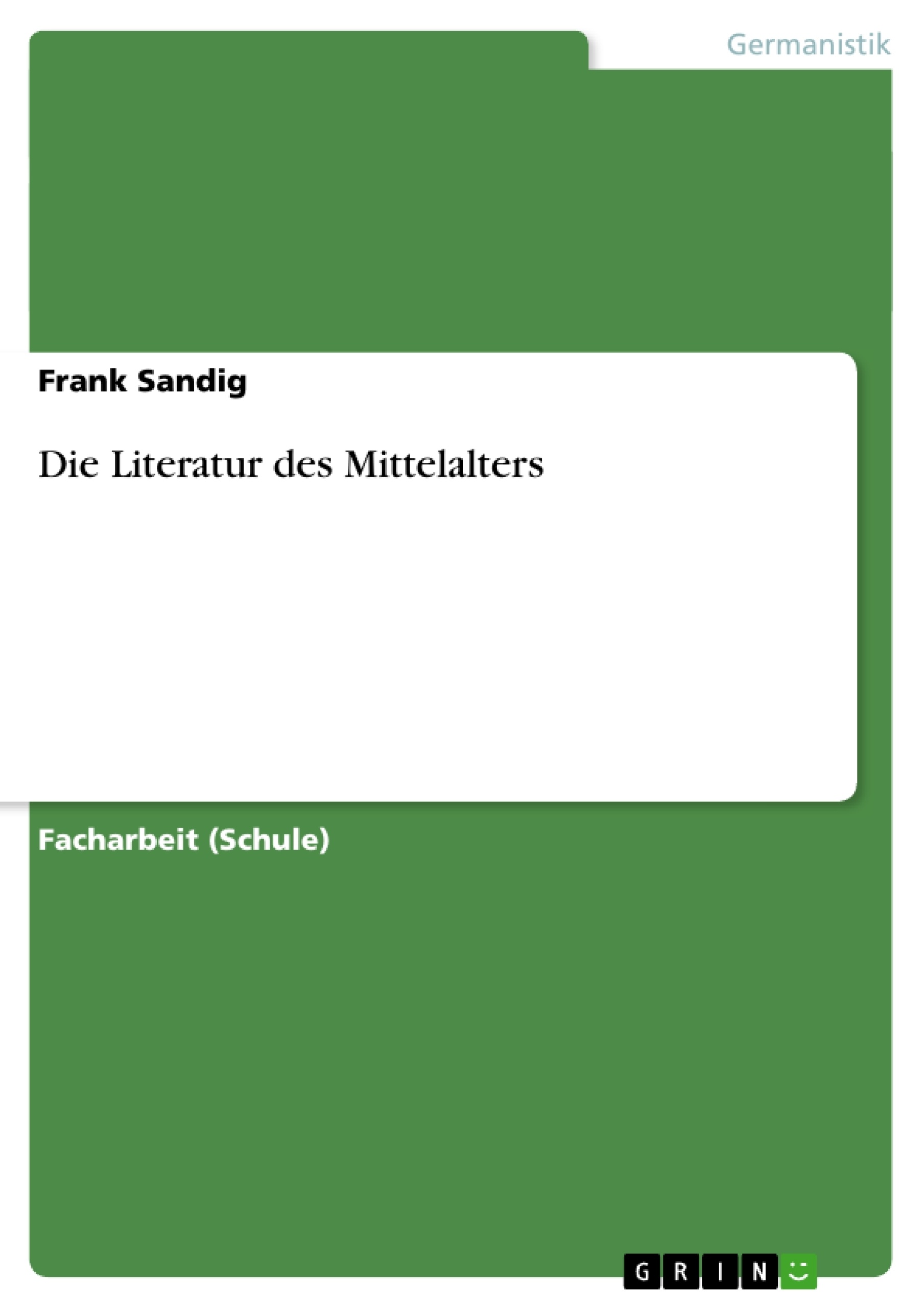Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung - Definition „Mittelalter“
2. Die historischen Verhältnisse zur Zeit des Mittelalters
2.1 Frühes Mittelalter - 750 bis 1170
2.2 Hohes Mittelalter - 1170 bis 1270
2.3 Spätes Mittelalter - 1270 bis 1470
3. Verbindungen zwischen der Suche nach dem heiligen Gral und den Mythen des Mittelalters
3.1 Der frühchristliche Ursprung der Gralsmythologie
3.2 Die Vermischung christlicher Inhalte mit keltischen Sagen
3.3 Der heilige Gral in der Artussage
3.4 Parzival
3.4.1 Hintergründe
3.4.2 Inhalt
4. Die Artussage und das Nibelungenlied: ein Vergleich
4.1 Zeitliche Einordnung und Typ des mittelalterlichen Epos
4.2 Unterschiedliche Ehrauffassungen - Hagen von Tronje und Lancelot
5. Anhang
5.1 Literaturverzeichnis
5.1.1. Literatur/Bücher/Nachschlagewerke
5.1.2. Internetquellen
5.2 Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung - Definition „Mittelalter“
Der Begriff Mittelalter stammt aus dem Lateinischen (medium aevum) und bezeichnet in Mitteleuropa den Zeitraum zwischen Antike und Neuzeit. Eine genaue Abgrenzung dieses Zeitraumes ist jedoch auf Grund der national unterschiedlichen historischen Entwicklungen kaum möglich. Die möglichen zeitlichen Ansätze für den Beginn des Mittelalters reichen von der Krise des röm. Reiches im 3. Jh. n. Chr. über die Zeit der Völkerwanderung (4. - 6. Jh. n. Chr.), die jeweils große gesellschaftliche Änderungen mit sich brachten, bis hin zur Kaiserkrönung Karls des Großen im Jahre 800.
Ebenso schwer lassen sich genaue Angaben über das Ende des Mittelalters machen. Nach her- kömmlicher Auffassung setzt man das Ende des Mittelalters mit dem Beginn der Barockzeit gleich und stützt sich dabei auf unterschiedliche geschichtliche Ereignisse zu Beginn des 16. Jh. wie die Entdeckung Amerikas (1492) oder den Beginn der Reformation (1517) u. a., die ebenfalls gesellschaftliche Umbrüche bewirkten. Natürlich lässt sich der Übergang eines Zeitalters in das Nächste nicht punktuell festlegen, vielmehr muss jeweils eine längere Übergangszeit voraus- gesetzt werden.1 In dieser Arbeit beziehe ich mich auf die allgemein übliche Begrenzung des Mittelalters auf die Zeit zwischen 750 und 1470 n. Chr.
Im Rahmen der Facharbeit gilt es, einen historischen Überblick über diesen Zeitraum zu erarbeiten sowie Besonderheiten der Literatur dieser Zeit durch den Bezug zu Mythen und Sagen und einen Literaturvergleich darzustellen.
2. Die historischen Verhältnisse zur Zeit des Mittelalters
2.1 Frühes Mittelalter - 750 bis 1170
Die Gründung des Frankenreiches schuf als bedeutendste germanische Staatsgründung die Voraus- setzungen für die Kultur und Gesellschaftsordnung des Mittelalters.
Die Christianisierung der Franken begann um etwa 500 n. Chr.2 Dieser Umbruch zwischen dem „alten Weg“, der polytheistischen keltischen Religion und dem „neuen Weg“, dem christlichen Glauben war Ursache verschiedenster Konflikte, die ihre Bearbeitung in zeitgenössischer Literatur bzw. mündlich überlieferten Sagen und und Erzählungen (wie z. B. den Einzelsagen des in späterer Zeit niedergeschriebenen Nibelungenliedes) fanden.
Im 9. Jh. enstanden durch mehrer Erbteilungen das West- und das Ostfränkische Reich (ab etwa 920
regnum teutonicum, Kaiserreich von 962 bis 1806).3
Von Beginn an ist die mittelalterliche Kultur christlich geprägt. Karl d. Gr. versuchte, die antike Kultur mit ihrem System der sieben freien Künste (Wissenschaften) wiederzubeleben.
In dieser Zeit wurde auch mit der Aufarbeitung und Niederschrift der bis dahin nur mündlich überlieferten Heldensagen wie z. B. dem Hildebrandslied begonnen. In das Feudalssystem des frühen Mittelalters war die Kirche aufgrund gegenseitiger Schutz- und Treueverpflichtungen stark eingebunden. Der kirchliche Einfluss wurde durch den Auftrag Karls d. Gr., den Bildungsstand durch das Einrichten von Schulen in jeder Bischofskirche und in jedem Kloster zu verbessern, noch vergrößert.4
Als Amts-, Gelehrten- und Kirchensprache diente im frühen Mittelalter das Mittellatein, neben dem als Volkssprache die sog. „ theodisca lingua “ besteht. Daraus entwickelte sich über die althoch- deutsche (um 750) ab etwa 1050 die mittelhochdeutsche Stufe der dt. Sprache.
Die bisher als Schriftzeichen dienenden Runen werden vom lateinischen Alphabet abgelöst, wobei Karl d. Gr. eine Vereinfachung schafft, indem er die Kleinbuschstaben einführt. Als Schreib- utensilien dienten damals Gänsekiel und Pergament, welches in Mitteleuropa erst gegen 1400 vom Papier abgelöst wurde.5
Aufgrund der Abgrenzung zwischen handwerklichen Künsten und freien Künsten (zu denen nur die Wissenschaften gezählt wurden) zählte die Schreibkunst zu den handwerklichen Künsten.
Der Schreiber, der im Kloster Werke handschriftliche vervielfältigte, genoss einen ähnlichen Status wie der tatsächliche Urheber (lat. Auktor).
Die Bibelabschriften (komplett oder teilweise) besaßen den höchsten Rang unter den Werken jener Zeit, waren aber, auf Grund der lateinischen Sprache und dem Bildungsstand des größten Teiles der Bevölkerung, nur dem Klerus zugänglich. Dem leseunkundigen Volk wurden biblische Inhalte durch Wandmalereien in der Kirche vermittelt, denn selbst die Predigten waren im für die breite
Masse unverständlichen Latein gehalten. Ein Werk des frühen Mittelalters, welches zeigen sollte, dass die deutsche Volkssprache ebenfalls geeignet ist, die damals so hoch geschätzte Antike Dicht-
kunst nachzuempfinden war die „Evangelienharmonie“ (um 865) des Mönchs Otfried aus dem elsässischen Kloster Weißenburg. Ebenfalls von Geistlichen verfasst wurden in dieser Zeit Chroniken, zeitgeschichtliche Darstellungen und romanhafte Lehrwerke.
Die fahrenden Unterhaltungskünstler verfassten ihre sog. „Spielmannsepen“ meist in der dt. Volks- sprache bzw. deren Dialekten.
Das Theaterspiel war im frühen Mittelalter im wesentlichen auf den geistlichen Bereich beschränkt. Die inszenierten Bibeltexte wurden zu besonderen Anlässen in Gottesdiensten oder öffentlich aufgeführt.6
2.2 Hohes Mittelalter - 1170 bis 1270
Aus politischer Sicht deckte sich diese Epoche im Großen und Ganzen mit der Stauferherrschaft (1138
- 1254). Sie war gekennzeichnet durch die zunehmende Selbstständigkeit der weltlichen wie geistlichen Landesherren und die Entwicklung eines höfisch-kulturellen Lebens an den
Residenzen der Fürsten einerseits sowie den Grundlagen der bürgerlichen Kultur in den Städten andererseits.7
In dieser Zeit entwicheln sich durch Enstehung einer neuen Gesellschaftsschicht, des Rittertums, die Ideale des Ritters: Maß, Beständigkeit, Treue und Selbstzucht. Das Rittertum ermöglichte ursprünglich unfreien Ministerialien den Aufstieg in den niederen Adel. Die ritterlichen Ideale finden im Minnesang wie in epischen Werken dieser Zeit (z. B. Eschenbachs „Parzival“) Ausdruck, ebenso der Niedergang des Rittertums gegen Ende der Epoche (z. B. in Wernher der Gartenaeres
„Meier Helmbrecht“).
Wichtige Kennzeichen der Entwicklung von Sprache und Schrift sind u. a. die wachsende Akzep-tanz der dt. Volkssprache als gleichberechtigte Literatursprache neben dem Mittellatein, v. a. im süd- deutschen Raum die Bemühungen zur Schaffung einer gemeindeutschen Hochsprache und im
12. Jh. die Entwicklung der gotischen Kleinbuchstaben aus den Karolingischen.8
Bedeutende Autoren des hohen Mittelalters sind Konrad von Würzburg, Hartmann von Aue, Neidhart von Reuental, Reinmar der Alte, Walther von der Vogelweide und Wolfram von Eschenbach; meist waren sie Abkömmlinge eines Ministerialiengeschlechts oder bürgerlicher Herkunft. I. d. R. zogen sie von Hof zu Hof, um ihre Werke vorzutragen. Die Minnesänger waren dabei zugleich Dichter und Musiker, da sie ihre Werke singend zur Begleitung von Harfe oder Fidel
vortrugen. Ebenso die sog. Vaganten, fahrende Geistliche oder Akademiker.
Die Werke jener Zeit waren meist Auftragsdichtungen, die Autoren von ihren Mäzenen (Gönnern) abhängig. Als Auftragswerke entstanden im hohen Mittelalter u. a. das Rolandslied und das Nibelungenlied.
Der Fähigkeit des Lesens waren damals wohl neben den Geislichen ein großer Teil der adligen Frauen mächtig, die diese Kunst von den Hofgeistlichen erlernten. Dagegen waren die Autoren warscheinlich nicht in der Lage, ihre Werke selbst niederzuschreiben; man nimmt an, dass sie Schreiber beschäftigten.
Das Theaterspiel bleibt im hohen Mittelalter weitgehend an die klerikale Umgebung gebunden, wenngleich es auch Einflüsse der höfischen Epik zeigt (wie beispielsweise das um 1250 entstandene „Osterspiel von Muri“).9
[...]
1 vgl. BROCKHAUS Bd. 14, S. 668 ff.
2 vgl. C. WETZEL „Literaturbetrieb Kurzgefasst“, S. 4, Klett
3 vgl. ebd.
4 vgl. C. WETZEL „Literaturbetrieb Kurzgefasst“, S. 4, Klett
5 vgl. ebd.
6 vgl. ebd, S. 4. u. 5
7 vgl. C. WETZEL „Literaturbetrieb Kurzgefasst“, Klett S. 6
8 vgl. ebd.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieser HTML-Datei?
Diese HTML-Datei enthält einen Auszug aus einem Dokument über das Mittelalter, wahrscheinlich eine Facharbeit oder ein Skript. Es gibt eine Einführung, Definitionen, historische Hintergründe, Verbindungen zwischen der Gralsuche und mittelalterlichen Mythen, einen Vergleich zwischen der Artussage und dem Nibelungenlied sowie einen Anhang mit Literaturverzeichnis und Abkürzungsverzeichnis.
Was sind die zeitlichen Schwerpunkte des Dokuments?
Das Dokument konzentriert sich auf drei Phasen des Mittelalters: das frühe Mittelalter (750 bis 1170), das hohe Mittelalter (1170 bis 1270) und das späte Mittelalter (1270 bis 1470).
Welche Themen werden im Zusammenhang mit dem heiligen Gral behandelt?
Das Dokument behandelt den frühchristlichen Ursprung der Gralsmythologie, die Vermischung christlicher Inhalte mit keltischen Sagen, den heiligen Gral in der Artussage und insbesondere die Figur des Parzival, inklusive Hintergründe und Inhalt der Parzival-Erzählung.
Wie werden die Artussage und das Nibelungenlied verglichen?
Es werden die zeitliche Einordnung und der Typ des mittelalterlichen Epos verglichen, sowie unterschiedliche Ehrauffassungen, dargestellt am Beispiel von Hagen von Tronje und Lancelot.
Welche historischen Ereignisse werden als Wendepunkte des Mittelalters genannt?
Als mögliche Beginn-Punkte des Mittelalters werden die Krise des römischen Reiches im 3. Jahrhundert n. Chr., die Völkerwanderung (4.-6. Jh. n. Chr.) und die Kaiserkrönung Karls des Großen im Jahr 800 genannt. Als Endpunkte werden die Entdeckung Amerikas (1492) und der Beginn der Reformation (1517) genannt.
Welche Rolle spielte die Christianisierung im frühen Mittelalter?
Die Christianisierung der Franken um etwa 500 n. Chr. war ein wichtiger Umbruch, der Konflikte zwischen dem "alten Weg" (polytheistische keltische Religion) und dem "neuen Weg" (christlicher Glaube) verursachte. Diese Konflikte fanden ihren Niederschlag in zeitgenössischer Literatur und mündlich überlieferten Sagen.
Wie wirkte sich Karl der Große auf die Bildung und Kultur im frühen Mittelalter aus?
Karl der Große versuchte, die antike Kultur mit ihrem System der sieben freien Künste wiederzubeleben. Er ordnete die Einrichtung von Schulen in jeder Bischofskirche und jedem Kloster an, um den Bildungsstand zu verbessern. Außerdem förderte er die Aufarbeitung und Niederschrift mündlich überlieferter Heldensagen.
Welche Sprachen wurden im frühen Mittelalter verwendet?
Als Amts-, Gelehrten- und Kirchensprache diente Mittellatein. Daneben existierte die Volkssprache "theodisca lingua", aus der sich über das Althochdeutsche (um 750) ab etwa 1050 das Mittelhochdeutsche entwickelte.
Welche Rolle spielten Klöster und Schreiber im frühen Mittelalter?
Schreiber in Klöstern vervielfältigten Werke handschriftlich und genossen einen ähnlichen Status wie die Urheber (Auktoren). Bibelabschriften hatten den höchsten Rang. Da die meisten Menschen des Lesens unkundig waren, wurden biblische Inhalte durch Wandmalereien in Kirchen vermittelt.
Was kennzeichnet das hohe Mittelalter (1170-1270) politisch und kulturell?
Diese Epoche deckt sich weitgehend mit der Stauferherrschaft. Sie war gekennzeichnet durch die zunehmende Selbstständigkeit der weltlichen und geistlichen Landesherren, die Entwicklung eines höfisch-kulturellen Lebens und die Grundlagen der bürgerlichen Kultur in den Städten.
Welche Ideale des Rittertums prägten das hohe Mittelalter?
Die Ideale des Ritters waren Maß, Beständigkeit, Treue und Selbstzucht. Das Rittertum ermöglichte ursprünglich unfreien Ministerialien den Aufstieg in den niederen Adel. Diese Ideale fanden ihren Ausdruck im Minnesang und in epischen Werken wie Eschenbachs "Parzival".
Welche Bedeutung hatte die deutsche Volkssprache im hohen Mittelalter?
Die deutsche Volkssprache wurde als gleichberechtigte Literatursprache neben dem Mittellatein akzeptiert. Es gab Bemühungen zur Schaffung einer gemeindeutschen Hochsprache. Im 12. Jahrhundert entwickelten sich die gotischen Kleinbuchstaben aus den karolingischen.
Wer waren die bedeutenden Autoren des hohen Mittelalters?
Bedeutende Autoren waren Konrad von Würzburg, Hartmann von Aue, Neidhart von Reuental, Reinmar der Alte, Walther von der Vogelweide und Wolfram von Eschenbach. Sie waren meist Abkömmlinge eines Ministerialiengeschlechts oder bürgerlicher Herkunft und zogen von Hof zu Hof, um ihre Werke vorzutragen.
Wie wurden die Werke im hohen Mittelalter verbreitet?
Minnesänger und Vaganten trugen ihre Werke singend zur Begleitung von Harfe oder Fidel vor. Die Werke waren oft Auftragsdichtungen, die Autoren waren von ihren Mäzenen (Gönnern) abhängig.
Wer konnte im hohen Mittelalter lesen?
Neben den Geistlichen konnte wahrscheinlich ein großer Teil der adligen Frauen lesen, die diese Kunst von den Hofgeistlichen erlernten. Die Autoren waren wahrscheinlich nicht in der Lage, ihre Werke selbst niederzuschreiben, sondern beschäftigten Schreiber.
Welche Rolle spielte das Theaterspiel im hohen Mittelalter?
Das Theaterspiel blieb weitgehend an die klerikale Umgebung gebunden, zeigte aber auch Einflüsse der höfischen Epik, wie beispielsweise das um 1250 entstandene "Osterspiel von Muri".
- Citar trabajo
- Frank Sandig (Autor), 2001, Die Literatur des Mittelalters, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109020