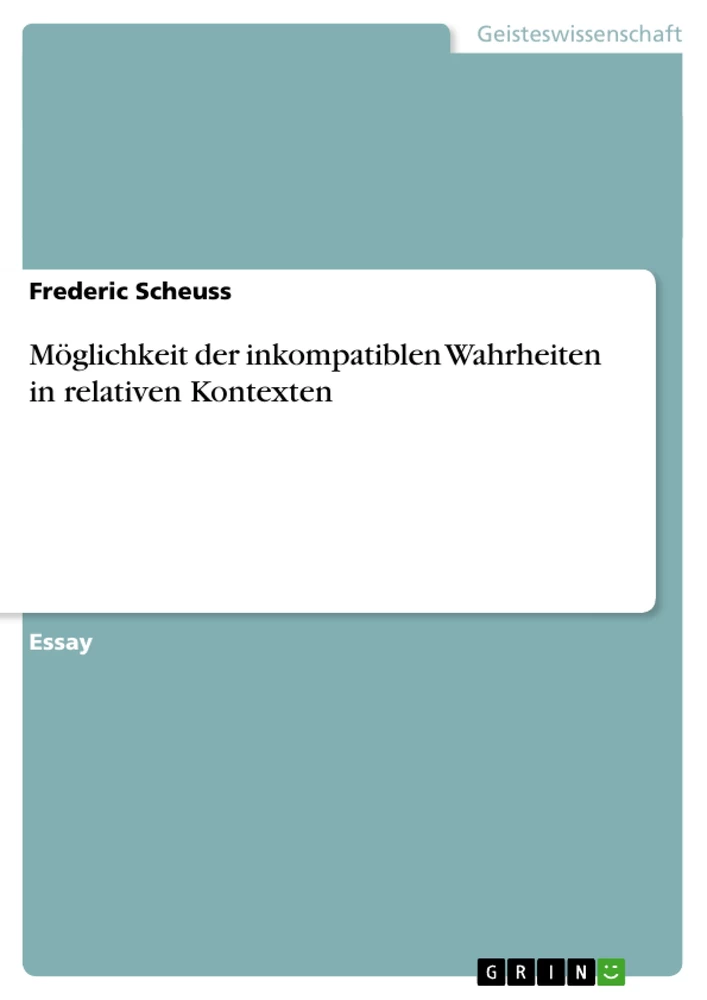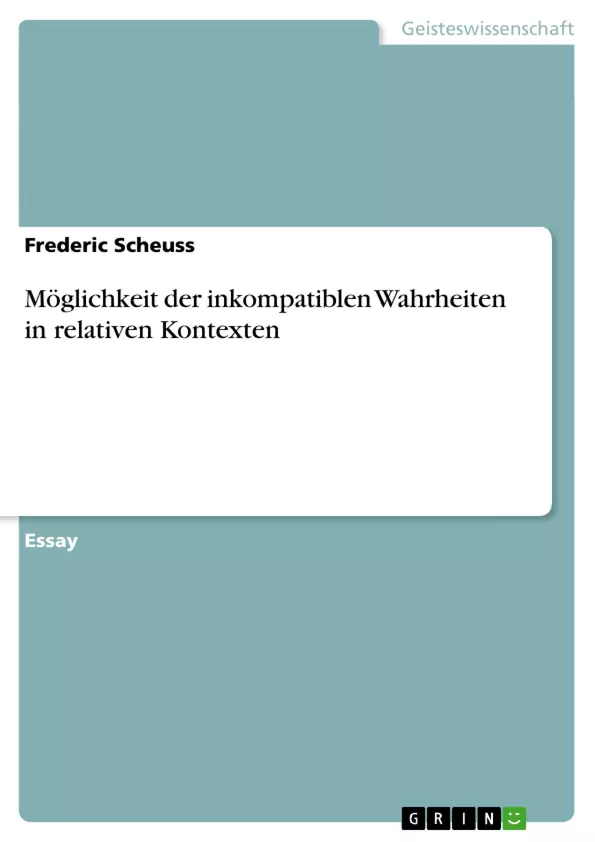Zunächst werden entlang der Kapitel 2 und 3 von Truth in Context (TiC) die Begrifflichkeiten der „conceptual schemes“ im Allgemeinen und die der „minimal“ und „robust concepts“ in Abgrenzung zu anderen Verständnisweisen (Quine, Kant, Wittgenstein) dieser Begriffe kritisch beleuchtet. Im Kapitel IV dieser Arbeit wird ein Einblick gegeben, wie diese Konzeptgestalt sich in anderer Art explizieren kann. Darauf folgend wird untersucht, in wie weit das Verständnis dieser Konzepte auf die von Existenz und Objekt im speziellen anwendbar sind (Kapitel 4, TiC) und ob Lynchs Programm, die eine wahre Welt zwischen den pluralistischen Farbtönen und Graustufen zu erhalten, aufgehen kann. Dabei werden aufgrund möglichst authentischer Darstellung und um Verwirrungen zu vermeiden, einige englische Begriffe übernommen[2].
Inhalt
I. Einführung – Die eine plurale Welt. Anything goes? Everything sucks? And nothing matters?
II. Sei nicht so starrsinnig, Immanuel! Quine übertreibt und Wittgenstein kommt der Sache näher. Conceptual Schemes
III. Basale, fluide Minimalkonzepte und der Glaube an die Kommunikation
IV. Herr Lynch, nun werden sie aber indiskret! Indiskret und minimal. Diskret und robust. Ein Vergleich.
V. Wahrheit durch „Was wäre wenn?“? – Das Alles im Fluss.
Quellenverzeichnis und Literatur
I. Einführung – Die eine plurale Welt. Anything goes? Everything sucks? And nothing matters?
Ist Kant ein intoleranter, alter Absolutisten-Sack? Oftmals wird eine pluralistische Weltsicht zum Weichspüler der Erkenntnis. Man könne alles so oder so sehen, und alle haben sie ja irgendwie Recht. Kant schließt dies trotz manchmaliger relativistisch auslegbarer Tendenz aus. Es können nicht alle Recht behalten. Auch nicht irgendwie. Tisch, Hund, Person, Liebe, Moral, Existenz. Begriffe, die eine Entsprechung in der Welt-so-wie-sie-ist haben, vielleicht ohne, dass man sie finden könnte, aber es gibt diese Welt und wir können uns ihr auf eine bestimmt Art und Weise nähern. Kant weiß, wie. Durch ein mental-fundamentales Netzwerk von Begriffen, die unsere Wahrnehmung organisieren. Begriffe sind die Strukturverleiher der wahrgenommenen Welt und können in Sätzen das leisten, was sich der die Weisheit Liebende ersehnt: Wahrheit. Realität ist wahr und absolut. Unabhängig davon, dass Begriffe auch bei Kant freilich mentaler Natur sind, scheinen sie doch irgendwie in der Lage zu sein, die eine wahre Welt abzubilden, so dass alle gemeinsam diesen Abbildungen im Idealfall zustimmen müssen, und zwar nicht deshalb, weil die Abbildungen so exakt der Natur der Welt entsprächen, sondern weil es für Kant nur ein Konzeptschema gibt, innerhalb dessen sich Erkennen vollzieht, nämlich sein eigenes. Aber, Herr Kant, das teilen ja nun mal viele nicht, sehr viele sogar. Postmoderne Alltagsintuition versucht, absoluten Wahrnehmungsstrukturen und –kategorien zu widerstehen, wo sie nur kann. Es scheint nicht erwünscht – vielleicht aus Gründen der Verzweiflung über einen gescheiterten Versuch intersubjektiver Synchronisation der Weltwahrnehmung über Jahrtausende – sagen zu dürfen: So sieht es aus. So ist es. Punkt. Individualisierung auf der Wahrheitsebene: So sieht es für mich aus. So ist es für mich. Kein Punkt. Fragezeichen. Denn es gibt das Du und das Ihr, die es völlig anders sehen, was für das „für mich“ keine Bedrohung zu sein vermag, lediglich eine Bestätigung der eigenen Unklarheit. Das klare und damit auch klar angreifbare Dogma schwindet unter einem immer nur vorläufigen Bekenntnis zu etwas, das sich - im Fluss der Wahrnehmung befindlich - stetig ändern kann. Und Kant kotzt. Aber sicher nicht, weil er die daraus vermeintlich entstehende Toleranz anderen Sichtweisen gegenüber nicht ertragen könnte, sondern weil er schlicht und einfach überzeugt ist, genau wie andere vor und nach ihm. Und da er selbst sehr gut andere absolute Konzepte ertragen kann, sie sogar als fruchtbar - ihm zu arbeitend - empfindet.
Es stellen sich zunächst zwei Probleme:
Erstens, wenn es verschiedene und gleichwertige Perspektiven zu Zuständen, Zusammenhängen, Objekten usf. in der Welt gibt und kein absolutes Wahrheitskriterium für Aussagen zur Verfügung steht, innerhalb dessen diese Perspektiven zu beschreiben versucht werden, endet dies im postmodernen „anything goes“. Alles ist dann wahr, und nichts. Und dann hieße es vielmehr „everything sucks“. Die Suche nach objektiven Kriterien über die Dinge wird aufgegeben und man findet sich ab, gibt auf. Motivationen dafür liegen auf der Hand. Zunächst steht dort das schlichte Unvermögen, die Komplexität selbst einfach erscheinender Sachverhalte erkennend zu durchdringen, zum anderen winkt der Reiz der vielen Welten oder gar der gar keinen Welt. Und selbst Letzteres ist ja alltäglich kein Problem. Ontologisch freilich schon, da das Sein damit aufhört, in dem es sich in unendlich viele Seins auffaltet oder eben im Nichts auflöst und aus metaphysischer Perspektive erlischt. Tod der Metaphysik.
Zweitens, erwächst zwar aus einer absolutistischen Ontologie nicht unmittelbare Intoleranz anderen System gegenüber, jedoch entstehen dadurch zweifelsohne enge, scharfe Kommunikationsgrenzen innerhalb konzeptueller Schemata, die doch im Endeffekt andere Sichtweisen kategorisch ausschließen. Es kann nicht so UND so sein. Hier widerspricht ein absolutistischer Ansatz der individualistischen Intuition so stark, dass er dieser unerträglich werden mag. Er verweigert sich Einsichten wie denen, dass es kein Ding und kein Zustand ohne Kontext gibt und dass diese Kontexte sich u.a. durch subjektive Vorgeschichten, Befindlichkeiten, Vorlieben der Betrachtenden etc. konstituiert und die Wahrnehmung des Wahrzunehmenden verzerrend färben können. Absolutismus setzt die Möglichkeit voraus, sich – zumindest als Philosoph - ganz und gar durch intellektuelle Abstraktion von jener Färbung befreien zu können. Ein unrealistischer Versuch eines Befreiungaktes?
Michal P. Lynch nimmt sich diesen beiden Seiten der einen Problemmedaille in Truth in Context – An Essay on Pluralism and Objektivity[1] mit einem ontologischen Schulterschluss an. Auf der einen Seite sind Fakten und Sätze relativ zu einer kontextuell abhängigen Weltsicht, andererseits betreffen die fraglichen Fakten die Natur der Realität. Es wird der Versuch unternommen, Pluralismus und Realismus der Wahrheit zu versöhnen, in dem gezeigt werden soll, dass sie kompatibel sind.
Wie dies funktioniert und ob soll im Folgenden kurz analysiert werden. Zunächst werden entlang der Kapitel 2 und 3 von Truth in Context (TiC) die Begrifflichkeiten der „conceptual schemes“ im Allgemeinen und die der „minimal“ und „robust concepts“ in Abgrenzung zu anderen Verständnisweisen (Quine, Kant, Wittgenstein) dieser Begriffe kritisch beleuchtet. Im Kapitel IV dieser Arbeit wird ein Einblick gegeben, wie diese Konzeptgestalt sich in anderer Art explizieren kann. Darauf folgend wird untersucht, in wie weit das Verständnis dieser Konzepte auf die von Existenz und Objekt im speziellen anwendbar sind (Kapitel 4, TiC) und ob Lynchs Programm, die eine wahre Welt zwischen den pluralistischen Farbtönen und Graustufen zu erhalten, aufgehen kann. Dabei werden aufgrund möglichst authentischer Darstellung und um Verwirrungen zu vermeiden, einige englische Begriffe übernommen[2].
II. Sei nicht so starrsinnig, Immanuel! Quine übertreibt und Wittgenstein kommt der Sache näher. Conceptual Schemes
Lynch versucht in Kapitel 2 von TiC „Understanding Conceptual Schemes“, seine Begrifflichkeiten auf insbesondere drei Philosophen anzuwenden, um so zu sein Verständnis von diesen abzugrenzen bzw. durch diese zu erklären. Wie Kant, Quine und Wittgenstein Konzeptschemata verstehen, wird in einer Gegenüberstellung von Antworten auf je vier Fragen an die Philosophen vollzogen. Woraus besteht ein Schema? Welches sind Identitätskriterien für ein Schema? Gibt es eine Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Sätzen?, und schließlich: Was ist die strukturelle Natur eines Schemas?[3] Für Kant sind Konzepte mentaler Natur und organisieren die äußeren Reize und Intuitionen a priori zu bewusster Wahrnehmung. Konzeptschemata sind identisch genau dann, wenn sie die selben kategorialen und formalen Konzepte teilen. Kant unterscheidet Sätze in solche, die ihr Konzeptschema bezeichnen und in solche, die die Welt beschreiben – also ein klarer Gebrauch der Unterscheidung zwischen analytischem (Wahrheit durch den Begriff selbst) und synthetischem Satz (Wahrheit durch den Inhalt des Satzes), so Lynch. Konzeptschemata sind folglich Netzwerke von Konzepten, wobei diese fundamentaler Natur sind, so es sich um formale oder kategoriale handelt. Kants fundamentale Konzepte geben jeglicher weiteren Erfahrung einen kristallinen Rahmen, der unveränderlich, unumstößlich bleibt. Es scheint also, dass solch ein starrer basaler Rahmen für eine pluralistische Theorie nicht von großem Nutzen ist. Dies ist jedoch nicht so ganz der Fall, da auch Lynch erstens an einer Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Sätzen fest hält und zweitens annimmt, dass es Konzepte gibt, die basaler sind als andere, wenngleich auch dieser strukturelle Rahmen innerhalb eines Konzeptschemas nicht absolut ist, sondern der Veränderung unterliegt. Die kantischen Unterscheidungen werden also bei Lynch erhalten, bleiben aber schwammig.[4]
Auch in der Interpretation Quines gibt es Konzeptschemata als Netzte von Konzepten. Hier jedoch zeigt sich das zu Kant entgegengesetzte Paradigma: Kein einziges Konzept ist nämlich in Lynchs Sicht über Quine basal oder auch nur basaler als ein anderer. Jedes Konzept unterliegt zu jeder Zeit der Möglichkeit der Revision und keines der Konzepte ist in diesem Netzwerk stärker daran beteiligt, es zusammen zu halten als ein anderes. Konzeptschemata sind bei Quine Sprachen, die identisch miteinander sind nur dann, wenn sie gegenseitig übersetzbar sind, also verschiedene phonetische Abfolgen exakt gleiche begriffliche Extensionen teilen. Ein Konzeptschema ist folglich ein Set von Sätzen, die wir als wahr akzeptieren[5]. Auch Sätze wie „Der Papst ist katholisch“ oder „Alle Orangen sind Früchte“ sind reversibel ebenso wie „Alle Junggesellen sind unverheiratet.“ Wahrheit qua Begriff ist bei Quine nicht denkbar. Dahinter steht freilich die Sichtweise, dass ein gesamt-sprachlicher Körper der Welt gegenübersteht, der aber nur ein sprachlicher Rahmen ist, kein Erkenntnis- oder Wahrheitsbedingungsrahmen o.ä. „Ein Konzept von oder über etwas haben“ bedeutet, einen Satz zu haben, der als wahr akzeptiert wird. So entfällt natürlich auch die Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Sätzen, wobei man auch sagen könnte, das Quine diese Unterscheidung durchaus macht, lediglich behauptet, dass es analytische Sätze schlicht und einfach nicht gibt. Problematisch ist dies in zwei Hinsichten: Zum einen innersprachlich, zum anderen intersprachlich: Innerhalb einer Sprache der Wissenschaft bspw. ist es nicht möglich, von kontinuierlichen Begriffen oder Konzepten zu sprechen, wenn ein Sachverhalt sich so grundlegend ändert wie der Begriff der Relativität, so Lynchs Beispiel[6], da der Einsteinsche Relativitätsbegriff mit dem von Isaac Newton nichts mehr gemein hätte. Einstein und Newton würden so folglich von etwas völlig anderem Sprechen, da nichts im Konzept der Relativität läge, das ein grundlegendes Verständnis davon ausmachen würde. Lediglich die phonetische Lautabfolge wäre dann die gleiche, die mit dem Wort Relativität verbundene Begriffsdeutung jedoch eine vollkommen verschiedene. Ein Anhänger Newtons hätte sich mit Einstein, nimmt man es genau, gar nicht kontrovers unterhalten können. Da es keine konzeptuelle Wahrheit gibt, sind Konzepte wie „Relativität“ nicht neu definierbar. Mit einer grundlegenden Neu“definition“ wird der Begriff zu zwei Begriffen, die inkommensurabel sind. So aber sind Konzepte und Sätze niemals in der Lage, Wahrheit zu repräsentieren, sondern immer nur deklarativer Natur. Das findet Lynch natürlich nicht hilfreich, da er ja gerade versucht, Konzepte pluralistisch zu interpretieren, ohne dabei das Moment der Objektivität völlig aufzugeben. Außerdem kann es hier keine Inkompatibilität von wahren Sätzen geben und schließlich gehört auch dies an zentraler Stelle zu Lynchs Programm. Denn durch die Unvergleichbarkeit von Begriffen entfällt auch die Möglichkeit der Inkompatibilität.
Intersprachlich ergibt sich nun das Problem, dass wir unverständlichen Sprachen nicht zusprechen könnten, dass auch diese Wahrheiten in sich bergen oder gar überhaupt Konzepte enthalten – außerirdische „Sprachen“ beispielsweise, die unübersetzbar sind, könnten wir gleich gar nicht als Sprachen identifizieren, die Konzepte enthalten. Folglich schließt dies die Möglichkeit aus, dass es überhaupt alternative Begriffe zu denen gäbe, die übersetzbar (und damit ja identisch) wären[7]. Wenn das Identitätskriterium von Sprache, und somit auch das von Konzeptschemata, Übersetzbarkeit ist, dann ist in unübersetzbare Sprache auch nicht als alternative Sprachen identifizierbar. Dass Lynch dagegen nur mit der theoretischen Möglichkeit einer unbekannten, außerirdischen Sprache aufwartet, erscheint zunächst ein wenig unglücklich. Aber man muss ja schließlich mit allem rechnen innerhalb der Metaphysik, warum also auch nicht mit außerirdischen Konzepten von etwas? Theoretisch versteht sich. Naja. Jedenfalls ist es offensichtlich, und dieser Meinung ist auch Lynch, dass eine Sprache aus mehr besteht als aus wahren oder falschen Sätzen, sie ist eben nicht ausschließlich deklarativer Natur[8]. Sprachlich explizierte Konzepte hängen auch immer mit Emotion, Assoziationen, Kultur u.v.m. zusammen. Jemand, der Schweinefleisch mag und sich mit einem koscher lebenden Juden über Schweinefleisch unterhält, wird dabei die gleiche oberflächliche Extension des Konzepts Schweinefleisch haben wie Aussehen, Verarbeitungsmöglichkeit, Geruch, u.U. Geschmack und dennoch ist für einen Juden Schweinefleisch etwas vollkommen anderes als für den Schweinefleisch-Liebhaber, der ein Mettbrötchen in der Hand hält und der Begriff Schweinefleisch wird im jiddischen oder hebräischen bedeutungsrelevant stark schwanken, ohne dass das Konzept nicht übersetzbar wäre. Also, Guten Appetit!
Schließlich Wittgenstein. Das gefällt dem Herrn Lynch schon besser. Denn er interpretiert Wittgenstein so: Konzeptschemata sind ein Fluss, wobei das Flussbett das Fundament von Konzepten bildet, das durch das Flussbett fließende Wasser hingegen repräsentiert die Konzepte, die weniger basal sind und folglich auch leichter Veränderungsmöglichkeiten unterliegen. Oder anders: Wittgenstein macht hier zwar eine Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Sätzen, aber diese Unterscheidung ist nicht so starr wie bei Kant, da auch ein starkes Flussbett sich unter Umständen einem starken Strom neuer, sich entwickelnder Meinung ergeben kann und so auch der Revision unterliegt, und nicht aufgehoben wird - wie bei Quine. Mit Putnam gesprochen ist die Unterscheidung die zwischen concept und conception[9] – zwischen essentieller Form und nicht essentieller begründeter Meinung, wobei die sich im Fluss befindlichen Meinungen fundamental von der Form des Flussbettes abhängig sind. Es ist ja nicht so, als hätte die Physik nach Einführung der Super-String-Theorie Einstein nicht mehr begreifen können. Wer am Rhein lebt weiß, wie viel Zeit es braucht, damit ein Fluss seinen Fließbereich verlässt[10]. Ein umgestoßener Gravitationsbegriff bedeutet hier eben keine Inkommensurabilität und die Kontinuität wissenschaftlicher Prozesse bleibt erhalten. Zudem trägt diese Sichtweise dem Gedanken Rechnung, dass der Status einer Proposition nicht kontextuell unabhängig ist, da auch der Fluss wiederum durch eine Landschaft fließt, eine Metapher, die Lynch so nicht weiter spinnt. Er spricht hier vom „nitty-gritty of life“[11] Der Unterschied zwischen Konzeptschemata liegt hier nicht im Unterschied oder in der Unübersetzbarkeit von Sprachen, sondern im Nicht-Teilen basaler Konzepte wie Raumzeit, Substanz, Moral, Person, Identität etc. Begriff und Inhalt werden hier von einander abstrahiert betrachtet. Dieser Unterschied ist folglich formal durchdringlich, nicht inhaltlich-funktional. Kant hingegen hatte diese Unterscheidung auch inhaltlich fundamental verstanden. Das Problem der Inkommensurabilität drängt sich nur auf, wenn verschiedene konzeptuelle Schemata basale Konzepte nicht teilen.
III. Basale, fluide Minimalkonzepte und der Glaube an die Kommunikation
Soweit ein Überblick darüber, wie Lynch sein Konzept von konzeptuellen Schemata entwickelt. Aber es geht noch weiter. Mit der Adaption der Wittgensteinschen Flussbettmetapher ist der weitere Verlauf bereits angedeutet, wenn es nun um die Entscheidung geht, ob konzeptuelle Schemata kristalliner oder fluider Natur sein sollen und zu erklären versucht wird, inwiefern sie sich global und individuell ändern können bzw. inwieweit sich auch nicht identische konzeptuelle Schemata überlappen können. Und DASS dies geschieht, ist offensichtlich – Teil alltäglicher Erfahrung. Annahmen und Behauptungen, Meinungen und Propositionen sind nur in ihrem konzeptuellen Kontext zu verstehen. Ein Konzept ist für Lynch eine Art und Weise, wie über etwas gedacht wird[12]. Zunächst einmal ist das für individuelle Konzepte der Fall. Dabei bleibt es freilich nicht, da Lynch ja im Endeffekt ein metaphysischen Programm hat und seine Vorstellung noch versuchen wird auf metaphysische Konzepte wie Objekt und Existenz anzuwenden[13]. Die gefällt Entscheidung Lynchs ist klar. Im Gegensatz zu Anhängern kristalliner Konzepte[14], die scharfe, klare und determinierende Begriffsgrenzen als konzeptuelles Ideal postulieren[15], bevorzugt er das fluide Konzeptmodell, in dem zwar ebenso Konzepte als fest stehend gültig für aktuelle Situationen und Debatten gesehen werden, jedoch für potentielle und zukünftige Anwendungen offen bleiben. Junggesellen sind keine verheirateten Männer und werden und können es niemals sein (kristallin). Junggesellen sind nicht verheiratet. Punkt (fluid). Ein fluides Konzept ist also durchaus exakt anwendbar, aber nicht unbedingt immer gültig. Für dieses Beispiel ist es schwer verständlich, in wie weit es nicht mehr zu dem Konzept „Junggeselle“ gehören könnte, dass die Extension dieses Begriffes ein unverheirateter ist[16]. Dass aber mittlerweile auch Frauen Junggesellenabschiede feiern, spricht wiederum dafür, dass sich solche Konzepte im Fluss befinden. Dass Konzepte auch ohne schlussendliche Determination klar und deutlich anwendbar sind, zeigt Lynch einmal mehr mit dem Wittgensteinschen Spielbeispiel: Es gibt keine feste Definition von Spiel als hinreichend und notwendige Größe für jede Form des Spiels oder für alle Sachverhalte, die ein Spiel sein könnten – potentiell oder zukünftig. Dennoch ist der Begriff Spiel gut anwendbar. Krieg bspw. hat einige Komponenten, die auch Spiele oder sportliche Wettkämpfe haben. Mehrere Parteien, die mehr oder weniger anhand eines Regelwerks operieren, versuchen, durch Strategie, den Einsatz ihres Körpers, durch List etc. das Ziel des Sieges zu erreichen und damit den Vorgang zu beenden. Außerhalb einer zynischen Haltung würde aber niemand den Krieg als ein Spiel bezeichnen wollen. Jedoch verläuft nicht jedes Spiel friedvoll, sondern kann auch durchaus starke kriegerische Züge oder sogar direkte Simulation einer kriegerischen Handlung tragen. So würde auch niemand außerhalb einer esoterisch-heilpädagogischen Haltung darauf kommen, ein computersimuliertes Kriegsspiel auch tatsächlich als Krieg bezeichnen zu wollen. Die Dinge, die unter das Konzept „Spiel“ fallen, sind also nicht für immer und ewig exakt zu bestimmen, sondern sind untereinander familienähnlich und folgen - auf ihren Anwendungsbereich bezogen - historischen Paradigmen. Das, was ein Spiel ist, definiert sich qua gegebene bisherige Anwendungen.
Spiel dient hier also als ein Standardbeispiel für ein Konzept, das im Fluss ist, über etwas, das im Fluss ist. Dem kristallinen Konzept von etwas steht dieses Etwas nämlich als ebenso kristalline, unveränderliche „So und genau so ist die Welt“-Größe gegenüber, während dem fluiden Konzept von Dingen, Zuständen, Sachverhalten eine veränderliche, ebenso fluide und flexible Welt entspricht, die außerhalb eines Kontextes gar nicht statt finden kann, jedenfalls nicht auf die Weise, dass sie uns etwas zu sagen hätte bzw. dass wir etwas über sie sagen könnten. Folglich ist es, so Lynch, zwecklos, die Essenz oder die allgemeine Eigenschaft, die ein Konzept expliziert, zu untersuchen[17], da es so etwas nicht geben kann.
Er trifft eine Unterscheidung, die implizite bereits in Kapitel II besprochen wurde. Minimalkonzept vs. robustes Konzept. Ein minimales Konzept ist ein graduell von einem robusten Konzept unterschieden, insofern es basaler und allgemeiner in seiner Anwendung ist. Das Minimal Konzept von Schweinefleisch könnte einschließen, dass es ein Stoff ist, der aus Teilen eines Hausschweins abstammt. Ein robusteres Schweinefleischkonzept könnte beinhalten, dass es sich um ein Nahrungsmittel handelt. Nun ist für einen Juden Schweinefleisch nicht unbedingt ein Nahrungsmittel. Dennoch könnten sich ein Besitzer einer Imbissbude und ein Jude über Schweinefleisch unterhalten, ohne aneinander vorbeireden zu müssen, obwohl sie das robuste Konzept nicht teilen. Sie haben beide eine Art grundlegende Vorstellung von dem, was Schweinefleisch ist. Was in diesem Fall ein robustes Konzept ist, kann in einem anderen Kontext wiederum als Minimalkonzept fungieren; dann nämlich wenn sich ein fachlich unbedarfter Fleischkonsument mit einem Metzger unterhält. Beide Teilen dann die Vorstellung als Minimalkonzept, dass Schweinefleisch ein Nahrungsmittel ist, das aus Teilen hergestellt wird, die vom Hausschwein abstammen, wobei der Metzger natürlich darüber hinaus durch seine fachliche Kompetenz bezüglich der Verarbeitungsmöglichkeiten von Schweinefleisch andere Dinge darüber zu sagen vermag als der Konsument. Und auch hier können die Meinungen über Schweinefleisch auseinander gehen, ohne dass beide nicht genau wüssten, wovon sie reden. Hier zeigt sich eine wichtige Sache: Auch das Konzept vom Konzept (minimal oder robust) ist zu jeder Zeit im Fluss, abhängig von dem Kontext, in dem es sich expliziert. Ein Konzept von etwas kann in einem Fall als minimal, im anderen als robust bezeichnet und angewandt werden – je nach Kontext. Philosophen, Naturwissenschaftler und Theologen können kontrovers über Gott, Seele und Senfkörner diskutieren, obwohl Senfkörner im engeren Zusammenhang für den jeweiligen Wissenschaftler innerhalb seines wissenschaftlichen Kontextes völlig andere Bedeutungen gewinnen können. Alle teilen ein minimales Konzept über die zu diskutierenden Dinge, das sich lediglich in verschiedenartige robuste Konzepte extendiert. Die Extension des Minimalkonzeptes hinein in ein robustes Konzept macht den Unterschied aus, verhindert aber aufgrund des „mitschwingenden“ Minimalkonzeptes den intersubjektiven bzw. interdisziplinären Diskurs über ein Ding oder einen Sachverhalt nicht. Dass Senfölglucoside (Glucosinolate) charakteristische Inhaltsstoffe von Pflanzen aus der Überordnung Capparanae sind oder dass das pflanzeneigene Enzym Myrosinase zu den für Geschmack und Geruch typischen Senfölen und Nitrilen gehört und somit der Pflanze einen Schutz vor Fraßschäden und mikrobiellem Befall bietet, ist sicherlich eine extrem robuste Extension des Konzeptes Senfkorn, die dem Theologen für eine Interpretation des Gleichnisses vom Senfkorn[18] nicht hilfreich werden wird. Trotzdem hindert es die beiden Wissenschaftler längst nicht daran, sich im Allgemeinen über Senfkörner zu unterhalten. Ein Kognitionswissenschaftler benutzt den Begriff Geist, Seele o.ä. ebenso wie ein Theologe. Teilen beide ein minimales Konzept dieser fluiden Begriffe, können sie begründete Meinungen, die sich gegenseitig ausschließen, darüber äußern, ohne dass der eine nicht mehr wüsste, von was der andere spricht und – und das ist viel wichtiger – beide können wahre Aussagen über Geist und Seele treffen. Das ist es ja, was Lynch eigentlich erreichen will. Zwei Aussagen über genau ein Ding. Beide schließen sich gegenseitig aus. Beide sind wahr. Ginge es nur um die Möglichkeit zur Kommunikation, müsste man kein Pluralist sein. Denn auch der traditionellste Absolutist könnte für einen Moment in einem Anfall von Empathie annehmen, dass die Extension eines Konzeptes seines Gegenübers oder seines wissenschaftlichen Kontrahenten mehr der Realität entspricht als sein eigenes und es anschließend aber wieder verwerfen. Er könnte also nachvollziehen, dass es sich um eine weitere mögliche begründete Meinung von etwas handelt, muss als Absolutist jedoch ausschließen, dass sowohl seine als auch die Aussagen des Gegenübers beide gleichzeitig wahr sind! Minimalkonzepte können also in inkompatible Richtungen extendiert werden, ohne dass eine Richtung falsch oder falscher sein muss als die anderen. Zwei verschiedene Konzeptschemata überlappen sich innerhalb des Minimalkonzeptes und divergieren in ihrer Extension. Die Frage, die sich stellt, ist die, ob das Konzept des Minimalkonzeptes nicht nur schwammig und fluid ist – wie Lynch ja stets bereit ist zuzugeben – sondern ob diese abstrahierte Scheidung eines Konzeptschemas in minimal und robuste Konzepte, nicht zu virtuell sein könnte, um einer metaphysischen Anwendung stand zu halten. Ist es nicht letztendlich doch nur kommunikationserleichternd, ungefähr zu wissen, über was sich zwei Kontrahenten auf der Sachebene unterhalten, damit sie nicht aneinander vorbei reden müssen? Das wäre völlig banal, und der Aufwand hätte sich nun wirklich nicht gelohnt. Das Programm ist ja die faktische Möglichkeit von Wahrheitsgehalt zweier inkompatiblen Aussagen vor. Was also nun, wenn es um grundlegende ontologische Begriffe geht? Bevor dies geklärt wird, sei noch in einem Zwischenteil knapp dargestellt, dass Lynch mit seinem begrifflichen System nicht alleine dasteht.
IV. Herr Lynch, nun werden sie aber indiskret! Indiskret und minimal. Diskret und robust. Ein Vergleich.
Bisher ist das alles nichts sonderlich Neues. Schon 1987 hat Wolfram Hogrebe in einem Aufsatz über die „Vorzüge einer indiskreten Ontologie“[19] eine ähnliche Position vertreten. Er grenzt den Begriff der diskreten Ontologie G. Hasenjaegers[20] gegen seinen Begriff der indiskreten Ontologie ähnlich ab wie Lynch die Begriffe robustes Konzept vs. Minimalkonzept.
Hogrebe kritisiert an einer rein diskreten Ontologie, dass sie als Kondensat ihrer Modellierung von Gegenständen lediglich das übrig behält, über das trennscharfe, klare Aussagen gemacht werden kann und somit einzig und allein nach klarer Information strebt[21]. Dieses Streben nach digitaler Information sei eine Verkürzung und verschließe sich automatisch vor „wichtigen Eigenschaften des natürlichen [menschlichen] Repräsentationssystems“[22], das ebenso auf Schattierungen und Nuancen zielt. Dies sei deshalb so, weil die sprachliche Wiedergabe solcher Nuancen schwerer sei als die klarer (diskret-digitaler) Information über die reduzierte Essenz eines Objektes. Diskret-digital ist eine Information dann, wenn sie propositionalen Charakter hat, indiskret-analog, wenn sie hintergründig-nicht-propositional ist. Zielt eine diskrete Sichtweise auf eine horizontale Ebene des Gegenstandes (Was gibt es? – Alles.)[23], so erfasst die indiskrete nicht alle Dinge, sondern - viel allgemeiner – die Gegenständlichkeit überhaupt – also die vertikale Dimension. Sie zielt „auf das Typische“[24]. Der Unterschied, was sprachliche Konzepte von etwas angeht, ist also der Folgende: Das, was Quine mit der „Ontogenese des Bezeichnens“[25] meint, funktioniert im indiskreten Sinne auf quasi vorsprachlicher Ebene nicht in semantischer Dimension. Sondern aufgrund von heuristischen Tendenzen. Nicht der Terminus und dessen Anwendung legen eine Bedeutung fest, sondern das Ringen um den Terminus erfolgt aus einer Art Selbst-Bedeutung der Gegenständlichkeit heraus. Bei Lynch wäre dies analog der paradigmatische Kontext einer bisherigen Verwendung eines Konzeptes. Erst eine heuristische Vordeutung eines Gegenstandes mündet dann langsam in eine epistemische Bemühung. Auf der indiskreten Ebene geht es also um das generelle Wesen einer Sache, das freilich nicht das assertorische, propositionale Wesen einer Sache meint und auch argumentativ nicht taugt. Hier geht es um eine Art Witterung, ein Ahnen von etwas Allgemeinem[26], also um einen Bereich - im Gegensatz zur diskreten propositionalen Aussage – der eine existentielle Rechtfertigung für Beschreibungen von Gegenständen bereit hält, nicht jedoch eine argumentative. Auf der Basis dieser indiskreten Deutung folgt erst eine zur argumentativen Eindeutigkeit fähige Interpretation des Objektes, die dem menschlichen Streben nach eindeutiger, digitaler Information Rechnung zu tragen in der Lage ist und über Wesensintuition hinaus gehen kann. Freilich gibt es in dieser Auffassung erhebliche Unterscheide zu Lynchs Sicht. Beispielsweise ist sein Minimalkonzept keineswegs vorsprachlich -„mantischer“ Natur. Jedoch lassen sich starke Gemeinsamkeiten ausmachen. Sowohl in indiskreten Aussagen als auch in Minimalkonzepten erscheint das „Irgendwie-So-Wesen“ einer Sache, das einer weiteren propositionalen Extension des vorliegenden Konzepts dient - hinein in ein diskretes robustes Konzept, das wesentlich trennschärfer und eindeutiger ist. Und wenn Hogrebe sagt: „Ein indiskretes Equipment tangiert den Rechtsstand von Assertionen nicht, aber ihre Exklusivität“[27], liegt er mit Lynch auf einer Ebene, da auch der, wie wir im nächsten Kapitel noch weiter sehen werden, das Wahrheitskriterium von Propositionen auf robuster konzeptueller ansiedelt, die Referenz dafür jedoch auf minimaler – indiskreter – Ebene zu finden ist.
V. Wahrheit durch „Was wäre wenn?“? – Das Alles im Fluss.
Zwei Metaphysiker. Ein Sack mit drei Murmeln. Der eine (Johnson) behauptet, es seien drei Objekte (a+b+c) enthalten, der andere (Smith) spricht von sieben Objekten [a+b+c+(a+b)+(a+c)+(b+c)+(a+b+c)][28]. Zwei Aussagen, die inkompatibel sind, aber gleichzeitig beide wahr? Hier geht sich Lynch also selbst an die Wäsche. Inkompatibilität setzt Vergleichbarkeit voraus. Beide Metaphysiker haben unterschiedliche Konzepte von Objekt, so scheint es. Relativ zu ihrem jeweiligen Konzeptschema haben sie also beide wahre Aussagen gemacht. Soweit kein Problem. Da Lynch aber zeigen will, dass die Wahrheitsbedingungen, die darüber entscheiden, was eine wahre und was eine falsche Proposition ausmacht, konzeptuell nicht relativ sind, wird es hier knifflig. Wie geht Lynch vor, um seine Position zu festigen? Er stellt vier Bedingungen auf, die erfüllt sein müssen, damit man von inkompatiblen wahren Propositionen sprechen darf[29]: 1. Smith (S) und Johnson (J) drücken voneinander verschiedene Propositionen aus. 2. S und J drücken inkompatible Propositionen aus. 3. S und J drücken wahre Propositionen aus. 4. S und J reden nicht aneinander vorbei. Sie haben keine völlig unterschiedliche Konzepte von Objekt, Anzahl und Existenz. „3“ ist hier nicht das Problem, da beide Aussagen wahr sein können – relativ zu ihrem Konzeptschema. Dies wiederum versperrte aber den Weg zu einer Inkompatibilität der Aussagen. Ebenso muss „1“ erfüllt sein, damit von Inkompatibilität überhaupt die Rede sein kann. Der Knackpunkt liegt in „4“ und in der Relativierung „keine völlig unterschiedlichen Konzepte“. Lynchs Lösung ist so einfach wie verwirrend: Er benutzt einen kontrafaktualen[30] Beweis, versucht aber zunächst zu zeigen, dass auch die metaphysisch zentralen Konzepte von Objekt und Existenz fluider Natur sind und dass jene Begriffe sich gegenseitig bedingen. Von einem Objekt zu sprechen, so Lynch, heißt, von etwas zu sprechen, das existiert[31]. Existenz kann jedoch keine Eigenschaft von Objekten sein, da dies bedeuten würde, existierende und nicht-existierende Objekte durch die Eigenschaft bzw. durch das Fehlen der Eigenschaft „Existierend“ zu unterscheiden. Die Eigenschaft „Existierend“ wäre, insofern man von „Objekten“ als „ existierende Objekte“ spricht, inhaltslos, da es nicht-existierende Objekt nicht gibt. „Existieren“ kann also nicht als Eigenschaft zu nicht-existierenden Objekten hinzugefügt werden, um sie zu Objekten zu machen. Lynch will damit zeigen, dass ebenso wie für das Konzept Schweinefleisch so auch für das der Existenz, keine absolute Essenz verfügbar ist. Existenz ist graduell ein basalerer Begriff als der des Schweinefleischs – ja sogar quasi der „basalste“ Begriff, da die Existenz im Konzept von Objekt bereits Voraussetzung ist, es wird aber dennoch als fluides Konzept gedacht, da es – ähnlich dem Spiel – keine hinreichende und notwendige Eigenschaft hat, um die Existenz zur Existenz zu machen[32]. Auch das Konzept von Existenz hängt hier von seinem paradigmatischen Gebrauch ab. Da nun S und J Philosophen sind, treffen sie ihre Aussagen in einem paradigmatisch „vorbelasteten“, metaphysischen Kontext.
Ähnlich mit dem Konzept von Objekt: Ist ein Objekt das, auf das in singulären Termini Bezug genommen werden kann, fragt sich Lynch, was sollte das Gegenteil davon sein? So ist doch das Beziehen auf etwas eine menschliche Bewegung und die Eigenschaft, die hier einem Objekt unterstellt würde, wäre eine, die abhängig wäre von einer menschlichen Aktivität[33]. So ist auch diese starre Definition von „Objektheit“ inhaltslos, und so findet sich auch hier keine Essenz oder eindeutige Natur von Objekten. Auch die Anwendung des Objektkonzeptes ist in jedem Fall an seinen paradigmatischen Kontext gebunden.
Die Konzepte von Objekt und Existenz sind also ebenso fluide Konzepte. S und J teilen durch ihr Philosophen-Dasein ein minimales Konzept von Objekt, Existenz und Anzahl, reden also innerhalb dieser Präextensionen nicht aneinander vorbei, sondern extendieren ihre Minimalkonzepte, die miteinander vergleichbar sind, da sie auf genau einem paradigmatischen Kontext basieren, in verschiedene robuste Konzepte. Hier wird durch die abstrahierende Aufspaltung eines Konzeptschemas in Minimal- und robuste Konzepte deutlich, dass so auch das Konzept von Proposition, Konzept und Konzeptschema fluid ist. Auch, was genau ein Konzept ist, hängt wiederum von Paradigmen des Anwendungsbereiches ab und ist nicht scharf abzugrenzen. So ist es Lynch möglich davon zu sprechen, dass die Propositionen relativ nicht nur zu einem Konzeptschema sind, sondern – und das zugleich – zu mehreren, wenngleich nicht zu allen, denn das wäre absolutistisch gedacht. Dies wird durch eine kontrafaktuale Beweisführung versucht zu untermauern: Auf robuster Konzeptebene legen S und J verschiedene Konzepte von Objekt zu Grunde und können so inkompatible Aussagen machen. Dennoch reden sie nicht aneinander vorbei, da sie auf minimaler Konzeptebene das gleiche Konzept teilen und dieses – und hier ein Beweis im Konjunktiv!! – auf gleiche Weise extendieren könnten ! Hier wird also die theoretische Möglichkeit der identischen Extension eines Minimalkonzeptes als Vergleichbarkeitskriterium verwandt.
Lynch argumentiert in besonders einem wichtigen Punkt damit, dass es aufgrund gegenläufiger Intuition nicht sein könne, dass distinkte Konzeptschemata für distinkte Welten stehen („many-worlds-problem“)[34], da er nicht einsehen möchte, dass sich ja dann der Eine um den Anderen nicht mehr kümmern bräuchte. Ein wohlgemerkt intuitiv-moralisches Argument. Einen logischen Beweis im Konjunktiv zu führen, und das an prominenter Stelle seiner Ausführungen, erscheint nicht weniger intuitiv fragwürdig, zumal es zum Verständnis Lynchs Sicht nicht einmal einen sonderlich produktiven Beitrag leistet, sondern - im Gegenteil - verwirrt. Er weist zwar noch darauf hin, dass eine solche Beweisführung technisch problematisch ist[35], vertieft dies aber nicht ausreichend. Im Anschluss entschärft er selbst ehrfürchtig die Tragweite seines zentralen Kapitels, in dem er darauf verweist, dass er für einen Absolutisten keine hinreichenden Antworten gefunden hat, sondern seine Darstellung lediglich dazu taugt, die Spannung aus der Debatte zu nehmen[36]. Das ist schon ein klare Zurücknahme seines Vorhabens, tatsächlich zu beweisen, dass es metaphysische wahre, inkompatible Aussagen gäbe. Letztendlich könnte man Lynch vorwerfen, dass zumindest seine letzte Beweisführung auf Intuition und Konjunktiven beruht. Und dennoch ist seine Argumentation weitestgehend nachvollziehbar und konsistent – auch ohne kontrafaktualen Beweis. Denn, dass S und J zugleich auf minimaler Ebene ein und dasselbe Konzept, auf robuster Ebene verschiedene Konzepte von Objekt und Existenz anwenden, ist ganz und gar nicht kontra-intuitiv, da es hier um eine abstrahierende Veranschaulichung geht. Der letztendliche Beweis geht jedoch in die Hose, was für Lynch aber kein Problem sein dürfte. Wäre nämlich der Beweis seines Vorhabens endgültig abgeschlossen, hätte er sich innerhalb seines Systems selbst widersprochen. Ein generelles pluralistisches Problem. Wäre dieses metaphysische System in sich geschlossen und nach außen hin abgeschlossen - und dies wäre absurd - läge ein absolutes System vor. Pluralistisch gesehen also vollkommen kontraproduktiv. Ein metaphysisch-pluralistisches System darf nicht in herkömmlicher Weise abgeschlossen sein, da es durch seine Abgeschlossenheit kristallinen Charakter annimmt und so zum non plus ultra generiert. Lynch kann sich so gewissermaßen dankbar sein, dass der letztendliche Beweis seiner These nicht oder nur bedingt funktioniert. Denn so würde er mit einem festen Begriffsbrett unter den Philosophenfüßen auf einer Wittgensteinschen Wahrheitswelle, fluid-minimale Konzepte reitend, gegen einen Brückenfeiler des eigenen kristallin-starren Systems stoßen und sich dabei fürchterlich metaphysisch das denkende Organ verletzen. Und das können selbst Quine und Kant nicht wollen.
Quellenverzeichnis und Literatur
F.I. Dretske, Knowledge and the Flow of Information, Oxford, 1981
G. Hasenjaeger, Einführung in die Grundbegriffe und Probleme der modernen Logik, Freiburg/München, 1962
D. Henrich (Hrsg.); R.-P. Horstmann (Hrsg.), Metaphysik nach Kant/Stuttgarter Hegelkongress 1987, Stuttgart, 1988; darin: W. Hogrebe, Eindeutigkeit und Vieldeuigkeit. Vorzüge einer indiskreten Ontologie, S. 217-232
R.Hüntelmann (Hrsg.); E. Tegtmeier (Hrsg.), Neue Ontologie und Metaphysik, Sankt Augustin, 2000
Michael P. Lynch, Truth in Context, Cambridge (Mass..), 1998
W.V.O. Quine, Word and Objekt, Cambridge (Mass.), 1976
[...]
[1] Michael P. Lynch, Truth in Context, Cambridge (Mass.), 1998
[2] So wird bspw. “concept” mit Konzept und „conceptual scheme“ mit Konzeptschema nur halb eingedeutscht, um die Analogie zu Lynchs Text zu erhalten. Dadurch ermüden den Leser zwar stetige Wiederholungen der Ausdrücke, jedoch ist damit lediglich eine größere Klarheit ermöglicht.
[3] vgl. TiC, S. 33
[4] vgl. TiC, S. 40
[5] vgl. TiC, S. 36
[6] vgl. TiC, S. 38
[7] vgl. TiC, S. 38-39
[8] Siehe dazu auch Kapitel IV dieser Arbeit. Hier wird dieser Unterschied entlang der Begriffe „diskrete“ und „indiskrete Aussagen“ vollzogen
[9] vgl. TiC, S.41
[10] „Einmal im Jahr tritt dä Rhing usm Bett, nämmlisch dann, wenn er Huhwasser hätt.“ Und ja, auch das trifft durchaus auf Meinungen zu, die für kurze Zeit alles aus den Angeln heben.
[11] vgl. TiC, S.45
[12] vgl. TiC, S. 56
[13] Dies wird hier in Kapitel V dargestellt werden
[14] Lynch nennt hier hauptsächlich Frege
[15] Wobei auch hier freilich die Mehrdeutigkeit von Sprache als gegebenes Faktum anerkannt wird.
[16] Man könnte annehmen, dass auch ein in Scheidung lebender, noch verheirateter Mann sich bereits wieder als Junggeselle bezeichnen würde o.ä.
[17] vgl. TiC, S. 62
[18] vgl. Die Bibel, Mt 13,31
[19] vgl. Hogrebe, S. 217
[20] vgl. Hasenjaeger, S. 31
[21] vgl. Hogrebe, S. 219
[22] ebd. S. 220
[23] vgl. bei Quine [wegen (x) ($(x=y)]: W.V.O Quine, From a Logical Point of View, Cambridge (Mass.), 1953, S. 1
[24] vgl. ebd. S. 225
[25] Quine, Kap. III
[26] vgl. ebd., S. 227
[27] vgl. ebd., S. 229
[28] vgl. TiC, S. 77f
[29] vgl. TiC, S. 81f
[30] Dieser Begriff wird meines Wissens nach im Deutschen nicht verwendet. Es handelt sich dabei um die Übersetzung des englischen Wortes „counterfactual“
[31] vgl. TiC, S. 84
[32] vgl. TiC, S.85
[33] vgl. TiC, S.88
[34] vgl. TiC, S.95
[35] vgl. TiC, S.93
Häufig gestellte Fragen zu "Inhalt"
Worum geht es in der "Einführung – Die eine plurale Welt. Anything goes? Everything sucks? And nothing matters?"?
Dieser Abschnitt thematisiert die Spannung zwischen einer pluralistischen Weltsicht und dem Anspruch auf objektive Wahrheit. Es wird die Frage aufgeworfen, ob ein "Anything goes" letztendlich zu einer Abwertung der Erkenntnis ("Everything sucks") führt und ob es absolute Wahrnehmungsstrukturen gibt. Kants Ansatz, der auf fundamentalen Begriffen zur Organisation der Wahrnehmung basiert, wird diskutiert und der postmodernen Intuition gegenübergestellt, die sich gegen absolute Kategorien sträubt. Abschließend wird Michal P. Lynchs Versuch, Pluralismus und Realismus in Bezug auf Wahrheit zu versöhnen, vorgestellt.
Was wird im Abschnitt "Sei nicht so starrsinnig, Immanuel! Quine übertreibt und Wittgenstein kommt der Sache näher. Conceptual Schemes" behandelt?
Dieser Teil analysiert unterschiedliche Auffassungen von "Conceptual Schemes" (Konzeptschemata) bei Kant, Quine und Wittgenstein. Es werden vier Fragen an diese Philosophen gestellt: Woraus besteht ein Schema? Welches sind Identitätskriterien für ein Schema? Gibt es eine Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Sätzen? Was ist die strukturelle Natur eines Schemas? Lynchs eigene Position wird durch die Abgrenzung zu diesen Denkern herausgearbeitet, wobei er sich vor allem Wittgensteins Flussbettmetapher annähert.
Was sind "Basale, fluide Minimalkonzepte" und warum ist der "Glaube an die Kommunikation" wichtig?
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Frage, ob Konzeptschemata eher kristalliner oder fluider Natur sind und wie sie sich global und individuell verändern können. Es wird die Bedeutung von "Minimalkonzepten" im Unterschied zu "robusten Konzepten" hervorgehoben. Minimalkonzepte ermöglichen die Kommunikation auch dann, wenn robuste Konzepte divergieren. Die Annahme ist, dass Annahmen, Behauptungen, Meinungen und Propositionen nur in ihrem konzeptuellen Kontext verstanden werden können.
Was bedeutet "Indiskret" in Bezug auf Ontologie und wie vergleicht sich das mit Lynchs "Minimalkonzepten"?
Dieser Abschnitt stellt eine Verbindung zu Wolfram Hogrebes Konzept einer "indiskreten Ontologie" her. Hogrebe kritisiert eine rein diskrete Ontologie, die sich auf trennscharfe Aussagen beschränkt. Die indiskrete Ontologie zielt hingegen auf das "Typische" und das "allgemeine Wesen" einer Sache. Es werden Parallelen zu Lynchs Unterscheidung zwischen robusten und Minimalkonzepten gezogen, wobei das "Irgendwie-So-Wesen" einer Sache in indiskreten Aussagen bzw. Minimalkonzepten erkannt wird.
Was ist die Idee hinter "Wahrheit durch 'Was wäre wenn?'" und was bedeutet "Alles im Fluss"?
Dieser Teil untersucht, ob inkompatible Aussagen gleichzeitig wahr sein können. Ein Gedankenexperiment mit zwei Metaphysikern (Johnson und Smith) und Murmeln wird verwendet, um die unterschiedlichen Konzepte von "Objekt" zu veranschaulichen. Es wird argumentiert, dass selbst zentrale metaphysische Konzepte wie "Objekt" und "Existenz" fluider Natur sind. Lynch verwendet einen kontrafaktualen Beweis (Was-wäre-wenn), um zu zeigen, dass eine Vergleichbarkeit zwischen den Konzepten von S und J besteht.
Welche Schlussfolgerung wird in "Inhalt" gezogen?
Obwohl Lynch zugibt, dass er für einen Absolutisten keine hinreichenden Antworten gefunden hat, argumentiert er, dass seine Darstellung dazu beitragen kann, die Spannung aus der Debatte zu nehmen. Er räumt ein, dass sein kontrafaktualer Beweis problematisch ist. Der Beweis geht jedoch in die Hose, was für Lynch aber kein Problem sein dürfte. Wäre nämlich der Beweis seines Vorhabens endgültig abgeschlossen, hätte er sich innerhalb seines Systems selbst widersprochen. Ein generelles pluralistisches Problem.
- Quote paper
- Frederic Scheuss (Author), 2004, Möglichkeit der inkompatiblen Wahrheiten in relativen Kontexten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109049