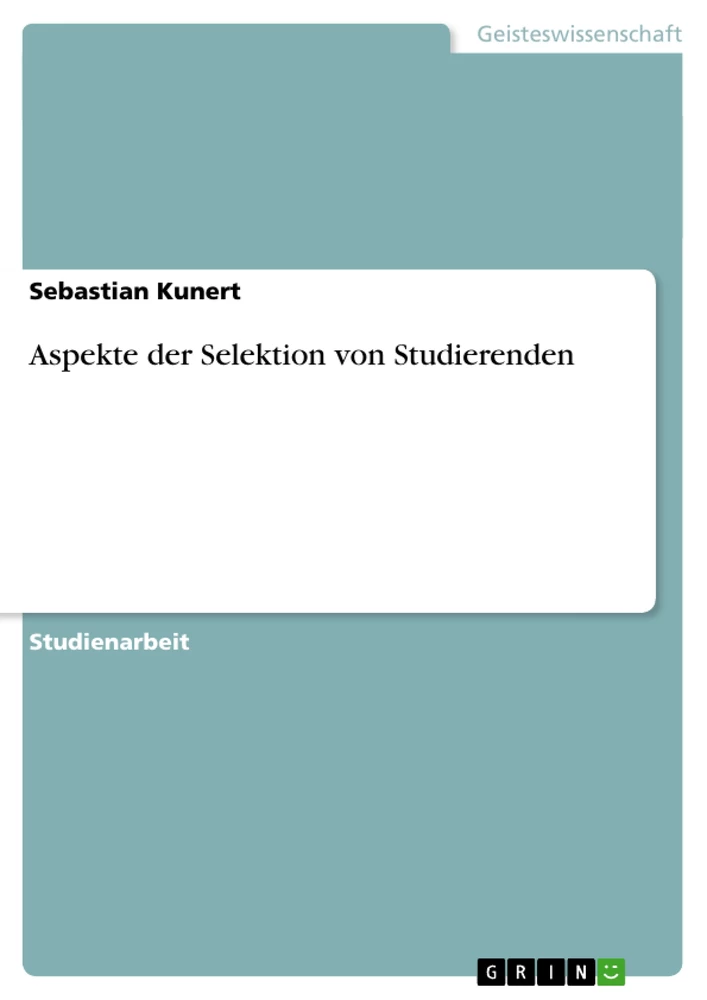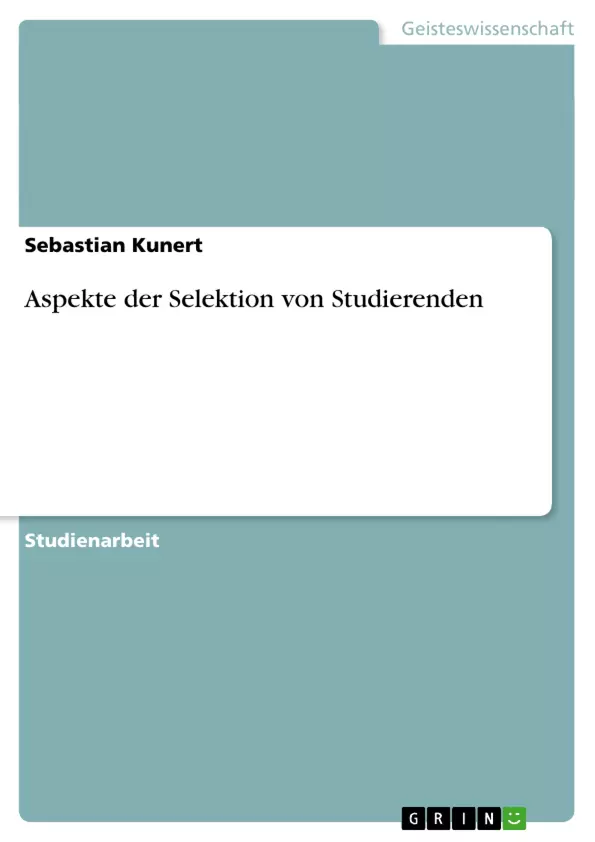Inhaltsverzeichnis
0 Einleitung
1 Geschichte und Entstehung des heutigen Problems
2 Notwendigkeit der Auswahl
Bewerberzahlen, deren Entwicklung
Abbruchquote, Studierdauer und Kosten eines Studienplatzes
Studienmotivation und Wahl des Studienortes
Vergleichbarkeit der Studieneignung
Juristische Sachlage
3 Testtheoretische Grundlagen
4 Die Definition des Kriteriums
5 Die Definition des Prädiktors
Abiturnoten
Wartezeit
Tests
Interviews
Gutachten und Empfehlungsschreiben
Essays
Probezeit
Losverfahren
weitere Auswahlinstrumente
Selbstselektion
6 Kosten / Nutzen
7 Marketing
Ziele und Notwendigkeit
Maßnahmen
8 Probleme
Aufwand
Testtourismus
9 Fazit
10 Literatur
11 Anhang
Anzahl Wörter Text: 8.240
Anzahl Wörter gesamt: 9.206
Verfasst nach APA- Standard
Überarbeitet von Dipl. Psych. M. Schulz
Begutachtet von Jun Prof. O. Wilhelm
(Anmerkung 1: Wenn in der folgenden Arbeit die Begriffe Hochschulen und Universitäten synonym gebraucht werden, so sind mit Universitäten auch alle der Universität gleichgestellten Hochschulen wie Fachhochschulen und Verwaltungsfachhochschulen gemeint.)
0 Einleitung
Im Abschlussbericht einer 2jährigen Arbeitsgruppe des Wissenschaftrates (WR) zum Thema Studierendenauswahl heißt es zusammenfassend: „ Die Hochschulen müssen künftig aktiver an der Zulassung mitwirken. Dies trägt zu ihrer Profilbildung bei und ermöglicht es, die Qualifikationsprofile von Studienbewerbern bereits vor Studienaufnahme besser mit den Anforderungen einzelner Studiengänge abzustimmen.“ (WR, 2004, S.5). Neben Profilbildung und Passung sind auch wirtschaftliche Zwänge auf Grund von Sparmaßnahmen der öffentlichen Hand, gesellschaftlicher Druck, mehr Studierwilligen einen Studienplatz zur Verfügung zu stellen und nicht zu Letzt der initiierte Wettbewerb unter den Hochschulen (wie er ja heute schon vorhanden ist bei der Drittmittelvergabe und Personalakquirierung, Hermeier, 1992) der Grund dafür, dass der Druck zu Reformen im Hochschulwesen zunimmt. Der Selektion von Studienbewerbern nach hochschuleigenen Kriterien scheint in dieser Diskussion eine Schlüsselposition zu teil zu werden.
Dies scheint auch die Politik so zu sehen. Nach Jahren der Stagnation kehrte jetzt Aktionismus in die rahmenpolitischen Entscheidungsträger. Folge war ein Entwurf zum Hochschulrahmengesetz, der im Juni d. J. den Bundestag passierte und es den Universitäten erlaubt, ihre Jahrzehnte alten Forderungen endlich umzusetzen – bereits ab dem Wintersemester nächsten Jahres ist es nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht, dass sich die deutschen Hochschulen an der Selektion von Studienbewerbern beteiligen!
Wie sich in den folgenden Erläuterungen zur Studierendenauswahl zeigen wird, stehen die Auswahl und die damit verbundenen Ziele nicht in einem einseitigen Zusammenhang. So ist z. B. das Profil einer Hochschule elementarer Bestandteil der Konstruktbestimmung bei der Selektion, aber auch Voraussetzung für die Selbstselektion der Bewerber.
Stark an den universitären Blickwinkel gebunden wird in der folgenden Arbeit vorwiegend die Position der Hochschule beleuchtet. Dass eine Reform im Hochschulbildungswesen sich nicht auf die Selektion von Studienbewerbern beschränken darf, sondern flankiert werden muss durch z.B. stärkere Verzahnung der Studien- und Berufsberatung in der Schule oder der Einführung von Orientierungsphasen an den Hochschulen erscheint folgerichtig und wird gängigerweise auch so gefordert (WR, 2004, Lewin & Lischka, 2004).
1 Geschichte und Entstehung des heutigen Problems
Die längste Zeit ihres Bestehens wählten die hiesigen Universitäten ihre Studenten selbst aus. Seit der Gründung der ersten Universität auf heutigem deutschem Boden in Heidelberg 1386 bis zur preußischen Bildungsreform 1788 war es 400 Jahre lang Usus, dass (sozial stark vorselektiert) unter den Bewerbern für die hochschuleigenen s. g. Artistenschulen (die Fakultät der artes liberales) hochschulintern selektiert wurde und die Absolventen dieser Artistenschulen sich individuell für das weiterführende Studium in Theologie, Jura oder Medizin nochmals bewerben mussten. Erst durch die stetige Aufwertung dieses dem eigentlichen Studium vorgelagerten Studium Generale zur Philosophischen Fakultät übertrug sich die Verantwortung der Studierfähigkeit mehr und mehr auf die Schulen. Dieser Prozess endete erst mit der Humboldtschen Universitätsreform von 1812 und 1834, dessen Grundmuster bis heute Gültigkeit besitzt. Seit dem obliegt es den Gymnasien, die das Privileg besitzen, das Abitur zu verleihen, ihre Schüler in ausreichender Form auf das Studium vorzubereiten. Entsprechende Maturitätskataloge waren seit dem immer wieder Ausgangspunkt für heftige Diskussionen um schulische Lehrinhalte und universitäre Anforderungen (siehe auch Kapitel 5). Die resultierende Abkoppelung dieser Verantwortung vom Nutznießer Universität zum Anbieter Schule und das damit einhergehende Dienstleistungsverständnis bestimmt bis heute massiv die Debatte um Reformen im Bildungswesen (WR, 2004, ausführlich in Lewin & Lischka, 2004).
2 Notwendigkeit der Auswahl
Die Notwendigkeit zur Selektion unter Studienbewerbern ergibt sich aus einer Vielzahl von Gründen, die sich zum Teil aus rein ökonomischen Gesichtspunkten ergeben, aber auch aus den erwarteten Konsequenzen, die man einer solchen Auswahl zuschreibt (letzteres ist keineswegs trivial, da das Ausmaß dieser Zusammenhänge im Vorfeld teilweise unklar bleibt).
Bewerberzahlen
Zu der ökonomischen Funktionalität von Selektion gehört die schiere Begrenzung der Studierenden an einer Fakultät. Das Problem verdeutlicht sich in Anbetracht der Bewerberquote und der wahrscheinlichen Entwicklung der Studienberechtigtenzahl. Das Verhältnis von Aspiranten zu freien Plätzen an der Psychologischen Fakultät der HU betrug im letzten Wintersemester 03/04 1:33,4 (HU, 2004) (bundesdeutscher Durchschnitt: 1:4,3 (WR, 2004)), womit die Psychologie das mit Abstand meist beworbene Fach der gesamten Universität ist. Der resultierende durchschnittliche N. C. liegt mittlerweile bei 1,2!
In den kommenden Jahren dürfte sich die Situation eher noch verschärfen: Laut einer Prognose der KMK aus dem Jahr 2002 (KMK, 2002 in HIS, 2004) entwickelt sich die Zahl der Studiumsberechtigten in Deutschland allein demographisch bedingt noch bis 2009 aufwärts. Laut dem WR werden von derzeit ca. 38,6% der Studienberechtigten innerhalb der gleichaltrigen Wohnbevölkerung im Jahr 2014 39,4% studienberechtigt sein (WR, 2004). Parallel dazu erhöht sich auch der Anteil der Studienberechtigten, die tatsächlich ein Studium aufnehmen – die s. g. Bruttostudierquote – kontinuierlich seit 1999; die de facto Studierenden dürften sich resultierend von derzeit ca. 1,7 Mio. auf dann fast 2 Mio. Studenten erhöhen (HIS, 2004).
Noch nicht einkalkuliert sind die Folgen des zu erwartenden Urteils vom Bundesverfassungsgericht zu dem bundesweiten Verbot von Studiengebühren. Legt das oberste Gericht diese Entscheidungsbefugnis in die Hände der Länder und bleibt es in Berlin beim Verbot von Studiengebühren, so erlangt dieser Standort einen weiteren Popularitätsschub resultierend aus dem preiswerteren Studium – mit dementsprechenden Folgen für die Bewerberzahlen.
Abbruchquote, Studierdauer und Kosten eines Studienplatzes
Ein zweites, spekulatives Argument für die hochschuleigene Selektion mit primär konsequenziellem Charakter ist das der Reduzierung der Studienabbrecherquote und der Studiendauer. Jene Studenten, die ihr Studium ohne Abschluss beenden, stellen aus Sicht der Hochschulen eine Verschwendung an Ressourcen dar; „ sie sind Gradmesser für Erfolg, Attraktivität und Effizienz der akademischen Ausbildung “ (HIS, 2002, S. 1). Und das nicht ohne Grund: der durchschnittliche Student der Psychologie an der HU (bei zu Grunde gelegten 12,5 Semestern durchschnittlicher Studienzeit (HU, 2004)) kostet die Fakultät 3700,- EUR pro Jahr für Lehre und Dienstleistungen (HU, 2004). 41% der Studienanfänger beenden ihre Ausbildung vorzeitig bzw. wechseln in ein anderes Fach (HU, 2004). Dies geschieht nach durchschnittlichen 6,7 Semestern, d.h. das Gros der Abbrüche erfolgt erst spät im Studium (HIS, 2000 in MBWFK SH, 2000). Die so entstehenden Kosten für die Studienabbrecher kann man auf gut 965.500,- EUR pro Jahrgang schätzen.
Kosten im erweiterten Sinne entstehen dabei auch auf Seiten der Studenten. Der WR bemerkt dazu: „ Wenn Studierende in der Konsequenz ihr Studium abbrechen oder schlecht organisieren, so ist dies nicht nur eine systembedingte Fehlleitung des Engagements von Hochschullehrenden und von volkswirtschaftlichen bzw. Bildungsressourcen, sondern vor allem auch eine Vergeudung von Lebenszeit.“ (WR, 2004, S. 22). Die Gründe für einen Abbruch variieren sehr stark (zur Quellenabhängigkeit s. u.). Der WR (2004, S. 21) betont, dass „falsche Erwartungen an das Studium, das Fehlen von Berufs- und Praxisbezug des Studiums, Zweifel an persönlicher Eignung, eine lange Studiendauer und mangelhafte Studienorganisation von einem Drittel bis zur Hälfte der Studienabbrecher genannt“ werden. In einer HIS-Längsschnittuntersuchung aus dem Jahre 1992 (in Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holtstein MBWFK SH, 2000) werden Abneigung und Desinteresse (ca. 30%), Berufstätigkeit (ca. 19%), Überforderung (ca.16%), Familiäre Gründe (ca. 13%) und finanzielle Gründe (ca. 6%) als relevante Motivatoren genannt.
Kritisch anmerken muss man an dieser Stelle, dass es kaum verlässliche Statistiken gibt zum Thema Studienabbruch. Da die Universitäten und Fachhochschulen keine Statistiken über die Lebenswege der Studenten nach einem Austritt aus der Hochschule führen, lässt sich nur schwer abschätzen, welche dieser Exmatrikulierten ‚wahre’ Abbrecher sind, wer Wechsler und wer Aussetzer (z.B. für einen Auslandsaufenthalt oder Babypause). Die verfügbaren Zahlen basieren deswegen i. d. R. auf Hochrechnungen aus Fragebogenstudien. Zusätzlich stellt die Motivation zum Abbruch einen wesentlichen Faktor dar: Wird ein sehr erfolgreicher Student durch einen Headhunter direkt von der Hochschule in ein Unternehmen ‚abgeworben’, so stellt dies nur bedingt eine Verschwendung von Ressourcen dar.
Neben einer Verringerung der Abbruchquote erhofft man sich des Weiteren auch positive Effekte der Selektion auf die Studiendauer. Diese beträgt z. Z. durchschnittliche 12,5 Semester an der Psychologischen Fakultät der HU (und ein Alter zum Abschluss von 28 Jahren, Hermeier, 1992) und hebt sich damit deutlich von den vorgesehenen 9 Semestern ab. Allein in der Verkürzung dieser Zeit auf Regelniveau liegt ein Sparpotential von 6.627,- EUR pro Student pro Jahrgang (728.970,- EUR für das gesamte Psychologische Institut der HU) (HU, 2004).
Ziel ist es also, die – wie es Engelhardt (1993) nennt – Kapitalrentabilität der Hochschulen zu erhöhen (zur erwarteten Wirkung von einzelnen Selektionsverfahren auf Abbruchquote und Studiendauer s. u. und Kap. 5).
Studienmotivation und Wahl des Studienortes
Eine Verschärfung des Hochschulzuganges geht einher mit einem erhöhten zeitlichen und finanziellen Aufwand auf Seiten der Abiturienten für Bewerbung, Vorbereitung auf Auswahltests und Anreise zur Auswahlprozedur. An diesem Punkt setzt die Hoffnung auf eine Reihe von Effekten an, die sich durch eine subjektive Kosten / Nutzen- Kalkulationen ergeben. Zum einen glaubt man an eine stärkere Selbstselektion durch einen Mehraufwand bei der Informationsbeschaffung (z.B. zum Profil der Hochschule, den Anforderungen des Studiums und der Auswahl).
Dies käme auch einer objektiveren Wahl des Hochschulortes zu Gute, die laut WR (2004) bei mehr als der Hälfte der Studenten nach sachfremden Kriterien erfolgt. Weiter heißt es dort: „ 42% der Studienanfänger entscheiden aufgrund bestimmter Studienmöglichkeiten und -bedingungen, für 39% gibt die Nähe zum Heimatort den Ausschlag, 13% der Studienanfänger können sich durch Zulassungsbeschränkungen oder mangelnde Studienmöglichkeiten nicht an der gewünschten Hochschule einschreiben, 6% wählen nach anderen Kriterien wie etwa den kulturellen Voraussetzungen des Hochschulortes.“(WR, 2004, S. 13) (weitere direkte und indirekte Einflussgrößen in Lewin & Lischka, 2004, S 32 f.). In einer Studie von Hermeier (1992) kommt das sachfremde Kriterium Heimatnähe sogar mit 48% mit Abstand auf Platz eins, weit vor dem Studienangebot (10%) und den Zulassungsbedingungen der Hochschule (7,6%).
Die Gründe dafür liegen in der schlichten Unmöglichkeit, sich vollständige Transparenz über alle interessierenden Studiengänge zu verschaffen, in den teils gravierenden konzeptionellen Unterschieden verschiedener Ausbildungen, die einen Vergleich erschweren, sowie in der nur schwer abwägbaren Qualität der Lehre. Dazu kommen eine hohe persönliche Bedeutung, die Langfristigkeit der Entscheidung, die Komplexität und v. a. Neuartigkeit des Problems, wodurch den Schülern keine gelernten Problemlösungsmuster zur Verfügung stehen. All diese Überlegungen führen laut Hermeier (1992) dazu, dass Abiturienten nach zwar objektiv sachfremden, aber aus ihrer Sicht validen Informationen und viablen Heuristiken heraus ihre Wahl treffen.
Zum zweiten erhofft man sich einen Motivationsschub bei denen, die angenommen werden (WR, 2004, Lewin & Lischka, 2004). Das Studium an einer Hochschule wird durch eine Auswahlprozedur zu einem Privileg der besonderen Güte, da sowohl die Leistungen im Abitur als auch im Auswahlprozess (und hier können je nach Ausgestaltung auch außerschulische Abschlüsse und Aktivitäten wie Praktika oder Arbeitserfahrungen hineinspielen) eine Rolle spielen. Es kommt zum Effekt einer positiven self-fullfilling prophecy, wie er von Gebert (2004) auch nach Assessment- Centern beschrieben wird.
Vergleichbarkeit der Studieneignung
Ein letzter Grund, eine hochschuleigene Selektion zu befürworten, liegt in der mangelnden Vergleichbarkeit der Hochschulzugangsberechtigungen als Gradmesser der individuellen Studieneignung. Basis dieses Ansatzes zumindest auf Wissensebene bildet ein gemeinsamer Fächerkanon, der, vielfach geändert, sich heute auf einen Minimalkonsens in der KMK aus Deutsch, einer Fremdsprache und Mathematik beschränkt (in Lewin & Lischka, 2004). Dabei reduziert sich Hochschuleignung laut Hochschulverband nicht nur auf Fachwissen, sondern besteht aus einem Verbund aus 1) allgemeinen Leistungsdispositionen (Arbeitstechniken, Ausdrucksvermögen, Arbeitsqualität, Ausdauer, Belastbarkeit, Kritikfähigkeit, Motivation, u. a.), 2) einer breiten Grundbildung und 3) fachbezogenen Kenntnissen (in Lewin & Lischka, 2004).
Probleme an der Idee des einheitlichen und einheitlich zu bewertenden Fächerkanons ergeben sich zum einen daraus, dass die Schulnoten bei gleicher Leistung sehr stark auf allen Analyseebenen (innerhalb einer Klasse, einer Schule, eines Bundeslandes, deutschlandweit) (WR, 2004) variieren; zum anderen kann man bei einer Zahl von 18 verschiedenen Möglichkeiten (jene im Ausland realisierbaren nicht einberechnet), seine Hochschulzugangsberechtigung zu erlangen, nur noch bedingt von einer einheitlichen Studierfähigkeit sprechen (WR, 2004). Dem stehen 901 Studienmöglichkeiten an 118 Hochschulen gegenüber (Stand 2003), die alle ihre ganz eigenen Vorstellungen von Studierfähigkeit mitbringen. Erschwerend hinzu kommt ein Beschluss der KMK 1972, die immer weiter fortschreitende Differenzierung der Schulen zu begrenzen und stattdessen innerhalb der Gymnasien es den Schülern zu erlauben, in Abhängigkeit an ihr individuelles Leistungsvermögen und ihre Interessen die Fächer als Leistungs- oder Grundkurs oder teilweise völlig abzuwählen.
Nur gut ein Drittel der Studierenden bezeichnet heute die Schulische Ausbildung als ausreichend vorbereitend für das Studium (Lewin et. al., 2001). So heißt es bei Lewin & Lischka (2004) auf Seite S. 87: „ Über alle Fächer hinweg bezeichnen höhere Anteile der Studienanfänger insbesondere ihre praktischen Computerkenntnisse (41%), Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens (32%), über das Englische hinausgehende Fremdsprachenkenntnisse (32%), ihre Mathematikkenntnisse (24%), ihr politisches Grundwissen (23 %) und die Fähigkeit zur selbständigen Studiengestaltung (22 %) als unzureichend.“
Durch Selektion hofft man, dass man zum einen Bewerber auch nach diesen in den Schulnoten nur bedingt repräsentierten Fähigkeiten auswählen kann und zum anderen (und das ist der wesentlich höhere, langfristige Nutzen für die Hochschulen), dass sich Gymnasien verstärkt auf die Ausbildung solcher Eigenschaften bei den Schülern konzentrieren. An dieser Stelle zeigt sich exemplarisch das eingangs schon erwähnte Dienstleistungsverhältnis zwischen Hochschule und Gymnasium. Einschränkend muss man an dieser Stelle auf die Grenzen der Schule als Ort der Ausbildung einer allgemein gültigen Studierfähigkeit hinweisen. Wie der Deidesheimer Kreis (1997) sehr deutlich darstellt, dominieren fächerspezifische Anforderungen die allgemeinen, was die Möglichkeiten der Gymnasien wiederum einschränkt.
Juristische Sachlage
Die juristische Berechtigung, über Schulnoten hinaus hochschuleigene Auswahlverfahren zur Selektion von Studierenden einsetzen zu dürfen, scheint nach Auffassung aller Autoren zu diesem Thema gegeben zu sein. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.07.1972 (BVerfGE 33, 303 in WR, 2004) gibt hier lediglich vor, dass die Auswahl nach sachgerechten Kriterien erfolgen soll und dass der im Grundgesetz verankerten freien Studien- und Berufswahl (Art. 12 Abs. 1 S. 1 GG) angemessen Rechnung getragen wird. Dieses Grundrecht spiegelt sich in der Hochschulzugangsberechtigung als verankertes Recht auf Teilhabe an dem vom Staat zur Verfügung gestellten Studienangebot wieder. So heißt es im Hochschulrahmengesetz (§ 27 HRG), dass einer auf das Studium vorbereitenden Schulbildung“ grundsätzliche die Bedeutung als Fähigkeitsnachweis für den Zugang zum Hochschulstudium zukommt. Dies wiederum findet durch das Heranziehen der Wartezeit als ultimo ratio seine angemessene Beachtung. Solange also die drei Auswahlkriterien Leistungsprinzip, Jahrgangsprinzip und Bereitstellung eines Teils der Studienplätze für soziale Härtefälle und für Ausländer kumulative Anwendung finden, ergeben sich hier keine verfassungsrechtlichen Probleme (BVerfGE 33, S. 350, 1972). Bestätigt wird diese Interpretation auch durch zahlreiche juristische Gutachten (so z.B. von Bahro, Berlin & Hübenthal, 2004, Hailbronner, 2002, Möller, 2001 in Lewin & Lischka, 2004).
Das Bundesverfassungsgericht geht in seinem Urteil sogar noch über diese Bedenken hinaus und bekundet seine Auffassung, dass auch bei Vergleichbarkeit der Durchschnittsnoten nicht jeder Bewerber mit dem Notendurchschnitt der Grenznote von z. B. 1,7 für das Studium und den Beruf geeignet ist, alle Bewerber mit dem Notendurchschnitt 1,8 dagegen nicht. Ein alleiniges Abstellen auf die Abiturdurchschnittsnote würde jedoch dazu führen, dass die Bewerber mit einem Notendurchschnitt bis zur Grenznote zu 100%, die auch nur ein Zehntel darüber liegenden Bewerber zu 0% zugelassen würden. Daher kann laut BVerfGE aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht allein auf die Abiturdurchschnittsnote abgestellt werden. Dies eröffnet einen weiten nutzbaren Rahmen für hochschuleigene Auswahl.
3 Testtheoretische Grundlagen
Betreibt man Studierendenauswahl, so stellt sich wie bei jeder Bewerberselektion die Frage nach den Kriterien von Erfolg, nach den Prädiktoren für eben diese Kriterien, der Größe des Zusammenhangs zwischen diesen beiden sowie der Gültigkeit der verwendeten Testverfahren. Im Folgenden soll auf die beiden letztgenannten Themen eingegangen werden.
Abbildung 1 stellt den Zusammenhang zwischen Prädiktoren und Kriterium dar. Sie veranschaulicht den Versuch, mit Hilfe einer Variable gemessen zum Zeitpunkt t1 (Prädiktor) das Ausmaß einer anderen Variable gemessen zum Zeitpunkt t2 (Kriterium) vorherzusagen. In der Darstellung stellt c den durch den Prädiktor vorhergesagten Anteil am Kriterium (Entspricht dem Validitätskoeffizienten) dar, a den unaufgeklärten Rest, der nicht vorhergesagt wird durch die Prädiktoren (Entspricht 1 – Validitätskoeffizient) und b den durch beide Prädiktoren vorhergesagten Teil des Kriteriums (die Redundanz). Das Ziel muss es sein, c möglichst groß, a und b möglichst klein zu halten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Der Zusammenhang zwischen Kriterium und Prädiktoren
Da man nie die gesamte Varianz in den Daten der Kriteriumsmessung vollständig durch die Varianz in den Prädiktordaten vorhersagen kann, bleibt immer ein s. g. unaufgeklärter Rest übrig. Wie groß dieser unerwünschte Rest ist, hängt wiederum von der Güte meines Auswahlverfahrens (Validität) sowie von der Basis- und Selektionsrate ab. Diese drei stehen in einem engen Zusammenhang: Die Basisrate beziffert den Anteil potentiell geeigneter Kandidaten innerhalb meiner Bewerbergruppe, die Selektionsrate den Anteil derer, die ich auf Grund meines Verfahrens als geeignet einstufe. Es erscheint logisch, dass man desto weniger Fehler in einer Auswahl macht, umso mehr Bewerber von vornherein geeignet sind (damit sinkt die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers in der Auswahl, d. h. die Zurückweisung faktisch geeigneter und die Wahl faktisch Ungeeigneter). Denselben Effekt erreicht man, wenn man das Selektionskriterium hochsetzt, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ungeeignete Kandidaten durch Zufall doch ausreichend hohe Werte erzielen. Letztlich bestimmt die Validität (dargestellt durch die Enge der Elypse) der Messung, ob der Test überhaupt geeignet ist, das Kriterium vorherzusagen. Diese Zusammenhänge sind in der Abbildung 2 dargestellt (Quelle: Wilhelm, 2004).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: der Zusammenhang zwischen Basisrate, Selektionsrate und Validität
Auf diesen Zusammenhang bauen auch die s. g. Taylor- Russel- Tafeln auf. Diese Tabellen dienen dazu, den erwarteten Anteil Geeigneter aus der ausgelesenen Stichprobe in Abhängigkeit (also der Kenntnis) von Validität, Selektions- und Basisrate in einer unausgelesenen Population zu bestimmen. Der faktische Nutzen liegt in der Entscheidung, ob man zur Erhöhung des Anteils Geeigneter das Selektionskriterium erhöhen sollte oder besser die Validität des Verfahrens (Gebert, Rosenstiel, 2002).
4 Definition des Kriteriums
Die Wahl eines Kriteriums orientiert sich an der Frage: ‚Woran soll man die Auswahlprozedur messen?’ bzw. ‚Wann ist ein Student erfolgreich?’ Diese Frage zergliedert sich in dutzende von Möglichkeiten: Möchte man den reinen Studienerfolg messen, kann man konkret Studierleistungen (Examensabschluss- bzw. Zwischenprüfungsnoten), die Abbrecherquote, die durchschnittliche Studiendauer oder gar weiterführende akademische Grade heranziehen. Verwendet man dagegen das Kriterium Berufserfolg als Resultat eines erfolgreichen Studiums, kann sich dieser durch das Einstiegsgehalt oder durch andere Karriere-Indikatoren definieren. Empfiehlt man subjektive Zufriedenheitsmaße als geeignet, bieten sich Studierleistungen im individuellen oder im sozialen Vergleich an (das entspricht dann der Zufriedenheit der Studenten mit sich selbst) oder auch Fragebogenuntersuchungen zur Erhebung von anderen, weichen Faktoren der Zufriedenheit. Letztlich bedeutet die Wahl eines geeigneten Kriteriums den Ausgangspunkt bei der Erstellung einer Auswahlprozedur da dies das Ziel markiert, auf das hin ausgewählt werden soll (mit WR, 2004).
5 Die Definition des Prädiktors
Die Wahl eines Prädiktors richtet sich danach, inwieweit es geeignet ist, das Kriterium Studienerfolg in der Zukunft bereits zum Zeitpunkt des Eintritts in die Hochschule vorherzusagen. Lewin und Lischka (2004) gehen über diesen Ansatz noch hinaus und plädieren für eine Orientierung am Person- Environment- Fit- Paradigma aus der Karriere- und Laufbahnberatung (z.B. Holland, J. L., 1985, Super, D. E., 1957). Sie interpretieren die von ihnen genannte Passung als „ möglichst hohe Übereinstimmung individueller Kompetenzen der StudienanfängerInnen mit den grundlegenden spezifischen Anforderungen eines Studiums, differenziert nach Inhalt und Profil. […] Passfähigkeit steht somit in unmittelbaren Zusammenhang zwischen individuellen Leistungsvoraussetzungen der Studienberechtigten und den spezifischen profilbestimmenden Anforderungen der Hochschule.“ (S.35). Sie implizieren damit, dass die Universität nicht der alleinige statische Faktor ist, dem die Bewerber sich anzupassen haben (wie es Selektion suggeriert), sondern dass auch die Hochschule die Aspiranten ‚da abholen sollte, wo sie stehen’, was eine Re- Orientierung an den anfangs erwähnten Artistenschulen und der damit verbundenen Übernahme der Schulung von Studierfähigkeiten beinhaltet.
Konstrukte
Erstellt man eine Auswahlprozedur, muss man sich unweigerlich auch der Frage nach den zu messenden Konstrukten stellen: Was genau soll an kognitiven Fähigkeiten, Verhalten oder Einstellungen erhoben werden, das einem (hier noch unabhängig von der Erhebungsmethode) Rückschlüsse auf den zukünftigen Studienerfolg erlaubt? Der enge Zusammenhang zu der in Kapitel 3 dargestellten Problematik zwischen Prädiktor und Kriterium wird hier wieder deutlich. Lewin und Lischka (2004) schlagen 7 Bereiche vor, aus denen geeignete Konstrukte gewonnenen werden sollen, zur Testung vor:
- Fachliche Kompetenz (i. S. v. Fachwissen)
- Kognitive Fähigkeiten
- Individuelle Neigungen, Begabungen und Interesse (im Profilvergleich)
- Motivation
- Methodische Kompetenzen
- Soziale Kompetenzen
- Informationen über die Studienanforderungen
Der Hochschulverband (1984, in Lewin und Lischka, 2004) definiert Hochschuleignung ähnlich als:
- Für alle Fachdisziplinen geltende Kriterien wie Lern- und Leistungsbereitschaft, Denkvermögen, Selbständigkeit und Motivation, Ausdauer und Belastbarkeit, Auffassungsgabe, Urteilsfähigkeit, intellektuelle Neugier und Arbeitsqualität
- Vier Fächer, die für jegliches Studium unentbehrlich oder nützlich sind (Deutsch, Mathematik, erste und zweite Fremdsprache)
- Fächerprofile im Sinne einer unterschiedlichen fachlichen Ausrichtung der Schüler als Orientierungshilfe für das Fachstudium.
Außerhalb Deutschlands sind hochschuleigene Auswahlverfahren durchaus üblich und gut beschrieben (Deidesheimer Kreis, 1997, WR, 2004) und auch in Deutschland gibt es bereits Erfahrungen in diesem Bereich. So ist Studierendenauswahl an den etablierten privaten Hochschulen üblich; in staatlichen Institutionen hat man Erfahrungen bei der Zulassung von Medizinstudenten und bei fast allen künstlerischen Fachrichtungen. Im Folgenden sollen verschiedene Methoden aufgezeigt und diskutiert werden, die in der Studierendenauswahl in Betracht kommen.
Abiturnote
Die Durchschnittsnote des Schulabschlusszeugnisses ist trotz massiver Kritik (siehe Kap. 2) der absolute (weltweite) Klassiker unter allen in die engere Wahl kommenden Auswahlinstrumenten und ist von der Gründung der ZVS 1978 an bis heute neben der Wartezeit sogar der einzige Prädiktor in den bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengängen. Dies hat teilweise seine Berechtigung: Die Abiturnote ist ein hoch-aggregiertes (und daher messgenaues) numerisches Maß für Wissen, aber auch für Motivation, Selbstdisziplin und kognitive Fähigkeiten (WR, 2004). Aus einer Meta- Analyse von Baron-Boldt et. al. (1986) geht eine durchschnittliche Validität für Studienerfolg von .456 hervor (für Psychologie bei .455). Auch neuere Untersuchungen kommen mit Validitätswerten von .41 - .53 zu ähnliche Ergebnissen (Köller & Baumert, 2004). Gebert (2004) zieht aus der umfangreichen Arbeit von Baron-Boldt et. al. (1986) den Schluss, dass je schulähnlicher der zu prädiktierende Bereich ist, desto valider ist die Schulnote für den Erfolg. Heublein et. al. (2002) stützen diese These mit ihrer Erkenntnis, dass die Abiturnote in einem hohen negativen Zusammenhang steht mit der Wahrscheinlichkeit des Studienabbruches. Darüber hinaus spricht für die Abiturnote ihre leichte Verfügbarkeit. Soweit ist die Zeugnisnote der beste verfügbare Einzelprädiktor.
Diese hohe Instrumentalität birgt aber auch Gefahren in sich. So streben Schüler teilweise Fächerkombinationen in den Schulen an, in denen sich die wahrscheinlich besten Leistungen erzielen lassen, unabhängig von ihren Interessen und den Anforderungen ihres Wahlstudienganges.
Es gibt mehrere Ansätze, die mangelnde Objektivität (siehe Kapitel 2) und Validität des Abiturs bei der Studierendenauswahl zu verbessern. So konkurrieren hierzulande Bewerber bei der ZVS immer nur mit den anderen Bewerbern ihres Bundeslandes um die für sie bereitgestellten Studienplätze je Universität. In den USA versucht man durch Rankings der Schulen auf Landesebene bzw. der Schüler innerhalb der Jahrgänge einen Ausgleich zu schaffen. Dadurch wird die Leistung eines Schülers gemessen an dem Leistungsniveau der Schule bzw. des Bundesstaates.
Hinzu kommt die Kehrseite des hohen Aggregationsniveaus, das eine fachspezifische Aussage über Schwächen und Stärken verhindert. Abhilfe soll hier die Verwendung (gewichteter) Einzelnoten schaffen. Besonders die Mathematiknote sticht hier mit einer durchschnittlichen Validität für Studienerfolg von 0,344 heraus. Grundsätzlich gilt auch hier: je ähnlicher die Inhalte von Schul- und Studienfach sind, desto valider ist die Note. Trotzdem bringen solche Einzelnoten - seien sie einzeln verwendet oder in gewichteter Kombination - laut dem Deidesheimer Kreis (1997) nur sehr eingeschränkt einen Erkenntnisgewinn mit sich.
Wartezeit
Die Wartezeit stellt nicht wie alle anderen ein eignungsdiagnostisches Instrument dar, sondern hat kompensatorische Funktion: es soll die negativen Auswirkungen der anderen Kriterien ausgleichen und somit helfen, das Recht auf freie Wahl des Studienortes und -fachs sowie der Teilhabe zu wahren (siehe Kap. 2). Dementsprechend sind ihre Auswirkungen: Zum einen verschiebt die Wartezeit die Altersstruktur der Studierenden nach hinten (was volkswirtschaftlich fragwürdig ist), zum anderen erreichen Absolventen mit einer solchen Zulassung weit weniger gute Leistungen als ihre Kommilitonen (WR, 2004).
Tests
Psychologische Testverfahren stellen eine sehr beliebte und erfahrungsreiche Klasse von Auswahlverfahren dar. Ihr Zweck liegt „ zum einen in der Untersuchung empirisch abgrenzbarer Persönlichkeitsmerkmale, zum anderen in der Objektivierung der Schulleistungen oder der ergänzenden Erhebung von Fähigkeiten, die durch die Abiturdurchschnittsnoten nicht oder nicht ausreichend erfasst werden “ (WR, 2004, S. 91). Sie gelten damit als die ideale Ergänzung zu Schulnoten, um deren Nachteile (s. o.) größtenteils auszugleichen und so die Prognosekraft zu erhöhen. In der Regel werden 4 verschiedene Klassen von Tests unterschieden:
Studierfähigkeitstests (aptitude tests) sollen kognitive Fähigkeiten messen, „ die für die Bewältigung der Studienanforderungen von Bedeutung und noch nicht durch Schulnoten oder Ergebnisse von Schulleistungstests dokumentiert sind “ WR, 2004, S. 91). Man unterscheidet hier die beiden Subformen Allgemeine Studierfähigkeitstest und Studienfachspezifische Fähigkeitstests. Der erstgenannte der beiden konzentriert sich auf die generell für ein Studium benötigten kognitiven Fähigkeiten (und beansprucht damit eine Allgemeingültigkeit, wie es nach bisherigem Verständnis die schulische Vorbildung eigentlich gewährleisten soll, s. Kap. 2). Das wohl am häufigsten eingesetzte Beispiel stellt der amerikanische SAT dar, dessen individueller Punktwert darüber entscheidet, ob man an einem College oder einer University angenommen wird. Der Fokus des letzteren liegt dagegen auf Fähigkeiten, die „ für die erfolgreiche Bewältigung der Anforderungen bestimmter Studiengänge als erforderlich gelten “ (WR, 2004, S. 92). Der deutsche Test für Medizinische Studiengänge TMS ist das wohl populärste Beispiel in diesem Bereich (WR, 2004).
Die Validitätszahlen dieser Tests sind beeindruckend. So erreicht der TMS in einer Studie von Trost (1994) Werte von .51 - .53, womit selbst die Abiturnote noch übertroffen wird. Daneben gelten sie als kaum trainierbar und hoch objektiv. Der Nachteil von Tests sind ihr Konstruktionsaufwand, Erprobung und ihre kontinuierliche Pflege (inhaltliche Aktualisierungen, Anpassung der Schwierigkeit, etc), wobei der erst Genannte naturgegeben nur einmalig anfällt und ab dann ein sehr einfach handhabbares, ortsungebundenes und maschinell auswertbares Testinstrument vorliegt. Gebräuchlich sind diese Tests in den USA, GB, aber auch in Schweden und an privaten deutschen Hochschulen. Unter der Voraussetzung, dass den Universitäten der Aufwand der Konstruktion und Aktualisierung / Standardisierung durch eine zentrale staatliche Stelle abgenommen wird, dürften Tests dieser Art bald flächendeckend an staatlichen Hochschulen Verwendung finden (s. Kap. 8) (WR, 2004).
Die zweite große Klasse von Tests sind die Kenntnistests (achievement tests), deren Zweck darin besteht, studienrelevantes Wissen abzufragen. Der Fokus kann dabei entweder auf den belegten Schulfächern liegen (Schulleistungstests) oder den Inhalten des gewünschten Studienfaches (studienfachspezifische Kenntnistests) (WR, 2004). Populäres Beispiel für Letzteren ist der Test of English as a Foreign Language TOEFL. Das gängige Format in diesem Bereich ist das des Multiple Choice, aber auch in Form von Essays (s. u.) oder Interviews (s. u.) ist das Abfragen von Wissen möglich.
Sie dienen hauptsächlich zum Ausgleich der Mängel in den Schulnoten (s. o.), sind aber in Deutschland nach wie vor ungebräuchlich. In den USA, China, Japan und weiten Teilen der EU dagegen sind sie gängige Methode. Aufwand und Nutzen orientieren sich an den Studierfähigkeitstests, wobei die Validitätszahlen hier hinter den Schulnoten zurückbleiben (WR, 2004).
Persönlichkeitstests erfassen meist im Fragebogenformat studienerfolgsrelevante, stabile Persönlichkeitsdispositionen. Die in der Regel nur mäßigen Korrelationen mit Studien- bzw. Berufserfolg (Gebert, 2004) und die mit Persönlichkeitstests verbundenen massiven Probleme lassen von ihrem Einsatz eher abraten. Zu diesen Schwierigkeiten zählen die leichte Verfälschbarkeit der Antworten in Belastungssituationen, die mangelnde Akzeptanz sowie die ungenügende Vergleichbarkeit. Demgegenüber steht der verhältnismäßig geringe Konstruktionsaufwand.
Intelligenztests sind ein äußerst valides und noch dazu einfach handhabbares Instrument, Studienerfolg vorherzusagen. Große Zusammenhänge zwischen kognitiver Leistungsfähigkeit und Berufserfolg von .51 (Schmidt & Hunter, 1998) können auf Grund der hohen Generalität von Intelligenz (zu Korrelationen mit Berufsstatus und Lebenserwartung Asendorpf, 1999, mit Sozialen Status Gebert, 2004) problemlos auf Studienerfolg übertragen werden. Probleme ergeben sich zum einen auf konzeptioneller Seite (Struktur von Intelligenz und Relevanz einzelner Intelligenzaspekte für Erfolg; Wilhelm, 2004, Gebert, 2004, Weinert, 1998) als auch in ethischen Fragen (Weinert, 1998). Wie schon bei Persönlichkeitstests ist der Aufwand für die Anwendung relativ gering, da valide Messinstrumente zahlreich vorliegen und die Auswertung maschinell erfolgen kann.
Interviews
Auswahlgespräche werden definiert als „ gelenkte Gespräche, die darauf abzielen, Informationen objektiver und subjektiver Art über eine Person zu gewinnen “ (WR, 2004, S. 95). In der betrieblichen Personalauswahl bestehen bereits sehr große Erfahrungen mit Einstellungsinterviews. Die Quintessenz besteht darin, dass die Validität von dem Grad der Strukturiertheit und der Anpassung der Anforderungsdimensionen an die Arbeitsplatzinhalte abhängt (Schuler, 2002). Erfolgt beides, so lassen sich Validitätszahlen erreichen zwischen .52 (Schuler, 2002) und .62 (Wiesner et. al, 1988).
Der Zweck solcher Gespräche liegt laut Schuler (2002) darin, Konstrukte zu erfassen, zu denen andere Verfahren nicht im Stande sind. Dazu können simulationsorientierte als auch biographieorientierte Inhalte zählen sowie weiterführende Funktionen der Selbstselektion (durch Erhalt von Informationen im Interview und während der Vorbereitung auf das Gespräch) und das Klären von Unstimmigkeiten in den Bewerbungsunterlagen. Der WR geht noch darüber hinaus und zählt zu den Aufgaben des Interviews auch fachspezifische Studieneignung, allgemeine kognitive Studienvoraussetzungen (wie der generellen intellektuellen Leistungsfähigkeit), personale Qualifikationen (Lernfähigkeit, Gedächtnisleistungen, Ausdauer), kommunikative Kompetenzen und affektiv- motivationalen Merkmalen (Studienmotivation, Charakterzüge wie Humor, Hang zur Fairness u. ä.) (WR, 2004).
Auf Grund ihres hohen Aufwandes für Konstruktion (Anforderungsanalyse, Konstruktion verhaltensverankerter Skalen), Personal und Zeit werden diese Verfahren hauptsächlich in sequenziellen Auswahlprozeduren als abschließendes Instrument eingesetzt. Verwendung finden Interviews in den USA, GB, aber auch an deutschen privaten Hochschulen und es war von 1986-1998 Bestandteil des ‚Besonderen Auswahlverfahrens für die Zulassung zu den medizinischen Studiengängen an deutschen Universitäten’ (WR, 2002).
Gutachten und Empfehlungsschreiben
Schulische Gutachten (letter of recommendation) werden - ähnlich den Interviews - eingesetzt, um Konstrukte zu erfassen, für die andere Testverfahren ungeeignet sind. Dazu gehören motivationale Aspekte und Interessen / Begabungen, aber auch allgemeine Lernleistungen, Persönlichkeitsdispositionen und spezifische Leistungen, die sonst keine Erwähnung fänden. Der Lehrer fungiert hier als unabhängiger Gutachter der Studier- und Leistungsfähigkeit des Bewerbers. In dieser erwünschten Subjektivität liegt auch das größte Problem: Gutachten sind wenig objektiv und zuverlässig, somit kaum vergleichbar (Deidesheimer Kreis, 1997, WR, 2004). Ein zweiter Nachteil liegt auf der Kostenseite: Sowohl die Erstellung als auch das Lesen und die Auswertung solcher Schreiben erfordern viel Zeit und Aufwand (WR, 2004). Beide Nachteile können abgemildert werden, in dem man strukturierte Vorlagen benutzt, was zu ähnlich positiven Effekten führen sollte wie die Strukturierung von Einstellungsinterviews (s. o.). Seine größte Verbreitung findet dieses Instrument in den USA, in GB, Japan und teilweise auch in Frankreich. In Deutschland ist dieses Verfahren in der Personalauswahl durchaus bekannt und akzeptiert, doch in der Studierendenauswahl neu.
Essays
Aufsätze dienen in Ergänzung zu den Bewerbungsunterlagen oder vor Ort erstellt (z.B. beim TOEFL- Test) vor allem dazu, „ einen Eindruck von der Ausdrucksfähigkeit und der Sprachbeherrschung sowie von den persönlichen Qualitäten eines Bewerbers zu vermitteln, die Motivation für die Wahl des Studienfachs und die Gründe für die Wahl der Hochschule darzulegen sowie weitere differenzierte Auskünfte über den Bewerber zu geben (z. B. über sein Engagement auf dem gewählten Fachgebiet, außerschulische Interessen, berufliche Erfahrungen und Zukunftspläne, den Erziehungs- und Bildungshintergrund des Bewerbers) “ (WR, 2004, S. 98). Essays sind primär in den USA, Japan und Teilen Australiens üblich (WR, 2004). Man kann erwarten, dass die Validität stark von der Anforderungsbezogenheit der Fragen und dem Grad der Standardisierung in der Auswertung abhängt.
Probezeit
Eine Probezeit bedeutet ein auf 2 bis 4 Semester zeitlich befristetes Studium alternativ oder ergänzend zu Auswahlverfahren. Dieses Instrument ist besonders in Frankreich hoch akzeptiert und ist heute das gängige Auswahlverfahren an den dortigen staatlichen Hochschulen. Der Reiz dieses Instrumentes liegt zweifelsohne in dem Umstand, dass alle Bewerber für ein Studium ihrer Wahl auf Probe auch zugelassen werden und sie sich „bewähren“ können. Eine Selektion nach Prädiktoren (die naturgegeben immer nur beschränkt die Realität voraussehen können) für Studienerfolg wird so vermieden. Die Selektion erfolgt nachgelagert und verdeckt über ein ‚Aussieben’ in den Zwischenprüfungen, bei denen das Erfolgskriterium sich an den Quoten der Auszulesenden orientiert. Diese simple Form der Probezeit konnte in Deutschland zu Recht nie Fuß fassen. Erreicht ein französischer Student nicht die Leistungsschwelle, so sind bis zu 2 Jahre seines Lebens mehr oder minder verloren und er muss sich, strebt er einen akademischen Grad an, wieder von vorn bewerben in einem weiteren Fach. Dies kommt einer gewaltigen volkswirtschaftlichen Verschwendung von Arbeitsjahren und Bildungsressourcen gleich (Deidesheimer Kreis, 1997).
In Deutschland findet ein Studium zur Probe in manchen Bundesländern nur für Berufstätige ohne allgemeine Hochschulreife statt. Allerdings orientiert man sich hier eher an dem Begriff der Förderung anstatt der Bewährung. Dies kommt den Forderungen von Lewin & Lischka (2004) gleich, die anregten, die Universitäten sollten sich wieder an ihren historischen Vorgängern orientieren und im Stile der Artistenschulen selbst für die Ausbildung studiumsrelevanter Fähigkeiten sorgen. Auch der WR (2004) plädiert für eine einjährige s. g. Orientierende Studieneingangsphase, in der grundlegende Methoden- und Fachkenntnisse vermittelt werden sollen, die so allgemein genug gehalten sein sollen, dass selbst nach dem Ausscheiden aus der Fakultät der Student dieses Wissen an anderer, vergleichbarer Stelle verwenden kann (somit soll die Verschwendung von Lebenszeit verringert werden). Der Hauptkritikpunkt, eine Selektion nach den Ergebnissen von Zwischenprüfungen o. ä. nach ein bis zweit Jahren, bleibt aber natürlich erhalten.
Von allen zuvor besprochenen Instrumenten dient die Probezeit auf beiden Seiten (i. S. v. Lewin & Lischka, 2004) am besten dazu, Informationen über den jeweils anderen in Erfahrung zu bringen. So kann die Universität seine propädeutischen Kurse besser an die Erfordernisse der Studenten anpassen und so adaptiv für ideale Voraussetzungen für das weiterführende Studium sorgen. Die Studenten ihrerseits erhalten Informationen über Inhalt, Anforderungen und Aussichten des Studiums aus erster Hand und müssen sich auf keine unzulänglichen oder bereits vorinterpretierten Quellen verlassen (Lewin & Lischka, 2004, Hermeier, 1992). Somit ist aus Sicht der Selbstselektion ein Studium auf Zeit das ideale Instrument.
Ein Nachteil dieser Methode liegt sicherlich in dem großen Beratungs- und Betreuungsaufwand, der besonders von Studiengängen mit großer Studierendenanzahl kaum zu bewältigen sein dürfte. Der WR (2004) schlägt an dieser Stelle ein Mentoring- und Coaching- Programm vor, das i. W. von den Studierenden höherer Semester getragen wird. Unausgesprochen plädieren sie somit für ein verändertes Rollenverständnis der Studierenden und das Implementieren einer Kultur gegenseitiger Unterstützung über das bisherige, primär informelle Maß hinaus.
Losverfahren
Das Losverfahren gilt als das in strittigen Fragen einfachste und probateste Mittel einer Zulassungsentscheidung. Es wird i. d. R. als letztes Instrument im dritten Nachrückverfahren (also der finalen Auswahlrunde) eingesetzt, wenn sich die wenigen verbleibenden Probanden in ihren Fähigkeiten kaum noch unterscheiden und eine Entscheidung auf Grund von kaum signifikanten Unterschieden als ungerecht empfunden wird. Nichtsdestotrotz bleibt eine Entscheidung, die auf dem Zufall beruht, natürlich – ähnlich wie die Wartezeit – kein eignungsdiagnostisches Instrument, da keinerlei Informationen der Eignung herangezogen werden. Dafür zeichnet es sich durch eine extreme Einfachheit aus – man braucht quasi keinerlei Hilfsmittel oder personelle / finanzielle Ressourcen. Es bleibt ein sehr einfaches Verfahren, das sparsam und nur im Grenzbereich der Eignungsfeststellung eingesetzt werden sollte (mit WR, 2004).
Weitere Auswahlinstrumente
Als weitere Alternativen kämen noch das Assessment- Center oder auch Praktische Vorerfahrungen in Frage. ACs beschränken sich konzeptionell bedingt auf beobachtbares Verhalten (entspricht damit einem simulationsorientierten Ansatz) und bestehen i. d. R. aus Übungen wie Gruppendiskussionen, Präsentationen, Stellungnahmen zu Fallbeispielen, Rollenspielen etc. Das Verhältnis aus Kosten und Nutzen gilt in Anbetracht von nur mäßigen Validitätszahlen um .37 für Berufserfolg (Höft & Funke, 2001) und einem erheblichen Aufwand an Zeit, Personal und Ressourcen im betrieblichen Personalwesen schon als nur bedingt zu empfehlen (dazu und weitere Kritik in Gebert, 2004). Im universitären Kontext dürfte der AC auch wegen der hohen Bewerberzahlen kaum realisierbar sein.
Praktische Vorerfahrungen sind in einigen hochschulinternen Auswahlverfahren üblich, so z. B. in den Kommunikations- und Medienwissenschaften. Der WR weist darauf hin, dass „ durch Praktika [widererwarten] keine Chancengleichheit gewährleistet und die Reliablität des Praktikums nicht hoch einzuschätzen ist “ (WR, 2004, S. 100). In den meisten berufsorientierten Studiengängen gelten Praktika als Bestandteil des universitären Curriculums und müssen von daher nicht bereits im Vorgeld erfolgt sein. Aus Sicht der Selbstselektion ist ein Praktikum im antizipierten Berufsfeld natürlich hochgradig sinnvoll. Es kann erwartet werden, dass durch die Eindrücke bei der Arbeit die Entscheidung gefestigt wird und die Motivation für ein zügiges und erfolgreiches Studium steigt.
Selbstselektion
Die Selbstselektion, also die bewusste Selbsteinschätzung des Bewerbers, für einen Studiengang geeignet oder ungeeignet zu sein, ist ein sehr erwünschtes, wenn auch bislang nur unzureichend unterstütztes Instrument der Selektion. Positiv auf Seiten des Abiturienten erscheint die Selbst- statt Fremdbestimmtheit dieser Entscheidung. Es ist grundsätzlich akzeptabler, eine Entscheidung in Selbsterkenntnis zu treffen, anstatt sie von außen aufoktroyiert zu bekommen. Aus Sicht der Hochschule verbessert sich durch Selbstselektion die Basisrate, also der Anteil potentiell Geeigneter unter den Bewerbern, was zu valideren Entscheidungen in der Auswahl führt (s. Kap. 2).
Die bisher diskutierten Selektionsinstrumente haben, wie teilweise auch schon beschrieben, unterschiedlich viel Potenzial zur Selbsteinschätzung. So erhält ein Bewerber aus einem Persönlichkeitsfragebogen keinerlei zusätzliche brauchbare Information. Wissenstests oder Interviews dagegen vermitteln zum Beispiel sehr gut die Anforderungen des betreffenden Studienganges. Letztlich jedoch sollte die Unterstützung der Selbstseinschätzung nicht erst in der Phase der Auswahl beginnen, sondern weit vorher. Der Entscheidung, den Aufwand, an einem hochschuleigenen Auswahlverfahren teilzunehmen, überhaupt aufsichzunehmen, sollte eine ausführliche Selbstbeurteilung der Eignung bereits vorangegangen sein. Um einen adäquaten Zugang zu dieser Interessengruppe zu finden und sie durch Informationen in ihrer Selbstselektion zu unterstützen, brauchen Hochschulen ein auf sie abgestimmtes Marketingkonzept (Hermeier, 1992, Trogele, 1997) (s. Kap. 7).
6 Kosten / Nutzen
Der Aufbau und die Implementierung eines Auswahlverfahrens kostet eine Organisation Ressourcen. In diesem Anschnitt soll die interessante und berechtigte Frage des (monetären) Nutzens kurz erörtert werden, der diesen Kosten gegenübersteht. Einfluss auf diese Kalkulation nimmt gleich eine Vielzahl von Faktoren:
- die Anzahl der Bewerber
- die Selektionsrate
- die Basisrate
- das Ausmaß des Unterschieds (die Streuung) zwischen guten und schlechten Studenten
- die Studiendauer
- die Validität
- die Kosten des Selektionsverfahrens.
Eine entsprechende Formel kann lauten: . (Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten steht hier für den mittleren inkrementellen Nutzen pro Einstellung, Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltenfür 1 Standardabweichung des Kriteriums (also Studierfähigkeit), Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten ist der Validitätskoeffizient,Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten ist der mittlere standardisierte Prädiktorwert der eingestellten Bewerber (also z. B. die Testleistung) und Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten schließlich beschreibt die Kosten pro eingestellten Bewerber – Kosten geteilt durch die Selektionsrate).
Egal, welchen Berechnungsweg man wählt, als entscheidend gilt die Abschätzung von SDy, also des qualitativen Unterschieds in der Merkmalsausprägung der Bewerber auf dem Kriterium Studierfähigkeit. Ist der Unterschied groß, so hat eine Fehlentscheidung durch das Selektionsverfahren gravierende Folgen für die durchschnittliche Leistung in der Gruppe der Ausgewählten. Ist der Unterschied dagegen ehr marginal, so kann man auch ressourcen-sparende Verfahren einsetzen, deren Validität zwar nicht so hoch ist, deren Kosten dafür gering sind. Letztlich handelt es sich um ein Ausbalancieren zwischen Investition in die Auswahl und der Wichtigkeit der Entscheidung.
Grundsätzlich verbessert sich das Kosten / Nutzen- Verhältnis, wenn man entweder weniger Ressourcen investieren muss bei gleichem Nutzen oder der Nutzen maximiert wird bei gleich bleibenden Kosten. Der Nutzen eines Selektionsverfahrens liegt im engeren Sinne (d. h. von Aspekten wie z. B. der Sozialen Validität mal abgesehen) einzig und allein in der Anzahl richtiger Entscheidungen. Maßnahmen, die Wahrscheinlichkeit von Fehlern zu reduzieren, wurden bereits in Kap. 3 erläutert. Auf der Kostenseite bestehen Möglichkeiten in der Verwendung möglichst ressourcensparender Instrumente, in der Automatisierung der noch bewerberintensiven ersten Teilschritte eines sequenziellen Vorgehens sowie der Bildung von Partnerschaften mit anderen Hochschulen, um die Entwicklungskosten für ein solches Verfahren aufzuteilen.
Will man eine gleich bleibend hohe Qualität in der Auswahl garantieren und die Hochschulen von den Kosten entlasten, so kommt man letztlich jedoch nicht an einer zentralen Institution wie einem Nationalen Testcenter nach amerikanischem, englischem oder japanschem Vorbild vorbei (WR, 2004, siehe auch Kap. 9)
7 Marketing
Wenn im Folgenden das Hochschulmarketing als ein die Auswahl flankierendes Instrument dargestellt wird, so mag das dieser Arbeit gerecht werden, jedoch an der Realität vorbeigehen. Marketing beinhaltet mehr als auf geeigneten Kommunikationswegen potentielle Bewerber mit Informationen zu versorgen. Vielmehr geht es darum, Austauschbeziehengen mit verschiedenen Interessengruppen (die damit zu Märkten der Hochschule werden) und deren Austauschwerten zu initiieren und stabil über die Zeit hinweg zu halten (Hermeier, 1992). Zu diesen Interessengruppen gehören neben potentiellen Studenten u. a. (in Anlehnung an Kotler, 1978, Tavernier, 1992 und Thieme, 2002):
- Multiplikatoren (Eltern, Leher)
- Wirtschaft und Verbände (Stichwort Drittmittel)
- Föderale Institutionen und Ministerien (EU, Bund, Länder, Gemeinde; Stichwort Eliteförderung)
- Ausländische Partner und Interessenten
- Förderer und Vereine
- Mitarbeiter
- Immatrikulierte Studenten und Alumni
- Medien
- Andere Hochschulen und Ausbildungsträger (z. B. andere europäische Universitäten, Unternehmensinterne Aus- und Weiterbildungsträger; Stichwort Hochschulwettbewerb)
- Forschungsträger
- Potentielle Kooperationspartner
Als historische Vorgänger des heutigen modernen Marketings stellt Thieme (2002) die Pressestellen und die Studienberatung heraus, wobei vor allem Letztere Interessenarbeit im Sinne der Hochschule betrieb. Der zunehmende Wettbewerbsdruck ab Anfang der 90er Jahre bewegte die hiesigen Universitäten zu einem Wettbewerbsbekenntnis, das dem bis dahin stillschweigend geltenden Postulat von der Gleichheit aller deutschen Hochschulen widersprach.
Ziele und Notwendigkeit
Laut Gebert (2004) hat Marketing zwei Ziele: Es sollen potentiell Geeignete für das Unternehmen gewonnen und gute Mitarbeiter im Unternehmen gehalten werden. Tavernier (1992) weist darauf hin, dass Strategisches Management, in dessen Rahmen Marketing erfolgt, in erster Linie eine langfristige Positionierung der Institution in ihrem sozioökonomischen, politischen und technischen Umfeld, also eine Richtungsbestimmung bedeutet und erst in zweiter Linie die Frage nach den probaten Mitteln und Wegen zur Erfüllung dieser Positionierung vorgibt. Der übergeordnete Zweck besteht darin, die Zielvorstellungen der Organisation mit den Nutzenvorstellungen der Interessengruppen in Einklang zu bringen; es soll also eine win-win- Situation erzeugt werden (Engelhardt, 1993). Durch die selbst- evaluativen Aktivitäten (Was sind die Stärken und Angebote der Organisation? Was will man eigentlich nach außen kommunizieren?), die den ersten Schritt im Marketing darstellen, erfüllt es unter näherer Betrachtung mehrer Zwecke:
- Eine effizienteren Ausnutzung der Marketingaktivitäten
- Eine besseren Erfüllung des Gesetzlichen Auftrages
- Eine erhöhten Zufriedenheit der Austauschpartner und
- Ein der erleichterten Ressourcenbeschaffung (Hermeier, 1992).
An dieser Stelle wird die konzeptionelle Nähe von Marketing zum P-E-Fit- Paradigma aus der Laufbahnberatung sowie dem Total-Quality-Management- Ansatz in der Managementlehre sichtbar.
Aus Sicht der Studierendenauswahl sind die Aspekte der Profilierung (dies geschieht zwangsläufig, s. o.) und der Informationsweitergabe an die Bewerber natürlich ausschlaggebend. Das bereits in Kap. 2 diskutierte Thema der Wahl des Studienortes nach sachfremden Kriterien fasst Hermeier (1992) sehr präzise zusammen als das für die Dienstleistung Lehre spezifische Problem der Intangibilität. Da universitäre Ausbildung erstens immateriell ist und zweitens durch einen Interaktionsprozess zwischen Hochschule und Student geprägt ist (und damit abhängig ist von ihnen), ergibt sich eine eingeschränkte Beurteilungsfähigkeit und dadurch ein erhöhtes Entscheidungsrisiko (dazu und weitere problematische Charakteristiken der Dienstleistung Lehre: Hermeier, 1992, ab S. 80) .
In Folge dessen werden meist wenig valide aber sichere Schlüsselinformationen wie materielle Elemente einer Dienstleistung oder auch die mit ihr verbundenen persönlichen Kosten (z. B. die Entfernung zum Wohnort, s. Kap. 2) herangezogen. Die wahrscheinlich bedeutendste Entscheidungshilfe aber ist das Image einer Hochschule (wo sich der Kreis zu dem am Anfang besprochenen Strategischen Marketing schließt). Das Image wiederum ist nur bedingt durch kommunikative Maßnahmen der Universität steuerbar. Das hohe Entscheidungsrisiko auf Seiten der Bewerber lässt diese den persönlichen Kontakt suchen mit Personen, die über Erfahrungen mit der Institution verfügen (experience qualities) oder aber als ausgewiesene Experten auf dem Feld der Hochschulbewertung angesehen werden (credance qualities). Auf diesen persönlichen Kontakten muss das Augenmerk eines erfolgreichen Marketings liegen (Hermeier, 1992).
Maßnahmen
Laut Thieme (2002, S. 7) haben Universitäten folgende Möglichkeiten, sich in Austauschbeziehungen einzubringen: „ Die Produkte von Hochschulen können Studiengänge, Forschungsleistungen, Weiterbildungsangebote sowie die Institution an sich (z.B. Merchandising, Nutzungsrechte an Logo und/oder Namen, Vermietung von Werbeflächen, Inserate in Publikationen) sein. Dem Hochschulmarketing stehen vor allem die Instrumente Produktqualität, Produktsortiment, Markenbildung sowie ergänzende Kundendienste zur Verfügung. Der Erlös, der für die Gesamtheit der Produkte erzielt werden muss, hat mindestens den Fortbestand der Institution zu sichern. Marketinginstrumente von Hochschulen sind dabei in erster Linie die Lobbyarbeit zur Beschaffung öffentlicher Gelder einschließlich der Haushaltsfinanzierung, die Erhebung von Beiträgen und Gebühren sowie die Einwerbung von Spenden und Sponsoring.
Im Bereich Kommunikation stehen Hochschulen prinzipiell die gleichen Marketinginstrumente wie anderen Institutionen zur Verfügung. Dies sind insbesondere Werbung, Public Relations, Sponsoring, Event-Marketing, Verkaufsförderung, persönliche Beratung, Pressearbeit, Corporate Identity, Kommunikation mit neuen Medien. Die Distribution der Produkte von Hochschulen erfolgt vorrangig auf direktem Wege an den Abnehmer in der Regel in Form von Präsentveranstaltungen, Medien oder dokumentierten Forschungsergebnissen. Durch die Finanzierung der einzelnen Bundesländer kann die Darstellung der Leistung der Hochschule gegenüber der Landesregierung, dem Parlament und dem zuständigen Ministerium auch als eine Form der Distribution aufgefasst werden.“
Für Hermeier (1992) bestehen Marketingaktivitäten aus 2 Säulen (Abb. 3): der Leistungspolitik und der Kommunikationspolitik. Trogele (1997) nennt dies auch anschaulich die Sicht nach Innen und die Sicht nach Außen. Ersteres befasst sich quasi mit den Inhalten, Letzteres mit den geeigneten Wegen und Maßnahmen zur Verbreitung dieser. In die Leistungspolitik fallen dann zum Beispiel Aktivitäten wie Selbstanalyse, Festlegung der Studien- und Prüfungsinhalte und Evaluation der Lehre, aber auch Serviceleistungen (wie Laufbahnberatung, Praktika- Börsen) und das Corporate Design; zur Kommunikationspolitik gehören z. B. Marktforschung, Öffentlichkeitsarbeit und Marketingplankontrolle.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Die Bestandteile des Hochschulmarketings; In Anlehnung an Hermeier, 1992, S. 240 und Trogele, 1997, S 171.
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die beiden Begriffe Marketing und Strategisches Management in der Literatur oftmals synonym gebraucht werden. Trennscharf betrachtet ist Marketing der kommunikative Teil (Befragung zu Image und Unternehmenspositionierung, Werbung, Teilnahme an Messen, etc. (Gebert, 2004)) des Strategischen Managements als ganzes, das seinerseits aber auch noch alle anderen sich gegenseitig bedingenden Aspekte wie z. B. die des Controllings, der Qualitätssicherung, der Marktanalyse- und Bewertung, der Profilbildung, etc. beinhaltet.
Klassische Instrumente des Marketings (im Engeren Sinne als Kommunikation des Unternehmens nach Außen) von Non-Profit- Organisationen sind nach Meissner (1992):
- Public Relations mit Studierenden, Unternehmen v. O., Verkehrsbetrieben v. O., Politikern v. O.
- Werbung
- Imagekampagnen
- Sponsoring / Veranstaltertätigkeiten (z. B. Kongresse) / Ausstellungen
- Klassische Pressearbeit
- Vertretung auf Messen und Tagungen
- Persönliche Kommunikation.
Teilweise sind die Aktivitäten auf diesem Sektor auch schon weit gediehen: mit competo haben sich die Universitäten Dortmund, die TU Dresden, die TU Hamburg-Harburg, die Hochschule der Künste Berlin und die Fachhochschule Potsdam im Dezember 2000 zu einem Kompetenznetzwerk für das Hochschulmarketing zusammengeschlossen. (Vertiefend und zu ausführlichen Vorschlägen für Konzepte eines hochschulgeeigneten Marketings siehe Trogele, 1997 und Hermeier, 1992; eine ausführliche Literaturliste zum Thema Hochschulmarketing befindet sich im Anhang.)
8 Probleme
Aufwand
Der Aufwand der Hochschulen, eine geeignete Selektionsprozedur zu entwickeln, zu testen und zu implementieren ist enorm. Selbst wenn - wie es derzeit an der Psychologischen Fakultät der HU geschieht - die Universitäten die Ressourcen aufbringen, ein Verfahren in Eigenregie entwickeln, so scheitert ein valides, sequenzielles Vorgehen spätestens am administrativen Aufwand der Bearbeitung der Bewerbungen (zu den Bewerberzahlen s. Kap. 2). Die Lösung dieses Problems kann nicht allein in den Händen der Hochschulen liegen, sondern sollte bundesweit gesucht werden. Mit bemerkenswerter Regelmäßigkeit finden sich in der Literatur Forderungen nach einer zentralen Institution, die den Bewerbern das Prozedere der Testentwicklung und Anwendung abnimmt. Ein solcher Nationaler Testcenter nach amerikanischem, englischem oder japanischen Vorbild könnte aus der derzeitigen Zentralen Vergabestelle für Studienplätze ZVS in Dortmund heraus entstehen, konkrete Überlegungen zur Ausgestaltung dessen existieren bereits (z. B. WR, 2004). Als reizvoll erscheint die weiterführende Option, nach amerikanischem Vorbild die Eingangstestung der Bewerber auch dezentral an den Schulen abzunehmen. Letztlich würde eine Regelung, nach der die Selektion zwar nach von der Hochschule festgelegten Kriterien aber von ihr unabhängig erfolgt das Ideal für diese bedeuten, so dass sie sich wieder auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können: dies sind Lehre und Forschung.
Ein anderes, gewichtiges Argument betrifft die Relevanz der Auswahl. In diesen Bereich fällt sowohl das von einigen Kritikern vorgebrachte Argument, die Hochschulen hätten auch früher schon das Recht gehabt, bis zu 20% ihrer Studenten selbst auswählen zu dürfen (Reith, 2004), als auch die Befürchtung der Universitäten, dass herausselektierte Bewerber über Umwege doch noch zu einem Studienplatz gelangen. Ersteres greift in seiner Argumentation zu kurz: Unbeachtet der Anzahl der zu vergebenen Studienplätze müssen Auswahlverfahren trotzdem für die gesamte Bewerbergruppe durchgeführt werden. Erhält ein Bewerber in dieser Selektion keinen Platz, so hatte er die Chance, über das ZVS- Verfahren doch noch zu seinem Studium zu gelangen. Hinzu kommt, dass Selektion primär im Grenzbereich der Eignung sinnvoll ist. Es ist hoch wahrscheinlich, dass die Studenten, die durch die Universität ausgewählt worden wären, über die ZVS sowieso zu ihrem Studiengang gekommen wären (zur Korrelation von Abiturdurchschnittsnoten und Studieneignung siehe Kap. 4). Die Auswahl wurde so im großen Stil zur Makulatur.
Prinzipiell ist ein solcher Schleichweg zum Studium auch nach dem Wintersemester 2005/2006 noch möglich, da die ZVS weiterhin 40% der Studienplätze nach eigenen Kriterien vergeben kann (z. B. für soziale Härtefälle, Wartezeit). Hier sollte ein gangbarer Kompromiss aus gesellschaftlichen Interessen und der Relevanz von Selektion nach Leistungskriterien gefunden werden.
Testtourismus
Die jetzige Entwicklung zu mehr Eigenverantwortung der Hochschulen in der Bewerberauswahl ist historisch betrachtet weit weniger ein Schritt vorwärts als vielmehr ein Schritt zurück in die Bundesrepublik der 60er Jahre. Bereits von 1958 bis 1972 besaßen die Hochschulen der modernen Bundesrepublik das Recht, sich ihre Studenten selbst auswählen zu dürfen. Die Folge waren hohe administrative Belastungen auf Seiten der Universität wegen tausender Mehrfachbewerbungen und auf Seiten der Abiturienten wegen der als „Testtourismus“ bekannt gewordenen Notwendigkeit, an den hochschuleigenen Verfahren teilzunehmen. Folge dessen war ein Beschluss des BGH, dem der Gesetzgeber durch die Einrichtung eben der ZVS Rechnung trug, die heute als antiquiert angesehen wird. Der Deidesheimer Kreis (1997) fasst zusammen, dass solange diese Probleme von einst nicht gelöst sind, Beschlüsse zur Flexibilisierung der Studierendenauswahl nur begrenzt Sinn machen.
9 Fazit
Zusammenfassend kann man festhalten, dass Studierendenauswahl auf der einen Seite wegen der Bewerberschwemme notwendig ist und auf der anderen Seite auch gewünscht wird, sowohl auf Grund von Wettbewerbsargumenten von Seiten der Politik als auch wegen Selbstbestimmungs- und Profilierungsaspekten der Hochschulen. Des Weiteren wurde herausgearbeitet, dass Hochschulmarketing als elementarer Bestandteil einer ausgewogenen Selektionsplanung sich nicht auf diese einseitige Funktion beschränken lässt, sondern vielmehr Bestandteil eines ganzheitlichen Strategischen Managements sein sollte. Dies müsste der konsequenteste Schritt einer bereits seit langem einsetzenden Entwicklung sein, die in den Hochschulen zu einem radikalen Umbruch in ihrem Selbstverständnis führt, weg von akademischen, wirtschaftlich stabil versorgten Inseln der Glückseligkeit hinzu marktwirtschaftlich orientierten Dienstleistern im Wettbewerb mit anderen Hochschulen und Institutionen um Studenten, Drittmittel, Forschungsaufträge und staatliche Förderung (mit Thieme, 2002).
Abschließend sei noch einmal die Forderung nach einem zentralen Testcenter wiederholt, der in seiner Funktion die Konstruktion, Einsatz und Evaluation von Selektionsverfahren in einer Hand vereinigen soll, ohne den Hochschulen die Freiheit der Kriterienwahl streitig zu machen. Bei allem Druck auf die Universitäten, selbst aktiv zu werden in der eigenen Bewerberauswahl, steht hier die Politik in der Schuld, die geeigneten Rahmenbedingungen zu schaffen. Denn unabhängig von der Angemessenheit der eingesetzten Verfahren wird sich letztlich auch in der Studierendenauswahl der Ausspruch bewahrheiten: „ Egal wie gut das Verfahren ist, ausgewählt wird sowieso. Man kann diese Auswahl nur schlechter oder besser gestalten.“
10 Literatur
Asendorpf, J. B. (1999). Psychologie der Persönlichkeit. Heidelberg: Springer
Deidesheimer Kreis. (1997). Hochschulzulassung und Studieneignungstests - Studienfeldbezogene Verfahren zur Feststellung der Eignung für Numerus-clausus- und andere Studiengänge. Göttingen: Hogrefe
Engelhardt, W. E. (1992). Kommunikationspolitik als Ausgangspunkt des Wissensmarketing. In: Engelhardt, W. E., König, J., Nietiedt, T. (Hrsg). (1993). Wissenschaftsmarketing. Bochum: Brockmeyer
Gebert, D. (2004). Skript zur Vorlesung P III Personalauswahl- und beurteilung. Berlin: Technische Universität
Gebert, D. & v. Rosenstiel, L. (2002). Organisationspsychologie. (5. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer
Höft, Funke (2002). Simulationsorientierte Verfahrender Personalauswahl. In Schuler, H. (Hrsg.). Lehrbuch der Personalpsychologie. Göttingen: Hogrefe
Kotler, P. (1978). Marketing für Nonprofit Organisationen. Stuttgart: Poeschel
Lewin, K./Heublein, U./Schreiber, J./Spangenberg, H./Sommer, D. (2001). Studienanfänger im Wintersemester 2000/2001: Trotz Anfangsschwierigkeiten optimistisch in die Zukunft. Hannover: HIS-Hochschulplanung 155 in WR Wissenschaftsrat. (2004). Empfehlungen zur Reform des Hochschulzugangs. [On-line] unter: www.wissenschaftsrat.de/texte/5920-04.pdf. Zugriff am 08.11.2004
Lewin, D., Lischka, I. (2004). Passfähigkeit beim Hochschulzugang als Voraussetzung für Qualität und Effizienz von Hochschulbildung, (Arbeitsberichte 6 ’04). Wittenberg: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Hermeier, B. (1992). Konzept eines marketingorientierte Hochschulmanagement. (Diss). Essen: Universität GH Essen
Heublein, U.,Spangenberg, H.,Sommer, D. (2003). Ursachen des Studienabbruchs.
Analyse 2002. in HIS. (2003). Hochschulplanung 163. Hannover: HIS GmbH
HIS Hochschulinformationssystem. (2002). Studienabbruchstudie. [On-line] unter http://www.his.de/Service/Publikationen/Kia. Zugriff am 09.11.2004
HIS Hochschulinformationssystem. (2004). Sozialerhebung 2004 – Hochschulzugang und Studienverlauf. [On-line] unter www.his.de/Abt 2 /Foerderung/hb.soz16/pdf/ Hochschulzugang.pdf. Zugriff am 08.11.2004
Holland, J.L. (1985). Making Vocational Choices: A Theory of Vocational Personalities
and Work Environments. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.
HU. (2004). Material zur Strukturplanung - Interne Datenerhebung der Humboldt- Universität 2004. Berlin: HU
MBWFL SH Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holtstein. (2000). Studienabbruch. [On-line] unter www.lvn.parlanet.de/infothek/ wahl15/drucks/1700/drucksache-15-1746.pdf. Zugriff am 13.11.2004
Meissner, H. G. (1992). Marketing für Non-Business-Organisationen. In: Engelhardt, W. E., König, J., Nietiedt, T. (Hrsg). (1993). Wissenschaftsmarketing. Bochum: Brockmeyer
Reith, K. H. (dpa) (2004). Bundestag erleichtert Zulassungsregelung für Numerus-Clausus-Fächer. [On-line] unter www.phoenix.de/ereig/exp/20840/. Zugriff am 16.11.2004
Schmidt, F. L. & Hunter, J. E. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology. Psychological Bulletin, 124 (2), S. 262-274
Schuler, H. (2002). Das Einstellungsinterview. Göttingen: Hogrefe
Super, D.E. (1957). The Psychology of Career. New York: Harper & Row.
Super, D. E. (1994). Der Lebenszeit-, Lebensraumansatz der Laufbahnentwicklung. In: D. Brown & L. Brooks (Hrsg.), Karriere-Entwicklung (S. 231 – 280). Stuttgart: Klett-Cotta (Original erschienen 1990: Career Choice and Development).
Tavernier, K. (1992). Marketing- Management in Universitäten. In Engelhardt, W. E., König, J., Nietiedt, T. (Hrsg). (1993). Wissenschaftsmarketing. Bochum: Brockmeyer
Thieme, L. (2002). Hochschulmarketing. [On-line] unter: www.rheinahrcampus.de/~thieme/ Forschung/veroeffentlichung/Hochschulmarketing.pdf. Zugriff am 24.11.2004
Trogele, U. (1997). Strategisches Marketing für deutsche Universitäten. Frankfurt a. M.: Peter Lang
Trost, G. (Hrsg.) (1994). Test für medizinische Studiengänge (TMS): Ergebnisse zum achten Testtermin im besonderen Auswahlverfahren. Teilnehmergruppen aus den alten und den neuen Bundesländern. Vorhersagekraft des TMS im Studiengang Medizin. Bewerberzahlen und Grenzwerte für die Zulassung. Auswirkungen der Neugestaltung des Konzentrationstests - 18. Arbeitsbericht: 1. Februar 1993 bis 31. Januar 1994. Bonn
Weinert, A. B.(1998). Organisationspsychologie. Weinheim: Beltz
Wiesner, W. H., Cronshaw, S. H. (1988). A Meta-analytic investigation of the impact of interview format and degree of structure on the validity of the employment interview. Journal of Occupational Psychology, 61, S. 275-290
Wilhelm, O. (2004). Folien zur VL Diagnostik. Berlin: HU
WR Wissenschaftsrat. (2004). Empfehlungen zur Reform des Hochschulzugangs. [On-line] unter: www.wissenschaftsrat.de/texte/5920-04.pdf. Zugriff am 08.11.2004
Kommentar von Jun. Prof. O. Wilhelm:
Mit den Artistenschulen ist es nicht ganz so zirkusnah wie es im Bericht klingt. Die klassische Universität des Mittelalters hat sich an einem Fächerkanon orientiert. Der Fächerkanon der septem artes liberales stammt aus der Antike. Der Begriff "ars" bedeutet dabei nicht "Kunst" im modernen Sinne, sondern "Technik, Fähigkeit, Sachgebiet, Wissenschaft". Als "liberales" bezeichnete man die artes in der Antike, weil die Beschäftigung mit ihnen eines freies Mannes würdig war.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Textes?
Der Text befasst sich umfassend mit der Studierendenauswahl, einschließlich ihrer Geschichte, Notwendigkeit, testtheoretischen Grundlagen, Definition von Kriterien und Prädiktoren, Kosten/Nutzen-Analyse, Marketingaspekten und Problemen wie Aufwand und Testtourismus.
Warum ist die Studierendenauswahl notwendig?
Die Studierendenauswahl ist notwendig aufgrund begrenzter Studienplätze, hoher Bewerberzahlen, hoher Abbruchquoten, langer Studiendauer, Kosten pro Studienplatz, mangelnder Studienmotivation und Wahl des Studienortes nach sachfremden Kriterien sowie mangelnder Vergleichbarkeit der Studieneignung.
Welche Kriterien können für die Studierendenauswahl verwendet werden?
Mögliche Kriterien sind Studienerfolg (Examensnoten, Abbruchquote, Studiendauer), Berufserfolg (Einstiegsgehalt) und subjektive Zufriedenheitsmaße.
Welche Prädiktoren können verwendet werden, um den Studienerfolg vorherzusagen?
Als Prädiktoren können Abiturnoten, Wartezeit, Tests (Studierfähigkeitstests, Kenntnistests, Persönlichkeitstests, Intelligenztests), Interviews, Gutachten und Empfehlungsschreiben, Essays, Probezeit und Selbstselektion dienen.
Welche Arten von Tests werden in der Studierendenauswahl verwendet?
Es werden verschiedene Arten von Tests eingesetzt, darunter Studierfähigkeitstests (allgemein und fachspezifisch), Kenntnistests (Schulleistungstests und studienfachspezifische Kenntnistests), Persönlichkeitstests und Intelligenztests.
Welche Rolle spielt das Hochschulmarketing bei der Studierendenauswahl?
Hochschulmarketing dient der Profilbildung der Hochschule, der Informationsweitergabe an Bewerber, der Gewinnung geeigneter Bewerber und der Bindung guter Studenten. Es ist ein wesentlicher Bestandteil eines strategischen Hochschulmanagements.
Was sind die Probleme bei der Studierendenauswahl?
Zu den Problemen gehören der hohe Aufwand für die Hochschulen, Testtourismus, die Relevanz der Auswahl und die Frage, wie man ein valides, sequenzielles Vorgehen sicherstellt.
Was ist die juristische Sachlage bezüglich der Studierendenauswahl?
Das Bundesverfassungsgericht erlaubt die Auswahl nach sachgerechten Kriterien unter Berücksichtigung der freien Studien- und Berufswahl (Art. 12 Abs. 1 S. 1 GG) und der Hochschulzugangsberechtigung.
Welche testtheoretischen Grundlagen sind relevant?
Relevant sind die Validität der Testverfahren, die Basisrate (Anteil potentiell geeigneter Kandidaten), die Selektionsrate (Anteil der als geeignet eingestuften Kandidaten) und der Zusammenhang zwischen Prädiktoren und Kriterien.
Was sind die Kosten und der Nutzen der Studierendenauswahl?
Die Studierendenauswahl verursacht Kosten für Entwicklung und Implementierung, aber sie kann den Nutzen erhöhen, indem sie die Anzahl richtiger Entscheidungen erhöht, die Abbruchquote reduziert und die Studiendauer verkürzt.
Welche Maßnahmen können im Hochschulmarketing ergriffen werden?
Hochschulen können verschiedene Produkte anbieten (Studiengänge, Forschungsleistungen), Erlöse erzielen (öffentliche Gelder, Gebühren, Spenden), kommunizieren (Werbung, PR, Sponsoring) und die Distribution ihrer Produkte verbessern (Präsentveranstaltungen, Medien).
Was ist eine Probezeit und wie kann sie in der Studierendenauswahl genutzt werden?
Eine Probezeit ist ein zeitlich befristetes Studium auf Probe, das alternativ oder ergänzend zu anderen Auswahlverfahren eingesetzt werden kann. Es ermöglicht den Bewerbern, sich zu "bewähren", und den Hochschulen, die propädeutischen Kurse besser an die Bedürfnisse der Studenten anzupassen.
Was ist ein Losverfahren und wann wird es angewendet?
Das Losverfahren ist die einfachste Möglichkeit, eine Zulassungsentscheidung zu treffen, wenn sich die verbleibenden Bewerber in ihren Fähigkeiten kaum noch unterscheiden. Es wird im Allgemeinen als letztes Instrument im dritten Nachrückverfahren eingesetzt.
Was ist Selbstselektion und warum ist sie wichtig?
Selbstselektion ist die bewusste Selbsteinschätzung des Bewerbers, ob er für einen Studiengang geeignet ist oder nicht. Sie ist wichtig, weil sie zu valideren Entscheidungen in der Auswahl führt und die Autonomie der Studienplatzbewerber fördert.
- Quote paper
- Sebastian Kunert (Author), 2004, Aspekte der Selektion von Studierenden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109054