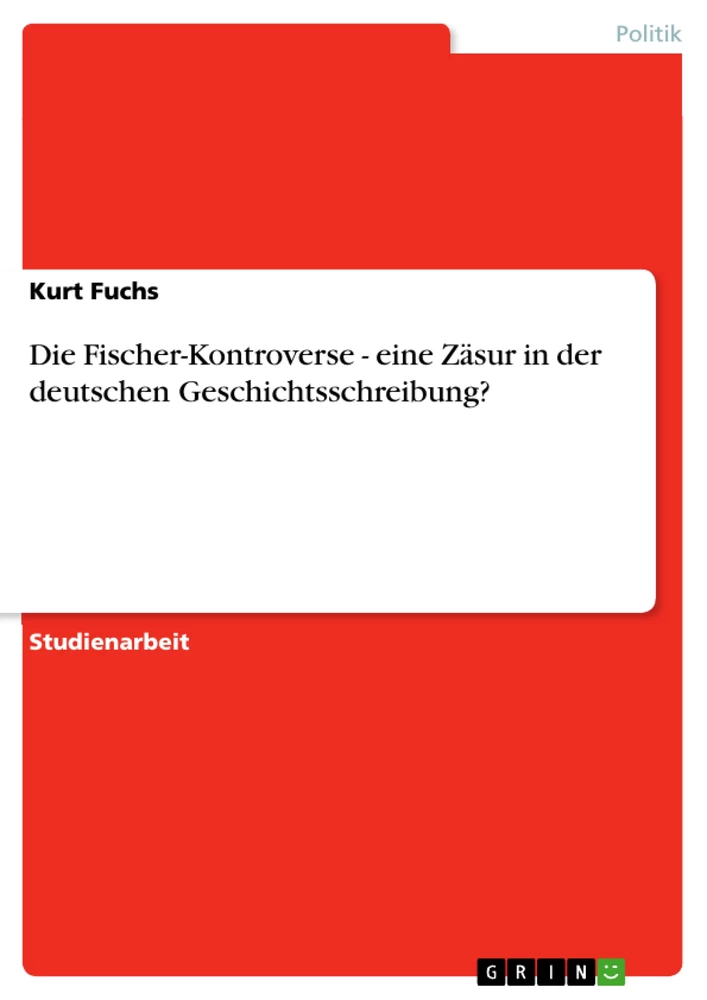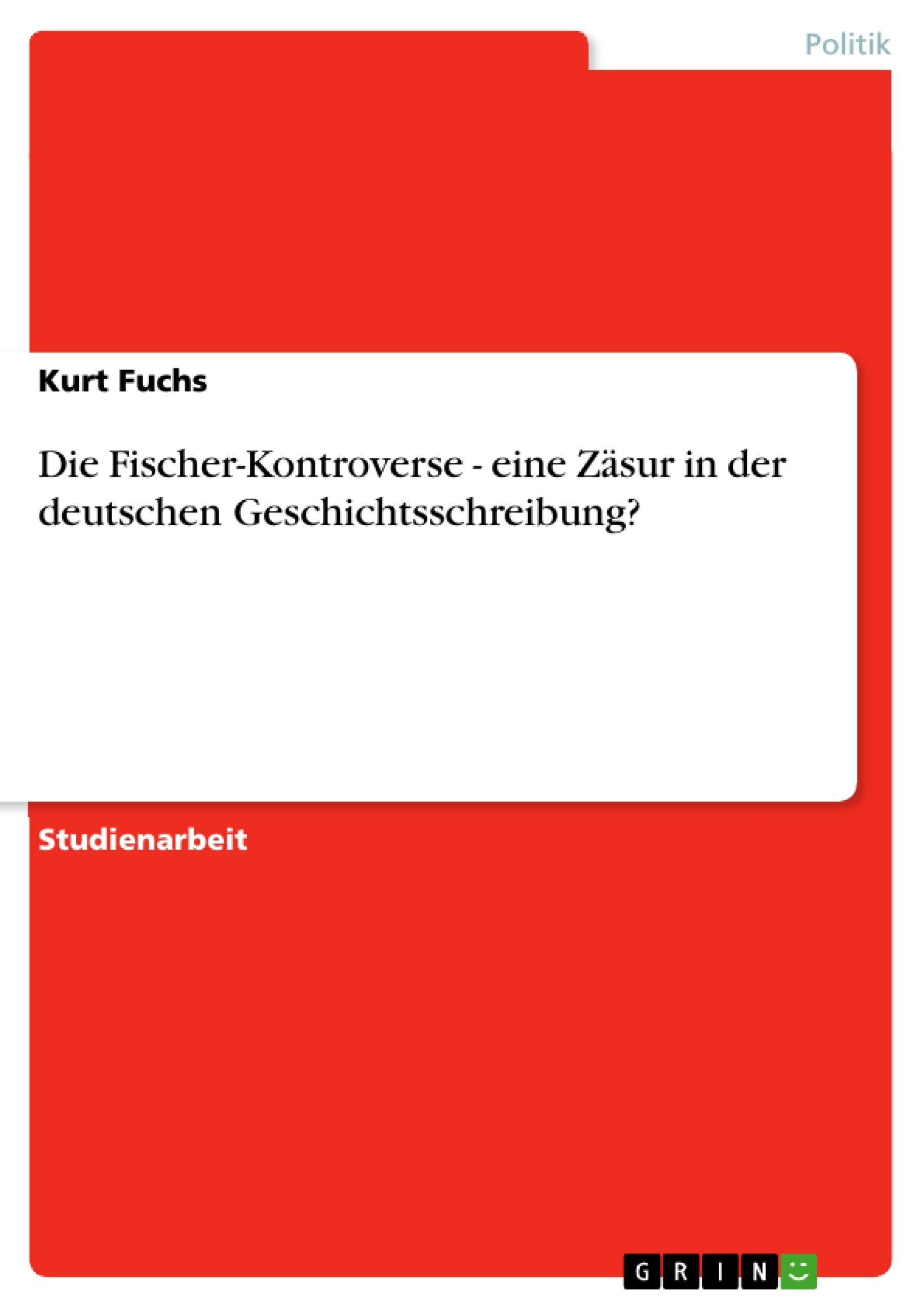In jeder Fachwissenschaft bestehen unterschiedliche Positionen über ihren Untersuchungsgegenstand. Von den akademischen Diskussionen und Debatten nimmt die breite Öffentlichkeit meistens kaum etwas wahr. Selten wird aus einem internen fachlichen Streit auch eine öffentlich geführte Auseinandersetzung. Das trifft ebenso auf den Bereich der Geschichte zu.
In der Vergangenheit gibt es einige Beispiele in denen Historiker aus ihrem sogenannten Schattendasein heraustraten und eine breite öffentliche Debatte auslösten.
Zweimal rückte in solchen Diskussionen inhaltlich die Kriegsschuldfrage im Ersten Weltkrieg in das Blickfeld der Deutschen. Einmal, bereits 1919 einsetzend, durchzog diese Auseinandersetzung den gesamten Zeitraum der Weimarer Republik. Dessen propagandistische Ausrichtung war ein Mosaikstein auf dem Weg in eine Diktatur.
Das zweite Mal, Anfang der 60er Jahre, löste eine fachliche Kontroverse einen öffentlich geführten Streit aus. Dieser leistete maßgeblich einen Beitrag zur politischen Kultur für die Demokratie in der Bundesrepublik – die Fischer-Kontroverse. Gleichzeitig stellte dies eine Zäsur in der Geschichtswissenschaft dar.
Die Berliner Morgenpost vom 3. Dezember 1999 würdigte in einem Nachruf den am Vortag verstorbenen Historiker Fritz Fischer folgendermaßen: „Die meisten Historiker denken nur über die Geschichte nach. Nur wenige aus der Zunft haben auch Geschichte gemacht. … Untrennbar mit seinem Namen verbunden ist der erste große Historikerstreit der Bundesrepublik, die ‚Fischer-Kontroverse’.“
Diese Auseinandersetzung ist Gegenstand der nachfolgenden Arbeit. Ausgehend von den unterschiedlichen Positionen innerhalb der fachwissenschaftlichen Auseinandersetzung wird die öffentliche Wahrnehmung in ihren Wirkungen auf die bundesdeutsche Gesellschaft in ausgewählten Bereichen verdeutlicht. Der Schwerpunkt wurde hierbei auf den Aspekt der politischen Kultur gelegt. Insgesamt sind jedoch nur Grundstrukturen und Leitgedanken berücksichtigt worden, eine detaillierte Ausdifferenzierung hätte den Rahmen der Arbeit gesprengt.
An Aktualität hat die von Fritz Fischer ausgelöste Debatte nichts verloren. Es haben sich fachliche Wandlungen um den Anteil der deutschen Verantwortung am Ersten Weltkrieg und die Frage nach einer Kontinuität, die vom Deutschen Kaiserreich bis hin zur nationalsozialistischen Diktatur führte, vollzogen. Ein abschließender Konsens steht jedoch bis zum heutigen Tage nach wie vor aus.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Fischer-Kontroverse
- 2.1. Die Thesen Fritz Fischers zur Kriegszielpolitik des Deutschen Kaiserreiches im Vorfeld und Verlauf des Ersten Weltkrieges
- 2.2. Die Thesen anderer Historiker zur Kriegszielpolitik des Deutschen Kaiserreiches im Vorfeld und Verlauf des Ersten Weltkrieges
- 3. Die Wirkungen der Kontroverse in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen auf die politische Kultur der BRD
- 3.1. Die Wirkungen auf die wissenschaftliche Analyse vergangener Zeiträume
- 3.2. Die Wirkungen auf die öffentliche Meinung
- 3.3. Die Wirkungen auf den Bildungssektor der Bundesrepublik
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Fischer-Kontroverse und ihren Einfluss auf die deutsche Geschichtsschreibung und politische Kultur. Ziel ist es, die zentralen Streitpunkte der Debatte zu beleuchten und deren Auswirkungen auf die wissenschaftliche Analyse, die öffentliche Meinung und den Bildungssektor der BRD zu erforschen.
- Die Thesen Fritz Fischers zur Kriegszielpolitik des Deutschen Kaiserreiches im Ersten Weltkrieg
- Gegenstimmen und alternative Interpretationen der Kriegsursachen
- Der Einfluss der Kontroverse auf die deutsche Geschichtswissenschaft
- Die Reaktion der Öffentlichkeit und der Medien auf die Fischer-These
- Die Auswirkungen auf den Geschichtsunterricht in der Bundesrepublik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Fischer-Kontroverse ein und beschreibt den Anlass und die Zielsetzung der Arbeit. Sie betont die Bedeutung der Kontroverse als Zäsur in der deutschen Geschichtsschreibung und skizziert den methodischen Ansatz der Untersuchung, der die Analyse der Debatte selbst mit der Erforschung ihrer Auswirkungen auf verschiedene gesellschaftliche Bereiche verbindet. Die Arbeit fokussiert auf die wissenschaftliche Debatte und deren Auswirkungen auf die Geschichtswissenschaft, die öffentliche Meinung und den Bildungssektor, wobei der Einfluss auf andere gesellschaftliche Gruppen nur marginal betrachtet wird. Der historische Kontext und weitere zeitgenössische Debatten werden als bekannt vorausgesetzt.
2. Die Fischer-Kontroverse: Dieses Kapitel präsentiert die zentralen Argumente der Fischer-Kontroverse. Es beginnt mit einer kurzen Übersicht über die Geschichte der Kriegsschuldfrage, um den Kontext der Fischerschen Thesen zu verdeutlichen. Im Anschluss werden Fischers Thesen zur Kriegszielpolitik des Deutschen Kaiserreichs im Ersten Weltkrieg detailliert dargestellt. Das Kapitel setzt die Thesen Fischers in Relation zu den Positionen anderer Historiker, die oftmals eine Kontinuität zwischen dem Kaiserreich und dem Nationalsozialismus ablehnten und eine "Schlitterthese" für den Ausbruch des Krieges bevorzugten. Die unterschiedlichen Interpretationen und ihre Bedeutung für das Verständnis des Ersten Weltkriegs werden analysiert. Der Fokus liegt auf der Kontroverse um die deutsche Kriegsverantwortung und die Frage der historischen Kontinuität.
3. Die Wirkungen der Kontroverse in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen auf die politische Kultur der BRD: Dieses Kapitel untersucht die weitreichenden Auswirkungen der Fischer-Kontroverse auf die politische Kultur der Bundesrepublik Deutschland. Es analysiert die Veränderungen in der wissenschaftlichen Analyse vergangener Zeiträume, die Beeinflussung der öffentlichen Meinung durch Medienberichte und die Auswirkungen auf den Bildungssektor. Der Abschnitt beleuchtet, wie die Kontroverse zu einer Verschiebung im Geschichtsverständnis und in der öffentlichen Debatte über die deutsche Vergangenheit führte und wie sie den Geschichtsunterricht prägte. Durch die exemplarische Betrachtung verschiedener Zeiträume und Perspektiven werden die Veränderungen und Wirkungen auf die politische Kultur aufgezeigt. Der Schwerpunkt liegt auf den Reflexionen der Theoriebildung in der Geschichtswissenschaft.
Schlüsselwörter
Fischer-Kontroverse, Kriegsschuldfrage, Erster Weltkrieg, deutsche Geschichtsschreibung, politische Kultur BRD, Historiographie, öffentliche Meinung, Bildungssektor, Kontinuität, Diskontinuität.
Häufig gestellte Fragen zur Fischer-Kontroverse
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Fischer-Kontroverse. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse der Kontroverse selbst und ihren Auswirkungen auf die deutsche Geschichtsschreibung, die öffentliche Meinung und den Bildungssektor der Bundesrepublik Deutschland.
Worum geht es in der Fischer-Kontroverse?
Die Fischer-Kontroverse dreht sich um die Thesen von Fritz Fischer zur Kriegszielpolitik des Deutschen Kaiserreichs im Ersten Weltkrieg. Fischer argumentierte, dass Deutschland bereits vor Kriegsbeginn aggressive Expansionsziele verfolgte. Diese These wurde von anderen Historikern kontrovers diskutiert, die alternative Interpretationen der Kriegsursachen vorlegten, oftmals mit dem Fokus auf eine "Schlitterthese" und der Ablehnung einer Kontinuität zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die zentralen Argumente der Fischer-Kontroverse, die unterschiedlichen Interpretationen der Kriegsursachen und der deutschen Kriegsverantwortung. Es untersucht den Einfluss der Kontroverse auf die deutsche Geschichtswissenschaft, die öffentliche Meinung und den Geschichtsunterricht in der BRD. Der Fokus liegt auf der wissenschaftlichen Debatte und ihren Auswirkungen auf verschiedene gesellschaftliche Bereiche.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Die Fischer-Kontroverse (mit Unterkapiteln zu Fischers Thesen und den Gegenpositionen), Die Wirkungen der Kontroverse in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen auf die politische Kultur der BRD (mit Unterkapiteln zu Wissenschaft, öffentlicher Meinung und Bildungssektor) und Fazit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Thematik?
Schlüsselwörter sind: Fischer-Kontroverse, Kriegsschuldfrage, Erster Weltkrieg, deutsche Geschichtsschreibung, politische Kultur BRD, Historiographie, öffentliche Meinung, Bildungssektor, Kontinuität, Diskontinuität.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Die Zielsetzung ist die Untersuchung der Fischer-Kontroverse und ihres Einflusses auf die deutsche Geschichtsschreibung und politische Kultur. Es soll die zentralen Streitpunkte der Debatte beleuchtet und deren Auswirkungen auf die wissenschaftliche Analyse, die öffentliche Meinung und den Bildungssektor erforscht werden.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Das Dokument verbindet die Analyse der Debatte selbst mit der Erforschung ihrer Auswirkungen auf verschiedene gesellschaftliche Bereiche. Der Schwerpunkt liegt auf der wissenschaftlichen Debatte und deren Reflexionen in der Theoriebildung der Geschichtswissenschaft.
Welche gesellschaftlichen Bereiche werden betrachtet?
Das Dokument betrachtet primär die Auswirkungen der Kontroverse auf die wissenschaftliche Analyse vergangener Zeiträume, die öffentliche Meinung und den Bildungssektor der BRD. Der Einfluss auf andere gesellschaftliche Gruppen wird nur marginal betrachtet.
- Quote paper
- Kurt Fuchs (Author), 2000, Die Fischer-Kontroverse - eine Zäsur in der deutschen Geschichtsschreibung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1091