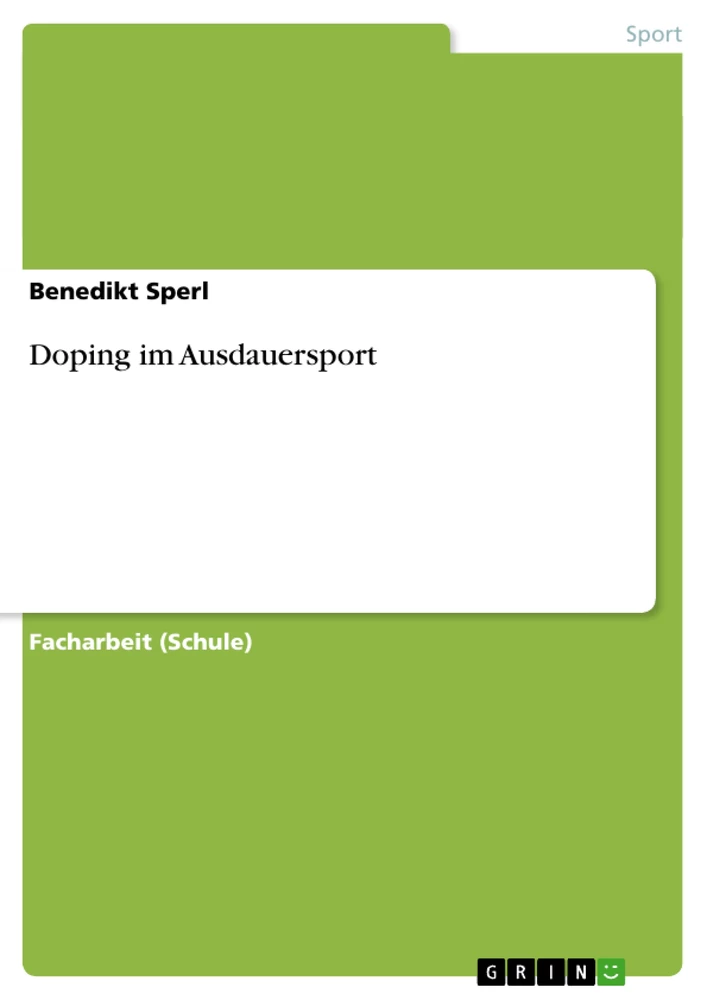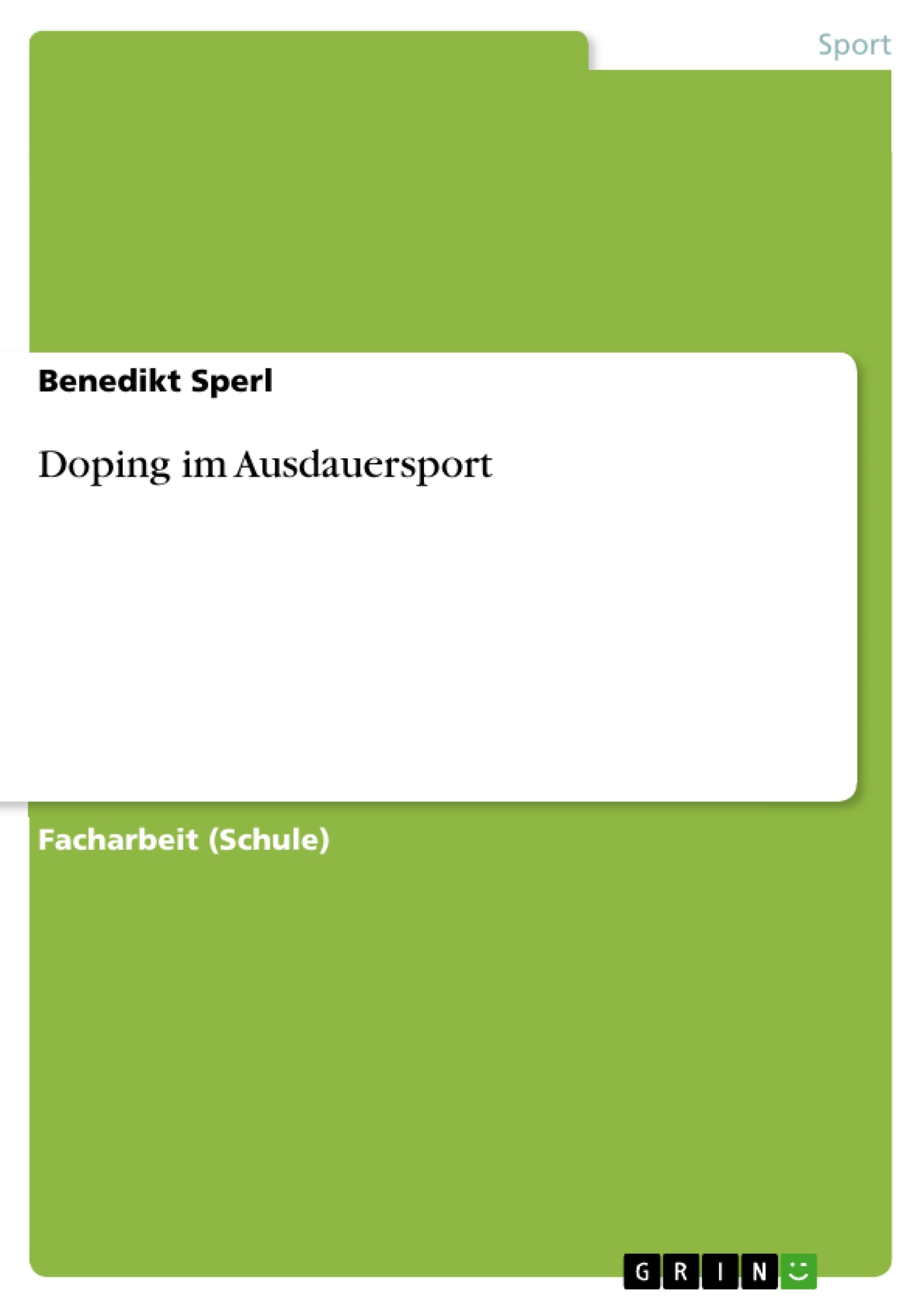Stellen Sie sich vor, die Welt des Sports, in der der schmale Grat zwischen Sieg und Niederlage oft von unerreichbaren Grenzen bestimmt wird. In diesem hochkompetitiven Umfeld, wo Ruhm, Anerkennung und lukrative Verträge locken, enthüllt dieses Buch eine düstere Realität: Doping. Es ist eine Geschichte von Ehrgeiz, Besessenheit und der Verzweiflung, die eigenen Grenzen zu überwinden, koste es, was es wolle. Von den antiken Ursprüngen leistungssteigernder Substanzen bis hin zu den modernen, hoch entwickelten Methoden des Gendopings, zeichnet dieses Werk ein umfassendes Bild der Entwicklung und der allgegenwärtigen Präsenz von Doping im Sport. Untersucht werden die biologischen Grundlagen, die den Einsatz von Dopingmitteln überhaupt erst ermöglichen, sowie die psychologischen und gesellschaftlichen Faktoren, die Athleten dazu treiben, ihren Körper und ihre Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Arten von Dopingsubstanzen, von Anabolika und Peptidhormonen bis hin zu Stimulanzien und Diuretika, und ihre spezifischen Wirkungsweisen und Nebenwirkungen. Das Buch beleuchtet die ethischen Dilemmata und die moralischen Kompromisse, mit denen Sportler, Trainer und Funktionäre konfrontiert werden, und stellt die Frage, ob der moderne Leistungssport ohne Doping überhaupt noch denkbar ist. Die Leser erwartet eine spannende Reise durch die Geschichte des Dopings, von den ersten dokumentierten Fällen bis hin zu den aktuellen Skandalen, die die Welt erschüttern. Es werden die verheerenden Auswirkungen von Doping auf die Gesundheit der Athleten, die Integrität des Sports und das Vertrauen der Öffentlichkeit aufgedeckt. Abschließend wirft dieses Buch einen erschreckenden Blick in die Zukunft des Dopings, in der neue, kaum nachweisbare Substanzen und Methoden die Herausforderungen für die Dopingkontrollbehörden noch weiter verschärfen. Ist die Bekämpfung von Doping ein aussichtsloser Kampf, oder gibt es Wege, den Sport wieder sauberer und fairer zu gestalten? Dieses Buch ist ein Muss für alle, die sich für Sport, Ethik und die dunklen Seiten des menschlichen Ehrgeizes interessieren. Tauchen Sie ein in die Welt des Dopings und entdecken Sie die Wahrheit hinter den Rekorden und den Medaillen. Werden Sie Zeuge der fatalen Konsequenzen und der verzweifelten Suche nach dem unfairen Vorteil. Keywords: Doping, Sport, Anabolika, Peptidhormone, Stimulanzien, Gendoping, Ethik, Leistungssport, Gesundheit, Dopingkontrolle, Geschichte, Skandale, Ehrgeiz, Wettkampf, Wahrheit, Betrug, Risiken, Zukunft, Gesellschaft, Athleten, Trainer, Funktionäre, Nebenwirkungen, Sucht, Medikamente, Analyse, Kontrolle, Prävention, Gerechtigkeit, Fairplay, Medizin, Biochemie, Pharmakologie, Olympia, Rekorde.
1. Einleitungsgedanke
Der Versuch einer Leistungssteigerung bei Wettkämpfen, vor allem im Bereich des Sportes, ist wohl so alt wie die Menschheit[1]. Aufgrund der hohen Leistungsdichte im Spitzensport, entscheiden oft Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage. Kommt der Sportler nun zu dem Punkt, an dem er seine Leistungsgrenze offen dargelegt bekommt, ist der Wunsch einer weiteren Leistungssteigerung die logische Konsequenz[2]. Der Leistungssport befindet sich im Moment in einer gefährlichen Entwicklung. Da steht ein Haus in Flammen, und einige Leichtgläubige versuchen, mit der Handpumpe größeren Schaden zu verhindern...
[3] Die Sportler sind immer mehr dazu bereit große Risiken durch die Einnahme von immer neuen Dopingmitteln, mit teils unabsehbaren Folgen, auf sich zu nehmen[4]. Im Folgenden möchte ich versuchen, die Problematik des Dopings darzustellen:
2. Doping – Entstehung und Definitionen
2.1 Entstehung des Dopingbegriffes
Die Wurzel des Wortes Doping lässt sich auf einem im südöstlichen Afrika gesprochenen Dialekt zurückführen. Mit „dop“ bezeichneten die Eingeborenen einen Schnaps der bei ihren Kulthandlungen als Stimulans diente. Das Wort gelang nach England. Dort wurde es zuerst für die Stimulierung von Pferden mit Alkohol verwendet. 1889 erscheint „Doping“ zum ersten Mal in einem englischen Wörterbuch und wird dort als eine Mischung von Opium und Narkotika für die Anwendung bei Tieren definiert. Zunächst beschränkte sich der Begriff nur auf den Tierbereich, wurde aber allmählich auch auf den Menschen ausgedehnt und gelangte somit in den allgemeinen Sprachgebrauch.
2.2 Missbräuche in der Geschichte des Sports
Schon sehr früh in der Geschichte der Menschheit, lässt sich das Bestreben, seine sportmotorische Leistung, durch die Einnahme von bestimmten Substanzen, zu verbessern, nachweisen. Die aus einem Pilz gewonnene Droge Bufotein, soll die Kampfeskraft der skandinavischen Berserker der nordischen Mythologie um das 12-fache gesteigert haben sollen. Auch die griechischen Athleten der Antike versuchten durch Einnahme von Kräutern, Pilzen, Stierhoden u.ä. ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern. Aus dem Südamerikanischen Raum stammen viele Überlieferungen von Inkas, die Cocablätter kauend in 5 Tagen eine Strecke von bis zu 1750 km bewältigt haben sollen. Auch heute noch laufen die Tarahumara aus dem nördlichen Mexiko, die Wurzel des Peyote-Kaktus kauend, 24-72 Stunden lange Wettbewerbe und legen dabei Strecken von 260 – 560 km zurück. Allerdings handelt es sich hierbei um relativ harmlose Maßnahmen oder Methoden der Leistungsverbesserung. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts findet man belegte Beispiele für Doping im modernen Sport.
Der erste dokumentarisch erfasste Dopingfall trat bei Kanalschwimmern in Amsterdam auf.
Bereits 1886 gab es den ersten Todesfall eines Radrennfahrers, der an einer Überdosis Trimethyl starb. Trauriger Höhepunkt für den Leistungssport stellt sich der Fall Ben Johnson dar. Bei den Olympischen Sommerspielen 1988 in Seoul (Südkorea) distanzierte Ben Johnson Carl Lewis und verbesserte seinen eigenen 100-Meter-Weltrekord auf 9,79 Sekunden. Doch eine Laboranalyse seines Urins ergab, dass er über einen langen Zeitraum anabole Steroide eingenommen hatte. Man erkannte ihm die Goldmedaille ab, annullierte seine Weltrekorde und sperrte ihn zwei Jahre für alle Veranstaltungen der International Amateur Athletic Federation (IAAF)[5].
Während sich das Doping bis 1940 eher auf wenige Sportarten begrenzte, wurde es im Zweiten Weltkrieg, durch die allgemeine Verwendung von wachhaltenden Substanzen bei Nachtflügen, Dauermärschen, etc. einer breiten Bevölkerungsschicht zugänglich.
2.3 Definition des Doping des Deutschen Sport Bundes
Die heute gültige Definition des Deutschen Sport Bundes (2000):
- Doping ist der Versuch der Leistungssteigerung durch die Anwendung (Einnahme, Injektion oder Verabreichung) von Substanzen der verbotenen Wirkstoffgruppen oder durch die Anwendung verbotener Methoden (z.B. Blutdoping)
- Die Liste der verbotenen Wirkstoffgruppen umfasst z.B. Stimulanzien[6], Narkotika[7], anabole Substanzen[8], Diuretika[9], Peptidhormone[10] und Verbindungen, die chemisch, pharmakologisch oder von der angestrebten Wirkung her verwandt sind sowie Cannabinoide[11].
- Sportspezifisch können weitere Substanzen und Wirkstoffgruppen, z.B. Alkohol[12], Sedativa, Psychopharmaka, Beta-Blocker[13] unter den Doping-Substanzen aufgeführt werden.
3. Grundlagen
3.1 Biologische Grundlagen für das Doping
Verfügbar durch normalen Willenseinsatz sind nur etwa 80 % der maximalen Leistungsfähigkeit. Die restlichen 20 % sind die sog. autonom geschützten Reserven[14]. Die Grenze der maximalen Leistungsfähigkeit und den geschützten Reserven kann durch Ausdauertraining nach oben verschoben werden. Jedoch kann die maximale Leistungsfähigkeit nie 100 % erreichen. Diese Leistungsreserven werden nur in Extremsituation abgerufen, etwa bei Wut, Angst oder Lebensgefahr. Eine weitere Möglichkeit diese Barriere zu durchbrechen, ist die Einnahme von Dopingsubstanzen. Zunächst spürt der Sportler die Ermüdungserscheinungen nicht. Erst nach dem Verbrauch der autonom geschützten Reserven tritt eine Ermüdung ein. Dadurch kann es zu einem massiven plötzlichen Leistungsabfall kommen, sowie zu einem Herz-Kreislauf-Zusammenbruch, evtl. sogar mit Todesfolge. Darin besteht die außerordentliche Gefährdung der gedopten Sportler.
Ein weiterer wichtiger Faktor, ist das Glauben an die Wirksamkeit der Dopingmittel. Ohne diesen Glauben käme wohl auch die moderne Medizin nicht aus. Unter diesem Aspekt können alle suggestiv verabreichten Mittel die sportliche Leistung steigern. Dabei dürfte es meist schwer fallen, pharmakologische Wirkung und die motivationsbedingte Leistungsverbesserung exakt zu trennen.
Grundsätzlich gesehen, können leistungsverbessernde Mittel an zwei Stellen in den Trainingsprozess eingreifen.
3.2 Doping in der Belastungsphase
In der Belastungsphase bewirken bestimmte Pharma eine vermehrte Ausschöpfung der Leistungsreserven.
Die meisten dieser Mittel haben eine stark verlängerte Erholungszeit, das heißt dass durch die verlängerte Erholungszeit eine verminderte Trainingshäufigkeit möglich ist. Letztendlich führt das zu einer Verminderung der Leistungsfähigkeit.
Der Organismus wird ständig dazu aufgefordert neue Reserven anzulegen. Logischerweise gerät der Körper dadurch in eine Gefahrenlage. Bei sportlicher Belastung kann es zu teils lebensgefährlichen Zusammenbrüchen kommen.
Zu diskutieren sind auch die Anwendungen von Lokalanästhetika und Kortisionpräparaten. Diese Präparate werden bei Schäden am Stütz- und Bewegungssystem verwendet und dienen der Beseitigung des Schmerzes. Darin liegt allerdings ein großes Risiko, da diese Beseitigung der Schmerzen die lebenserhaltenden Schutzreflexe stört. Generell gesehen sollte die Lokalanästhetika nicht dazu verwendet werden, einen verletzten Sportler doch noch zur Teilnahme an einem Wettkampf zu bringen. Hierbei entsteht ein erhöhtes Verletzungsrisiko, bei dem auch Folgeschäden nicht ausgeschlossen werden können. So sollten starke Schmerzen, die ein Sportler empfindet auch zu einem Wettkampfabbruch führen.
3.2 Doping im Trainingsprozess und der Wiederherstellungsphase
Durch künstliche Zufuhr von Vitaminen, Eiweißgemischen, ebenso wie Hormonen, können die Wiederherstellung und die Superkompensation nach sportlichen Belastungen gefördert werden, z.B. durch Anabolika[15].
Daraus folgt, dass die Trainingsbelastung insgesamt erhöht werden kann, was zu einer Leistungssteigerung führen kann. Ebenso wird das Ausmaß der trainingsbedingten Adaption gesteigert. Diese Mittel können die Mühen des Trainings allerdings auch nicht ersetzen, denn ohne Training bewirken sie keinerlei Leistungsverbesserung. Bezüglich der organischen Gesamtleistung sind sie sehr fragwürdig, denn sie wirken meist einseitig auf bestimmte Organe, können zu Disproportionen in deren Entwicklung und zu Verletzung wegen Überforderungen führen.
4. Gründe und Motive für den Griff zum Dopingmittel
Sportler wie Trainer erhoffen sich durch die Einnahme von Dopingmitteln und durch die Anwendung bestimmter Dopingmethoden eine Steigerung der sportlichen Leistungsfähigkeit.
Der Griff zum Dopingmittel wird zunehmend bestimmt von der anwachsenden Leistungsdichte im Spitzensport, des Wettlaufes von Werbemanagern die auf der Suche sind nach Ausnahmeathleten um diese unter Vertrag zu nehmen. Ein wesentlicher Faktor ist auch der allgemeine „Citius-Altius-Fortius-Gedanke“[16], der sowohl von der Presse wie auch von unserer Leistungsorientierten Gesellschaft geprägt wird. Mangelnde Bedenken beim Griff zu Dopingmitteln, bzw. –methoden können eine Konsequenz daraus sein. Doping wird am besten als eine logische Schlussfolgerung des Ehrgeizes verstanden, die Leistung zu verbessern, ohne dass diesem Ehrgeiz jegliche Beschränkungen unterworfen seien.
Traditionellerweise haben die Regeln der Sportlichkeit die Beziehungen zwischen Sportlern geregelt, deren sportliche Fähigkeiten weniger wichtig waren als ihre ehrenvolle Absichten; wobei die Muskeln weniger zählten als sportliche Motive des Sportlers. Dieses Ethos der ehrenhaften Selbstbeherrschung ist keinesfalls ausgelöscht, aber es hat gegenüber der modernen Fixierung auf Leistung, die das Ideal des Fairplay überlagert hat, an Boden verloren.
Athleten als Profis, deren Beruf der Sport ist, sehen sich innerhalb der Vorbereitungsphase und den Wettkämpfen einem permanenten Leistungsdruck ausgesetzt. Es geht längst nicht mehr darum, nur der beste zu sein, weil der Spitzensportler, solange er mit guten Leistungen aufwartet, dem Staat und der Gesellschaft in erster Linie gut und auch teuer ist. In Erwartung respektabler Leistung wird in und um die medaillenträchtigen Athleten, die sportlichen Vorbilder der Jugend und Aushängeschilder der Nation, in deren Schatten sich politische Prominenz und Funktionäre gerne sonnen, investiert.
[17]. Der Sport ist eine gesellschaftlich relevante Größe, was die Zahl seiner Mitglieder, der Verbände und das öffentliche Interesse sowie die Medien immer wieder unterstreichen. Nicht zuletzt wird der Spitzensportler damit unter Druck gesetzt, dass er Höchstleistungen nicht nur erbringen muss, um den Zuschauer zu unterhalten und um sich an den Gegner zu messen, sondern auch um sich finanziell abzusichern. Entscheidet sich ein Sportler für den Profisport, kann er somit aus Trainingsgründen nicht mehr am Arbeitsprozess teilnehmen. Der Sportler will aber logischerweise ernährt und langfristig abgesichert sein. Denn Tatsache ist, dass je nach Sportart, die der Sportler ausübt, die körperliche Leistungsfähigkeit eines Athleten, der sich im Hochleistungsbereich aufhalten will, zeitlich begrenzt ist. Während der „Normalbürger“ am Ende jeden Monats seinen Lohn erhält, ist der Sportler auf seine Werbepartner und Preisgelder angewiesen.
Aus diesem Grund mag es vielleicht fast verständlich sein, dass einige Sportler versuchen, sich mit Einnahme von Dopingmitteln, möglichst lange im Spitzensport aufzuhalten, um sich für ihre Zukunft abzusichern.
Ist der Sportler an sich noch entscheidungsfrei?
Wenn man von dem fatalen Gedanken ausgeht, dass der Sportler treu nach dem „Citius-Altius-Fortius-Gedanke“ unermüdlich weiter trainiert, so sieht er sich spätestens im Wettkampf mit seinen Grenzen der momentanen Leistungsfähigkeit, gemessen am Gegner, konfrontiert. Diese Erfahrung zieht automatisch den Wunsch von besseren Leistungen nach sich, um den Druck von Medien und Funktionären Stand zu halten. Er gerät aufgrund der zunehmenden Leistungsdichte in eine fatale Abhängigkeit, die er nur durch mehr Leistung und dem Erfüllen von dem, was von ihm erwartet wird, kompensieren kann.
Der Wettbewerb zielt also im Detail darauf ab, durch Höchstleistungen, nicht nur zu Ruhm zu gelangen, einem Wunsch der in unserer heutigen Gesellschaft, in der jeder nur noch ein Teil des Ganzen ist, menschlich erscheint, um sich identifizieren zu können, um „Jemand zu sein“, sondern setzt auch den bedingungslosen Einsatz des Athleten voraus. Diese radikale, durch nationales Prestige oder sonstige kommerziellen Interessen forcierte Entwicklung, als Athlet immer alles zu geben und nicht versagen zu dürfen, wirft automatisch die Frage nach dem „wie“ auf. Ohne Chemie läuft in dem Geschäft gar nichts.
[18]
Somit mag es nicht überraschend erscheinen, dass viele Sportler bereit sind, ihre Gesundheit oder sogar ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um Rekorde und Siege zu erzielen, die aus rein physiologischer und biologischer Sicht nahezu unmöglich erscheinen, die aber durch die Einnahme von bestimmten leistungsfördernden Substanzen möglich gemacht werden können.
5. Ausdauerspezifische Dopingsubstanzen und ihre Wirkungsmechanismen
5.1 Anabolika
5.1.1 Anabole Steroide
Grundsätzliche ist die Einnahme von anabolen Steroiden auf zwei Arten möglich. Zum einem durch eine orale Applikation[19]. Hierbei tritt das Problem auf, dass diese Verbindungen einem sehr hohen First-Pass-Effekt[20] in der Leber unterliegen. So bleibt die 100fache Tagesdosis von Testosteron auf einmal verabreicht nahezu ohne Einfluss auf den Plasmaspiegel (Gluud)[21]. Die gängigere Form der Einnahme ist allerdings die intramuskuläre Injektion eines Steroid-Depotpräperates. Während Kraftsportler schon seit fast 40 Jahren mit Anabolika ihre Leistung verbessern, ist es im Ausdauersport erst seid ungefähr 15 Jahren bekannt. Hierbei verbessern die Steroide die Regeneration nach einer Belastung. Unterschiedlich ist allerdings die Dosierung, die bei Kraftsportlern um das vier- bis zehnfache größer ist. Mittlerweile gibt es unzählige Präparate auf dem Markt, bzw. auf dem Schwarzmarkt. Oft treibt der Ehrgeiz manche Sportler so weit, dass sie zu billigen anabolen Rindermastmitteln greifen.
Der Einsatz von Anabolika in der Medizin wurde in der Vergangenheit wesentlich weiter gefasst als dies heut der Fall ist. So wurden früher bei schwerkonsumierenden Krankheiten wie Krebs, Osteoporose, bei Leber- und Nierenerkrankungen, bei Muskeldystrophie[22] und einigen anderen Erkrankungen relativ unspezifisch Anabolika zum „Wiederaufbau“ eingesetzt. Im Sport allerdings sind anabole Steroide weit verbreitet und garantieren somit auch weiterhin den Profit der großen Pharmaunternehmen.
Anabolika besitzen zum großen Teil sehr schwerwiegende Nebenwirkungen:
- Bei Frauen kann es durch Anabolikaeinsatz zu Virilvisierungserscheinungen[23] kommen. Darunter versteht man das Auftreten von männlichen Gesichtszügen, Bartwuchs und Veränderungen in der Stimme. Durch die Unterdrückung des Hypophysen-Gonaden-Regelkreises wird die Produktion von FSH[24] und LH[25] gehemmt, was wiederum das Ausbleiben der Monatsblutung bedeuten kann.
- An der Leber wirken Anabolika/Androgene toxisch. Es kann zum Auftreten eines Leberadenoms[26], einer Cholestase[27], einer Peliosis hepatis[28] sowie im schlimmsten Fall zu einem Leberzellkarzinom[29] kommen.
- Durch den Anstieg des LDL-[30] bei gleichzeitiger Senkung des HDL-Cholesterinspiegels[31] wird die Entstehung von Arteriosklerose begünstigt.
- Auf die Herzmuskelzelle wirken Anabolika zum einem direkt toxisch, zum anderen kann die induzierte Muskelhypertrophie ein relatives O2-Defizit zur Folge haben. Das Herz wird in Folge anfälliger auf Entzündungen oder Infarkt.
- Nach Absetzen des Anabolikums kann es zu einer Hodenatrophie kommen. Unter Anabolikaeinfluss kommt es zu einer Reduktion der Spermatogenese[32] mit Veränderungen des Ejakulats. Die Infertilität des Mannes kann zum einem durch die erhöhte Viskosität der Samenflüssigkeit und zum anderem durch die verminderte Spermienzahl hervorgerufen werden.
- Durch die vermehrte Talgproduktion kann es zum Auftreten von Akneerscheinungen kommen. Ebenso kann ein genetisch bedingter Haarausfall gefördert werden.
- Ein erhöhter Testosteronspiegel verändert die Psyche insofern, dass das Wohlbefinden gesteigert wird, ebenso wie das Selbstvertrauen und die Aggressionsbereitschaft. Nach dem Absetzen der Präparate gehen diese Werte wieder in die Ausgangssituation zurück. Daher kann es durchaus auch zu einer psychischen Abhängigkeit kommen.
5.1.1.1 Testosteron
Da das reine Testosteron von der Leber gleich nach der Magen-Darm-Passage zum größten Teil eliminiert wird, verabreicht man dieses an einen Rest[33] gebunden. Diese Form ist besonders wegen der kurzen Nachweisbarkeit und dem schnellen Wirkungseintritt stark verbreitet. Bereits 1-2 Tage nach der Injektion merkt der Sportler eine gesteigerte Motivation und die erhöhte Bereitschaft, längere und härtere Trainingseinheiten zu absolvieren. Zusätzlich wird allerdings auch noch die Regenerationszeit verkürzt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5.1.1.2 Nandrolon
Auch Nandrolon wird an einem Rest gebunden verabreicht. Das unter dem Handelsnamen Deca Durabolin ® der Firma Organon bekannt gewordene Präparat enthält den Wirkstoff Nandrolondecanoat und ist schon seit gut 30 Jahren unter Sportlern bekannt. „Deca“, wie es im Fachjargon genannt wird, ist besonders wegen der starken anabolen und regenerationsfördernenden Wirkung bekannt geworden. „Deca“ ist das meistbenutzte und weitestverbreitete injizierbare Steroid. Nach der Injektion kommt es zu einer vermehrten Wassereinlagerung, man spricht auch von einem „verwässerten Aussehen“. Davon profitieren vor allem Sportler mit Gelenkproblemen, da die Wassereinlagerung das Gelenk schont und vor Verletzungen schützt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Nachweisbarkeit ist dagegen recht lange gegeben.
5.1.1.3 Stanzolol
Stanzolol rangiert hinter Nandrolon und Testosteron an der dritten Stelle der bei Dopingtests nachgewiesenen Steroide. Obwohl die anabole Wirksamkeit weit hinter der, des Testosterons zurückliegt, ist es bei Sportlern sehr beliebt. Aufgrund der für Anabolika typischen Kraftsteigerung und beschleunigten Leistungsentwicklung durch eine erhöhte Thermogenese[34], kommt es zu einem verstärkten Fettabbau. Somit können die Sportler ihren Fettanteil verringern, was zum einem zu einem austrainierten Äußeren führen kann und zum anderen in einigen Sportarten von Vorteil sein kann. Besonders bekannt wurde das Stanzolol durch den Dopingfall Ben Johnson bei der Olympiade 1988 in Seoul.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5.1.1.4 Halotestin
Halotestin kommt vor allem in Sportarten zum Einsatz, in denen ein Kraftzuwachs ohne wesentliche Gewichtszunahme erwünscht ist. Die stark ausgeprägte psychotrope Komponente ermöglicht ein oft sehr intensives Training sowie das Bestehen in harten Wettkampfsituationen. Durch eine vermehrte Glykogeneinlagerung im Muskel, steigt parallel dazu der intramuskulärer Druck, der durch die damit verbundene Wassereinlagerung entsteht. Folge daraus, kann eine O2-Mangelversorgung kommen. Außerdem ist Halotestin stark lebertoxisch und es kann in folge dessen zum Anstieg der Leberwerte kommen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5.1.1.5 Vebenolol
Dieses Präparat ist in der Kraftsportszene schon länger wegen seiner anabolen Wirkung bekannt. Aber erst in jüngster Vergangenheit wurde festgestellt, dass dieses Präparat auch einen positiven Effekt auf die Blutbildung hat, was vor allem nützlich für den Ausdauersport ist. Verglichen mit EPO (Erythropoetin)[35] ist die Wirkung allerdings gering. Im Gegensatz zu den anderen Anabolika ist diese Wirkung allerdings als groß einzustufen.
5.1.1.6 Wirkung der anabolen Steroide auf die sportliche Ausdauer-Leistungsfähigkeit
Dass anabole Steroide sich positiv auf die Ausdauerleistung auswirken gilt mittlerweile als gesichert. Erst lange nachdem man diese Substanzen im Kraftsport nahezu „routinemäßig“ zum Einsatz brachte, erkannte man deren Wirkung auch für die Ausdauersportarten. Der Hauptgrund dafür, liegt an der Einflussnahme auf den Proteinstoffwechsel. Bei andauernden intensiven Belastungen muss der menschliche Organismus auf Proteine zur Energiegewinnung zurückgreifen. Obwohl der Anteil der Kalorienbereitstellung durch die Proteine nur 10% beträgt, so hat der Verlust der Proteine einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der Leistungsfähigkeit. Arbeitsmuskulatur geht verloren und muss in der Regenerationsphase wiederhergestellt werden. Dieser Vorgang wird durch Anabolika extrem beschleunigt. Dabei muss gesagt werden dass die Konzentrationen bei Ausdauersportlern um einiges geringer sind als bei den Kraftsportlern, da die Ausdauersportler ja lediglich die Wiederherstellung des verlorenen Eiweißes im Sinn haben, nicht jedoch einen Muskelzuwachs.
5.1.2 Prohormone
Prohormone sind Substanzen, die im Körper teilweise zu anabolen Steroiden umgewandelt werden.
Im Vergleich zu den anabolen Steroiden, sind die Prohormone in der Wirksamkeit deutlich ineffektiver. Sowohl in der Wirkung als auch in den Nebenwirkungen haben Prohormone ein deutlich schwächeres Potential. Durch die Metabolisierung[36] der körpereigenen Enzyme werden diese zu Testosteron, beziehungsweise zu Nandrolon metabolisiert (z.B.: Norandrostendion als eine wirkungslose Vorstufe des Nandrolons). Die somit synthetisierten anabolen Steroide sollen die eigentlichen Wirkungen, wie zum Beispiel den Eiweißaufbau herbeiführen. Sehr fraglich ist allerdings ob Prohormone überhaupt einen Konzentrationsanstieg dieser Substanzen bewirken können.
Prinzipiell können Prohormone durch ihre Synthetisierung die gleichen Nebenwirkungen hervorrufen wie anabole Steroide[37]. Was jedoch nicht zu vernachlässigen ist, ist die Tatsache dass durch die Verabreichung von Prohormonen, es zu einem Anstieg der Östrogenkonzentration kommen kann. Dies kann zu einer Brustdrüsenbildung beim Mann sowie zu einer vermehrten Wassereinlagerung führen, was mit einem Gewichtszuwachs verbunden ist.
5.1.2.1 Dehydroepiandrosteron (DHEA)
Bis jetzt gibt es keine eindeutigen Beweise, dass diese Substanz die Leistung steigern könnte. Trotzdem wäre es durchaus denkbar, dass vor allem ältere Athleten durch DHEA einem vorzeitigen Leistungsabbau entgegenhalten könnten.
5.1.2.2 Androstendion
Androstendion kann zu Testosteron synthetisiert werden. Die metabolische Reserve dieses Enzyms ist aber begrenzt, so dass ab einer bestimmten Konzentration eine zusätzliche Zugabe nutzlos wird. Die Einnahme kann zu einer beschleunigten Regeneration und einer erhöhten Trainingsmotivation führen.
5.1.2.3 Androstrendiol
Diese Substanz wirkt genauso wie das Androstendion[38]. Angeblich soll der durch das Androstendiol hervorgerufene Testosteronspiegelanstieg beständiger und soll eine längere Halbwertszeit besitzen. So eignet sich Androstendiol in harten Trainingsphasen, während sich Androstendion bei kurzen, aber intensiven Trainingseinheiten eignet, bzw. kurz vor einem Wettkampf eingenommen wird. Weiterhin bindet Androstendiol den Östrogenrezeptor, dadurch kommt es zu einer verminderten Fettspeicherung und Wassereinlagerung.
5.1.2.4 Norandrostendion
Im Gegenteil zu DHEA, Androstendion und Androstendion wird diese Substanz, ebenso wie Norandrostendiol, durch die Leberenzyme nicht nach Testosteron, sondern zu Nandrolon umgewandelt. Die Wirkungen, die man dem Nandrolon zuschreibt, wie Eiweißaufbau, verkürzte Regenerationszeit und Wassereinlagerungen sollen auch bei Nondrostendion in stark abgeschwächter Form auftreten.
5.1.2.5 Norandrostendiol
Diese Substanz ist dem Norandrostendion sehr ähnlich. Die Wirkung ist entsprechend dem Norandrostendion[39].
5.1.2.6 Wirkung der Prohormone auf die sportliche Ausdauer-Leistungsfähigkeit
Schon bereits 1981 wurden Untersuchungen über die Wirksamkeit der Prohormone angestellt. Diese von der DDR damals ins Leben gerufene Studie ergab, dass Prohormone eine kurzzeitige Anhebung des Testosteronspiegels ermöglichen. Dadurch kann es zu einer gesteigerten Leistungsfähigkeit kommen. Mann überlegte damals die Substanzen kurz vor dem Wettkampf einzunehmen, da diese zu der damaligen Zeit noch nicht nachweisbar waren. Die Wirkungen der Prohormone sind nach wie vor umstritten. Prohormone sind zudem sehr leicht erhältlich und relativ kostengünstig. Man kann sie daher als „Einstiegsdroge“ bezeichnen. Doch das Aufscheinen auf der internationalen Dopingliste stellt zumindest die Möglichkeit einer Leistungssteigerung durch diese Substanzen da.
5.1.3 Beta-2-Mimetika
Beta-2-Mimetika finden sich gleich zweimal in der Dopingliste wieder. Zum einem als Stimulans, zum anderen als Anabolikum. In diesem Abschnitt wird die anabole Wirkung beleuchtet.
Diese Substanzen, wie zum Beispiel Clenbuterol, Fenoterol, Salbutamol, etc., wurden speziell für Asthmatiker entwickelt. Durch die Bindung an die Beta-2-Rezeptoren des sympathischen Nervensystems kommt es im Bereich der Bronchien zu einer Erschlaffung der Bronchialmuskulatur. Ein Asthmaanfall kann so beendet oder verhindert werden. Die Einnahme erfolgt meistens oral, durch die Einnahme von Tabletten oder als Spray in Form eines Dosieraerosols.
Es wird spekuliert, dass Beta-2-Mimetika in der Lage sind, Kortisonrezeptoren zu blockieren, um auf diesem Weg einen Proteinabbau zu verhindern. Durch einen verminderten Proteinabbau ist die Regenerationszeit wesentlich geringer.
Durch die Einnahme von Beta-2-Mimetika kann es zu einigen Nebenwirkungen kommen: Muskelkrämpfe, Myalgie, Nervosität, Ruhelosigkeit, Übelkeit, Schwindelgefühl, etc. Bei einer Überdosierung kann es von Blutdruckschwankungen bis zu einer Veränderung des Blutdruckes kommen.
5.1.3.1 Wirkungen der Beta-2-Mimetika auf die sportliche Ausdauer-Leistungsfähigkeit
Im Ausdauersport wird Clenbuterol vorwiegend in der wettkampffreien Zeit genommen, um das Körpergewicht nicht in die Höhe steigen zu lassen und um eine bessere Adaption an das Grundlagentraining zu erreichen. Besonders in der Übergangszeit zwischen Grundlagentraining zum wettkampfspezifischen Training, kann der Sportler von der Wirkung des Clenbuterols profitieren. Die erforderliche Regenerationszeit wird verkürzt und der Sportler spricht auf das begleitende Krafttraining besser an. Von mäßiger Bedeutung sind die Substanzen auf Grund der zum Teil akuten Nebenwirkungen (Unruhe, Tremor[40]). Clenbuterol werden vor allem in der Leichtathletik eingesetzt. Besonders erschütternd war der Doping-Fall der Grit Breuer. Im Januar 1992 wurde sie zusammen mit Katrin Krabbe und Silke Möller suspendiert, nachdem die Manipulation von Urinproben und einige Monate später die Einnahme von Clenbuterol nachgewiesen werden konnte.[41]
5.2 Peptidhormone
Die Peptidhormone gehören zu der pharmakologischen Substanzklasse, die auf der Dopingliste des IOC steht. Es werden hier die Hypophysenhormone: LH, ACTH[42], STH[43] mit Hormonen aus anderen Organen (z.B.: EPO aus der Niere) auf Grund von chemischen Gemeinsamkeiten zusammengefasst. Alle diese Substanzen bestehen aus einer Aminokette von unterschiedlicher Länge. Einige von ihnen haben auch einen Kohlenhydratanteil und sind daher als Glykoproteine zu bezeichnen. Die Wirkungen sind meist nur von kurzer Dauer und die Halbwertszeit der Hormone beträgt nur Minuten bis Stunden.
Die prinzipielle Wirkung der Hormone besteht darin, den Stoffwechsel dieser Zellen auf drei Wegen regulierend zu beeinflussen:
- Konfigurationsänderungen an den Enzymen (sog. allosterische Mechanismen);
- Hemmung oder Förderung der Enzymsynthese (Induktion)
- Änderung der Substratbereitstellung für die enzymatischen Reaktionen, zum Beispiel durch Änderung der Durchlässigkeit der Zellmembran.
Sportliches Training ist zwangsläufig immer mit einer vorübergehenden Veränderung der Stoffwechselvorgänge verbunden. Die Hypophyse[44] nimmt hier eine zentrale Stellung ein. Sie steuert maßgeblich den Proteinaufbau bzw. Abbau und somit auch den Kraftaufbau und die Regeneration. Daher ist es eher nicht verwunderlich das die Hypophysenhormone zur illegalen Leistungssteigerung missbraucht werden.
5.2.1 Testosteronliberatoren
Unter den Testosteronliberatoren versteht man Peptidhormone, die zu einer Anhebung der Testosteronproduktion führen. Substanzen aus dieser Gruppe sind zum Beispiel das hCG[45], sowie das LH[46].
Seit 1989 befinden sich die Testosteronliberatoren auf der Liste der verbotenen Substanzen des IOC. Diese Substanzen bilden allerdings eine Besonderheit, da diese Substanzen nur für Männer verboten sind. Bei Frauen führen diese Substanzen nicht zu einer Leistungssteigerung. Beim Mann beeinflussen sie als übergeordnete Steuerungshormone die Testosteronproduktion, was bekanntlich eine Proteinsynthese fördert.
Die Regulation der Hormonsekretion erfolgt über das Hypothalamus[47] -Hypophysen-System und unterliegt einem selbstregulierenden Feedback-Mechanismus. Unter einen Feedback-Mechanismus versteht man die Regelung der Ausschüttung der Hormone durch das Feedback des Empfängers. Durch eine vermehrte Ausschüttung an Hormonen aus dem Hypothalamus-Hypophysen-System kommt es zu einer vermehrten Bildung von Testosteron. Dies kann zu einer Leistungssteigerung führen.
5.2.1.1 Wirkung der Testosteronliberatoren auf die sportliche Ausdauer-Leistungsfähigkeit
Auch im Ausdauersport wird mit hCG gedopt, wenngleich die Bedeutung dieser Verbindung für den Ausdauersportler nicht ganz den Stellenwert wie für die Kraftsportler erreicht. Der jüngste Fall ist der deutsche Profiradfahrer Dirk Müller. Er wurde während der Regio-Tour im August 2000 in der A- und B-Probe positiv auf hCG getestet. hCG besitzt im Wesentlichen zwei förderliche Wirkungsmechanismen für den Ausdauersportler:
- Die Verabreichung führt kurz darauf zu einem signifikant erhöhten Testosteronanstieg. Daraus resultiert, dass die Bereitschaft, sich zu überwinden verbessert wird und die „Wettkampfhärte“ steigt.
- Der zweite Testosteronkonzentrationsgipfel wird ca. 2-4 Tage später erreicht. Dies führt zur Testosteron-typischen Steigerung der Regenerationsfähigkeit.
5.2.2 Wachstumshormone
Die Wachstumshormone regulieren verschiedene essentielle Stoffwechselvorgänge im Körper. Sie sind zuständig für das Wachstum, die Entwicklung, den Proteinstoffwechsel, den Kohlenhydratstoffwechsel, reparative Prozesse und wahrscheinlich auch für das altern. Unter die Substanzen der Wachstumshormone fallen zum Beispiel das GHRH[48], das GH[49], sowie das IGF-1[50]. Ein STH-Mangel in der Wachstumsphase kann zu einem Zwergwuchs führen, eine Überproduktion hingegen zu einem Gigantismus. Die Komponenten des komplexen Wachstumshormon-Regelkreises bestehen aus drei unterschiedlichen Kategorien: Hormone, Rezeptoren und Bindungsproteine.
Die hormonellen Bestandteile der Wachstumshormon-Achse sind der hyphothalamische Freisetzungsfaktor GHRH, der hyphothalamische Hemmfaktor GFHIH[51], das eigentliche Wachstumshormon GH (bzw. STH) und der IGF-1 aus der Leber. Die beiden hypothamalischen Hormone vermitteln die Signale des ZNS (Zentralnervensystems: Gehirn + Rückenmark) und regeln die Freisetzung des eigentlichen Wachstumshormons GH. GHRH regt bestimmte Zellen (sog. somatotrope Zellen) zur Hormonfreisetzung und zur Hormonneubildung an. Somatostatin (GFHIH) hingegen hemmt die Sekretion des GH. Die Zielzellen des GH sind in nahezu allen Geweben vorhanden.
Die Rezeptoren der Wachstumshormone unterscheiden sich sehr stark voneinander. Die Signale der hypothalamischen Hormone werden an Protein-gekoppelte Rezeptoren vermittelt. Der GH-Rezeptor erzielt seine Wirkung durch Phosphoryliesierung von Proteinen. Der IGF-1-Rezeptor besitzt sehr starke Ähnlichkeiten mit dem Insulin-Rezeptor, besitzt allerdings eine geringere Affinität[52].
Bindungsproteine existieren nur für GH und IGF-1. Dieser Umstand lässt sich durch den sehr kurzen Weg über den Kreislauf der Hypophyse zurückführen.
Die Wirkungen der Wachstumshormone sind sehr vielfältig. Dies ist durch ihre Interaktion in den verschiedensten Geweben bedingt. Vor allem was die sportliche Leistungsfähigkeit betrifft, gehen die Meinungen über die Wirkungen der Wachstumshormone weit auseinander.
Der Eiweißstoffwechsel wird durch das GH positiv beeinflusst, was zu einer anabolen Wirkung, durch Einlagerung von Aminosäuren führen kann. Weiterhin wird die Lipolyse stark angekurbelt. Dass bedeutet wiederum, das der Körper zur Energiegewinnung hauptsächlich Fett abbaut. Durch den fettfreien Körper wird der vorhin erwähnte anabole Effekt noch stärker.
5.2.2.1 Wirkung der Wachstumshormone auf die sportliche Ausdauer-Leistungsfähigkeit
Es ist sehr schwierig, den genauen Einfluss der Wachstumshormone auf die Ausdauer zu bestimmen. Grund dafür ist, dass es kaum Untersuchungen mit Sportlern zu diesem Thema gibt.
Trotzdem sind Wachstumshormone im Ausdauersport stark verbreitet. Vor allem im Radsport sind diese Substanzen sehr beliebt. Da diese Sportler ihr Gewicht „den Berg hinauf“ tragen müssen, ist es Ziel jedes Radsportlers, einen möglichst geringen Körperfettanteil zu besitzen. Zudem muss jedes Gramm des Körpers mit Sauerstoff versorgt werden. Dies ist ein weiter Grund weshalb Radsportler meist kein Gramm zuviel wiegen dürfen. In diesem Zusammenhang stellt das GH und das IGF-1 eine praktische Lösung da. Die gesteigerte Lipolyse lässt die überschüssigen Kilos verschwinden und der anabole Effekt wirkt sich positiv auf die Regenerationsphase aus. Aber vor allem die fehlende Nachweisbarkeit macht die Wachstumshormone zu einem festen Bestandteil in den Dopingpraktiken der Ausdauersportler. Dies zeigt auch folgender Fall: Der 200-m-Lagen-Schwimmer, Massimiliano Rosolino, siegte bei der Olympiade in Sydney 2000 und stellte neben einer persönlichen Bestzeit auch den traurigen „Rekord“ bei den gemessenen Wachstumshormonspiegeln auf: 17,1 ng/ml. Der Normalwert bei Männern liegt bei etwa 0,6 ng/ml. Seine Goldmedaille durfte er allerdings behalten, da bisher kein Nachweisverfahren rechtsgültig ist[53].
5.2.3 Erythropoetin (EPO)
Erythropoetin wird beim erwachsenen Menschen zu 90% in der Niere und zu 10% in der Leber gebildet. Dieses Hormon hat die Aufgabe, die Bildung von Erythrozyten zu stimulieren. Die Bildung roter Blutkörperchen gewährleistet die Sauerstoffversorgung in den Geweben. Dieses Hormon ist dementsprechend zentraler Bestandteil eines Regelkreises, dessen Aufgabe die lebensnotwendige O2-Versorgung des Körpers ist.
Der Regelkreis der Erythropoetin-Sekretion[54] ist sehr komplex und bis heute noch nicht vollständig aufgeklärt. Zusammenfassend steht die Erkenntnis im Vordergrund, dass niedriger O2-Partialdruck viele Zellen zur EPO-Produktion anregt und hoher O2-Partialdruck wenige Zellen zur Produktion anregt. Der durch EPO erzielte Anstieg der roten Blutkörperchen verbessert mit einiger Verzögerung die Sauerstoffversorgung durch erhöhte Transportkapazität, sodass die EPO-Produktion wieder abnimmt und sich so der Regelkreis schließt.
Erythropoetin gelangt über den Blutkreislauf zu den Zielzellen im Knochenmark und in der Milz, den erythropoetischen „Vorläuferzellen“. Dort ist es maßgeblich für die Bildung der roten Blutkörperchen verantwortlich.
Nebenwirkungen sind zum Beispiel die erhöhte Viskosität des Blutes durch den Anstieg der roten Blutkörperchen, was wiederum zu einer erhöhten Gefahr der Thrombosebildung führen kann. In den kleinen und engen Blutgefäßen kann es zum sog. „Sludge-Phänomen“ kommen, was nichts anderes als eine Verklumpung der Blutsäule bedeutet. Durch diese Gerinnung sind die nachfolgenden Abschnitte minderversorgt und können einen Schaden erleiden.
Der Nachweis einer illegalen Leistungssteigerung durch EPO ist aus zwei Gründen sehr problematisch:
- Die Substanz hat mit 6-10 Stunden eine kurze Halbwertszeit und ist zur Zeit des gewünschten Wirkungseintritts schon längst aus dem Körper ausgeschieden.
- Das gentechnologisch hergestellte und das natürliche Hormon unterscheiden sich nur sehr geringfügig.
5.2.3.1 Wirkung des Erythropoetin auf die sportliche Ausdauer-Leistungsfähigkeit
Wenn Du EPO nimmst, ist es, als ob Du plötzlich noch einen Gang mehr hast
(vgl. Internetquelle 1).
Der Einfluss von EPO auf die Ausdauerleistungsfähigkeit ist enorm. Die Fähigkeit des Herz-Kreislaufsystems, Sauerstoff zum arbeitenden Muskel zu transportieren, also der zentrale Teil, wurde als leistungsbestimmender Faktor identifiziert. Außerdem konnte nachgewiesen werden, dass die physiologischen Adaptionen des Ausdauertrainings mehr auf den erhöhten kardinalen Output als auf die erhöhte ateriovenöse Sauerstoffdifferenz zurückzuführen sind. Wäre das periphere System, als die Arbeitsmuskulatur der alleinige leistungsbestimmende Faktor, so könnte man dem EPO nur einen viel geringern Leistungszuwachs zuschreiben. Ein Beispiel für die starke Verbreitung des Erythropoetins ist zum Beispiel der Doping-Skandal rund um die Festina-Mannschaft während der Tour de France. Ein Helfer der Festina-Mannschaft wurde an der belgisch-französischen Grenze kontrolliert. Die Zollbeamten fanden bei dem Mann, der in einem Festina-Mannschaftsfahrzeug auf dem Weg nach Dublin war, über 400 Ampullen und Flaschen mit EPO und anderen Doping-Substanzen. Festina-Radprofi Laurent Dufaux sagt aus, dass er bereits seit drei Jahren das Blutdopingmittel EPO genommen habe
... Das ist in unserem Geschäft üblich
(vgl. Interquelle 2).
Der Umstand, dass bislang noch kein Nachweisverfahren zulässig ist, hat EPO trotz der hohen Kosten zum Dopingmittel mit der größten sportpraktischen Bedeutung im Ausdauersport gemacht.
5.3 Glukokortikoide
Der wohl bekannteste Vertreter dieser Gruppe ist das Cortison. Deshalb wird es teilweise auch als Synonym für die gesamte Substanzgruppe verwendet.
Glukokortikoide zählen im Ausdauersport zu den am meisten verwendeten Substanzen. Vor allem kurz vor dem Wettkampf werden diese Substanzen eingenommen. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Zum einem wird die subjektive Schmerzempfindung vermindert, was dadurch zu der Fähigkeit führt, seine letzten Reserven zu mobilisieren. Zum anderen wird der Stoffwechsel durch vermehrte Glykolyse, Lipolyse und Proteolyse[55] „angekurbelt“, dass heißt dass mehr Energie für die Muskelkontraktion zur Verfügung gestellt wird. Teilweise werden diese Substanzen auch in der Regenerationsphase eingesetzt, um reperative Vorgänge zu beschleunigen.
Bei längerfristiger Einnahme kann es zu einem Muskelabbau und zu einem Leistungstief kommen.
Gebildet werden die Kortikoide in der Nebennierenrinde. Chemisch gesehen gehören sie eigentlich zu der Gruppe der Steroide. Die Ausgangssubstanz für die Kortikoide ist das Cholesterin. Bei der Synthetisierung des Cholesterins entstehen dann die Glukokortikoide.
Die Einnahme von Glukokortikoide hat folgende Einflüsse auf den Körper:
Cortisonpräparate haben unter anderem eine starke Wirkung auf den Kohlenhydratstoffwechsel, indem sie verstärkt Blutzucker freisetzen, der dann für die Verbrennung und Energiegewinnung neben der arbeitenden Muskelquelle herangezogen werden kann. Sie werden bei extremen Dauerbelastungen (z.B. Radrennsport) verabreicht und stimulieren das zentrale Nervensystem. Störungen des Gleichgewichtsempfindens, Störungen der Hormonregulation, Auftreten von Magengeschwüren und psychische Störungen müssen unter Umständen dabei in Kauf genommen werden.
5.3.1 Wirkung der Glukokortikoide auf die sportliche Ausdauer-Leistungsfähigkeit
Glukokortikoide sind in Ausdauersportarten sehr weit verbreitet. Es wird angenommen, dass die weitgehende Verbreitung an der verminderten subjektiven Belastungsempfindung begründet werden kann. Die maximale Leistung an sich wird gar nicht bzw. nur sehr geringfügig beeinflusst. Des Weiteren gilt es als bewiesen dass die Glukokortikoide die Regeneration positiv beeinflussen können. Wie bereits oben erwähnt, kann es zu einem „psychotropen“ Effekt (Herabinken der Reizschwelle)kommen, der gewisse Vorteile bringen kann. Weiterhin senken diese Substanzen den Muskeltonus, was zu einer verbesserten Zirkulation des Blutes führt. Dem oft beschriebenen Gefühl von „schweren Beinen“ kann damit abgeholfen werden.
Am häufigsten treten diese Dopingfälle im Radsport auf. So zum Beispiel auch bei dem ehemaligen Deutschen Profifahrer Jörg Paffrath. Dieser gab gegenüber dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ zu, alles genommen zu haben was auf dem Markt vorhanden war. Unter anderem auch Glukokortikoide (vgl. Internetquelle 3).
5.4 Stimulantien
Als Stimulanzien werden Stoffe mit vorwiegend erregender Wirkung auf die Psyche zusammengefasst. Diese können den Antrieb und Denkleistungen steigern, sowie Müdigkeit verringern. Im Spitzensport werden diese Substanzen von den verschiedensten Sportlern zur illegalen Leistungssteigerung missbraucht. Durch die Stimulierung des ZNS, wird die Mobilisierung der körperlichen Leistungsreserven möglich, die unter normalen Umständen nicht abrufbar sind. Das kann zu einer gefährlichen Überbelastung und zu schwerwiegenden Gesundheitsschäden führen. Stimulantien können in mehrere Untergruppen aufgeteilt werden. Zum Teil bewirken diese Untergruppen dieselben Effekte, diese werden allerdings auf unterschiedliche Art und Weise erreicht. Zu einer Aktivierung des sympathischen Anteils des vegetativen Nervensystems führen die sog. Sympathomimetika (Amphetamine, Beta-2-Mimetika).
Dies geschieht indem sich diese Substanzen direkt an den sympathischen Rezeptor binden oder die Menge der freigesetzten Transmitter verändern.
Kokain hingegen hindert die Wiederaufnahme der Transmitter aus dem synaptischen Spalt.
Methylxanthine wirken hingegen völlig anders. Sie führen zu einer Blockade der Rezeptoren. Das heißt, dass die Rezeptoren keine Transmitter mehr aus dem synaptischen Spalt aufnehmen können. Es kommt nicht zu einer Reaktionsübertragung.
5.4.1 Sympathomimetika
Man unterscheidet zwischen den indirekten und den direkten Sympathomimetika. Zu den Indirekten, zählen die Amphetamine und die Ephedrine. Zu den Direkten, zählen Beta-2-Mimetika[56]
Indirekte Sympathomimetika:
Die indirekten Sympathomimetika erhöhen die Menge der Transmitterstoffe im synaptischen Spalt, ohne sich direkt an den Rezeptor zu binden. Diese Substanzen werden dann in die Axone[57] aufgenommen und führen dort durch die Freisetzung von Noradrenalin und Dopamin zu einer indirekten Stimulierung des Sympathikus. Diese Reaktion war für unsere Vorfahren von lebensnotwendiger Bedeutsamkeit. Der Sympathikus hat die Aufgabe, den Organismus rasch in einen Zustand zu versetzen, der eine hohe Leistungsbereitschaft garantiert[58]. Indirekt wirkende Sympathomimetika werden wegen ihrer Wirkung auf das ZNS auch Psychostimulantien oder Weckamine genannt. Diese wurden wie bereits erwähnt schon im 2.Weltkrieg eingesetzt[59]. Die Weckamine haben nämlich flogende Wirkungen:
Das Müdigkeitsgefühl lässt nach, Aufmerksamkeit und Leistungsbereitschaft steigen, die Atmung wird angeregt, die Motorik verstärkt, der Appetit gehemmt, ebenso entsteht eine euphorische Stimmung.
Direkte Sympathomimetika:
Zu den direkten Sympathomimetika zählt man die Substanzen, die sich direkt an den Rezeptor binden[60]. Als Dopingmittel kommen aus dieser Gruppe vor allem die Beta-2-Mimetika in Frage. Wegen ihrer brochodilatorischen[61] Wirkkomponente werden sie auch als Antiasthmatikum eingesetzt.
Die Nebenwirkungen der Sympathomimetika sind: Unruhe, Nervosität, Schlafstörungen, Tremor, Psychosen, Gewichtsverlust, sowie Verdauungsstörungen. Eine weitere Nebenwirkung ist, dass man ein geringes Suchtpotential bei diesen Substanzen festgestellt hat.
5.4.1.1 Wirkung der Sympathomimetika auf die sportliche Ausdauer-Leistungsfähigkeit
Im Sport kann der Einsatz dieser Mittel zu einer Überlastung führen. Diese kann so gar lebensgefährliche Konsequenzen nach sich ziehen. Deshalb werden diese Substanzen meist nur bei „besonderen Anlässen“, wie zum Beispiel Wettkämpfe oder Trainingslager eingesetzt.
Es wird angenommen, dass diese Substanzen zwar die Müdigkeit unterdrücken, sonst jedoch keinen besonderen Einfluss auf die Leistung haben. Vergleichbar, wäre dies zum Beispiel mit einem Auto, dem der Drehzahlmesser ausgebaut wurde. Dadurch bleibt allerdings auch die Motorleistung gleich und verbessert sich nicht.
Positive Dopingfälle finden man in allen Sportarten, aber vor allem bei Radsportlern, Triathleten und Kampfsportlern. Diese vermehrten Funde, sind durch die starken Beanspruchungen, die diese Sportarten mit sich bringen, zu erklären. Ein weiterer Grund der Einnahme von Stimulantien, ist der begleitende Gewichtsverlust, durch die Hemmung des Hungergefühls. Dies ist besonders bei Radsportlern beliebt, da diese ihr Gewicht den „Berg Hochtragen“ müssen und jedes Gramm zuviel einen Nachteil ergibt.
5.4.2 Methylxanthine
Das bekannteste der Methylxanthine ist wohl das Koffein. Weitere Substanzen sind zum Beispiel das Theophyllin und das Theobromin. Die Methylxanthine sind aus zweierlei Sicht von Bedeutung. Zum einem als Psychostimulantien und als Bronchodilatoren. Die Verwendung dieser Substanzen hat eine große Akzeptanz in unserer Gesellschaft. Kaffe, Tee und auch in geringen Mengen im Kakao sind Methylxanthine vorhanden. Die Verwendung dieser Substanzen steht in einer sehr langen Tradition. Theophyllin wird wegen der dilatorischen Wirkung auf die Bronchien als Teil der Asthmatherapie verwendet.
Die Auswirkungen der Methylxanthine werden in verschiedenen Organen deutlich. Im ZNS wird durch Blockaden von Rezeptoren eine Psychostimulation bewirkt. Die Aufmerksamkeit und die Lernbereitschaft nehmen zu. Weiterhin wird die Atmung angeregt und die Motorik wird verstärkt. Am Herzen kommt es zu einer positiven inotropen Wirkung[62]. Bei Überdosierungen kann es zu Unruhe, Angst, Übelkeit oder Erbrechen führen.
5.4.2.1 Wirkung der Methylxanthine auf die sportliche Ausdauer-Leistungsfähigkeit
Koffein hat nachgewiesenermaßen auf Ausdauerleistungen eine positive Wirkung. Auf kurze, sehr intensive Belastungen hingegen scheint es nur sehr geringe bis gar keine Wirkung zu haben. Koffein kurbelt die Fettsäure-Oxidation an und schont somit die Glykogenreserven des Athleten. Diese Reserven sind, besonders bei sehr lang amdauernden Belastungen, ein leistungsbestimmender Faktor und können über Sieg oder Niederlage entscheiden. Dies ist vor allem der Fall, wenn am Ende der Ausdauerbelastung eine anaerobe Leistung[63] zu erbringen ist, wie zum Beispiel ein Zielsprint.
Darüber hinaus unterdrückt die Psychostimulation des ZNS die Müdigkeit und die Leistungsbereitschaft bleibt bis zu dem Ende der Belastung erhalten. Besonders Häufig werden diese Substanzen im Radsport und im Langlaufsport eingesetzt. Positive Dopingbefunde kommen allerdings sehr selten vor, da die Leistungssteigerung auch schon durch Dosen, die unter dem Grenzwert liegen möglich ist. Sportarten, die vor allem über eine technische Komponente verfügen sind ebenfalls durch ein Koffein-Doping begünstigt, wie zum Beispiel Turnen oder Fechten.
5.4.3 Kokain
Kokain wird aus dem Blatt der Kokapflanze gewonnen. Kokain besitzt die Eigenschaft, die Wiederaufnahme von Transmitterstoffen, wie zum Beispiel Noradrenalin, Dopamin oder Serotonin, aus dem synaptischen Spalt zu hemmen. Die verminderte Wideraufnahme ins Neuron führt zu einer verstärkten Wirkung dieser Transmitter. In höheren Konzentrationen blockiert Kokain auch spannungsabhängige Natriumkanäle an der Synapse und wirkt damit lokalanästhetisch[64].
Aus den oben beschriebenen Wirkungen, resultiert die Wirkung des Kokains auf den gesamten Organismus:
- Die Wirkungen auf das Nervensystem sind gekennzeichnet durch Verminderung der Müdigkeit, Empfindung eines Gefühls des Wohlseins und der Leistungsfähigkeit. Weiterhin kommt es zu einer Intensivierung angenehmer Empfindungen sowie zu einer Unterdrückung des Hungergefühls. In höheren Konzentrationen können allerdings auch visuelle und taktile Halluzinationen dazu kommen.
- Andererseits beeinflusst Kokain auch den Sympathikus. Es kommt zu einer markanten Frequenzsteigerung am Herzen. Folge dessen kann es zu einem hohen Blutdruckanstieg kommen. Dies wiederum kann zum Tod führen, am häufigsten durch das Herzkammerflimmern oder einen Infarkt.
Kokain besitzt auch eine suchterzeugende Komponente. Es wird angenommen das Kokain „nur“ eine psychische Abhängigkeit verursacht, dass heißt, es fehlen typische Entzugsyndrome.
5.4.3.1 Wirkung des Kokains auf die sportliche Ausdauer-Leistungsfähigkeit
Kokain wird im Bereich des Sportes vor allem auf Grund seiner psychostimulierenden Wirkung eingenommen. In geringen Dosen soll die Wirkung des Kokains mit dem der Amphetamine vergleichbar sein (siehe 5.4.1).
Die Kenntnis der potentiellen Nebenwirkungen, die mangelnde Gewissheit der Leistungssteigerung, die gute Nachweisbarkeit und nicht zuletzt die suchterzeugende Wirkung des Kokains, tragen dazu bei, dass es sich bei Kokain nicht unbedingt um eine häufige Form des Dopings handelt.
5.5 Sonstige Dopingmittel
Neben den oben erwähnten Dopingsubstanzen, gibt es noch unzählige weitere Substanzen. Im Bezug auf die Ausdauerleistung sind die vier oben genanten Gruppen die wirkungsintensivsten. Im Folgenden möchte ich die restlichen Substanzen der Vollständigkeit wegen kurz erläutern.
5.5.1 Diuretika
Sie dienen zur Entwässerung des Körpers und werden meist aus zwei Gründen als Dopingmittel eingesetzt:
- In einigen Sportarten werden die Sportler in Gewichtsklassen eingesetzt, um faire Wettkampfbedingungen zu schaffen, wie zum Beispiel im Judo, Boxen oder Gewichtheben. Wenn ein Sportler nun kurz vor dem Wettkampf noch knapp über der Grenze seiner Gewichtsklasse liegt, werden meist Diuretika eingesetzt. Auf diesem Weg ist eine Reduktion des Körpergewichts in 24 Stunden um rund 4% möglich.
- Der andere Grund für den Einsatz von Diuretika, ist die Annahme dass es die Nachweisbarkeit anderer Dopingmittel herabsenken kann[65].
5.5.2 Betablocker
Betablocker setzen die Herzfrequenz herab. Zusätzlich vermindern sie das Schlagvolumen und senken so den Blutdruck herab. Ursprünglich wurden diese Substanzen für Patienten mit Bluthochdruck entwickelt. Im Sport werden sie verbotener Weise im Bereich des Schießsportes eingesetzt. Grund dafür ist, dass sie das feine Zittern der Hände reduzieren und die Schießleistung dadurch verbessern.
5.5.3 Alkohol
Alkohol besitzt in geringen Dosen eingenommen, einen angstlösende, enthemmende bzw. beruhigende Wirkung. In Sportarten, in denen die Feinmotorik leistungsbestimmend ist, könnte sich daraus ein positiver Effekt ergeben. Alkohol hat keine günstige Wirkung auf Ausdauerleistungen, weder als Energiequelle (z.B. Bier), noch zum Auffüllen von Vitamin- und Mineralspeichern.
5.5.4 Cannabinoide
Haschisch enthält den Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC). Er hat keine günstigen Effekte auf die Leistungsfähigkeit. Er kann eventuell nervöse Verspannungen vor einem Wettkampf lösen (ähnlich dem Alkohol). Cannabinoide stehen nicht wegen der „leistungssteigernden“ Wirkung auf der Dopingliste, sondern wegen dem „drogenfreien“ Image des Sportes. Besonderes Aufsehen erregte der Fall des kanadischen Olympiasiegers Ross Rebagliati im Snowboard-Riesentorlauf 1998 in Nagano. Er konnte seine Unschuld trotz eines positiven THC-Befundes beweisen und durfte somit seine Goldmedaille behalten.[66]
5.5.5 Narkotika
Zur Gruppe der Narkotika zählen Morphin, Heroin, Methadon und ähnliche Substanzen. Der unter Umständen leistungssteigernde Effekt dieser Verbindungen, resultiert durch ihre schmerzstillende Wirkkomponente. Der Sportler kann seine natürliche Schmerzgrenze überschreiten. Diese Stoffe sind den Stimulantien sehr ähnlich. Wegen der veränderten Selbstwahrnehmung kann es zu einer gefährlichen Überbelastung des Organismus kommen. Denkbar ist auch, dass sich verletzte Sportler mit Hilfe der Narkotika den Schmerz ausschalten können, um so trotz einer Verletzung an einem Wettkampf teilzunehmen. Weiterhin bleibt zu sagen, dass diese Mittel auf Grund der hohen Suchtgefahr eher selten als Dopingsubstanzen eingesetzt werden.
5.5.6 Verschleiernde Wirkstoffe
Zu den verschleiernden Wirkstoffen (sog. Makierungssubstanzen) zählen die Substanzen, die eine Nachweisbarkeit der Dopingpräparate herabsetzen. Zu dieser Gruppe zählen zum Beispiel Probenedid, Epitestosteron oder Plasmaexpander. Die Wirkung dieser verschleiernden Substanzen machen sich logischerweise nur dopende Sportler zu Nutze, da der Nachweis einer dieser Substanzen einem Dopingmissbrauch gleichgesetzt wird. Diese Substanzen an sich haben keine leistungssteigernde Wirkung.
6. Doping der Zukunft
Auch wenn es den Dopingkontrollorganen gelingen sollte, alle Substanzen der aktuellen Dopingliste sicher und zweifelsfrei nachzuweisen, ist die Garantie für einen sauberen Sport nicht gegeben. Dies liegt darin begründet, dass die Sportler mit immer neuen Dopingsubstanzen, den Kontrollorganen immer „einen Schritt voraus“ sind. Die einzige Möglichkeit der Kontrolleure ist, neue Entwicklungen rasch zu erkennen und so schnell wie möglich ein Nachweisverfahren für diese Substanzen zu finden. Dies ist besonders wichtig, da die Athleten bereit sind, zu immer riskanteren Mitteln zu greifen. Die daraus resultierenden Folgeschäden, wie z.B. die Schäden, die durch das Gendoping entstehen könnten, sind noch nicht abzuschätzen.
6.1 Rinderhämoglobin
Bei dieser neuen, sich noch in der Probe befindlichen Substanz, handelt es sich um Hämoglobin von Rindern, das sich nach Verabreichung im Blutserum befindet und Sauerstoff von der Lunge in die benötigten Regionen transportieren kann. Anders als nur bei EPO tritt die gewünschte Wirkung binnen weniger Minuten ein. Dadurch wird eine rasche Verbesserung der Sauerstoffversorgung im Organismus möglich. Rinderhämoglobin wurde eigentlich in der Hoffnung entwickelt, weniger Bluttransfusionen einsetzen zu müssen, was besonders in der Notfallmedizin eine grundlegende Erneuerung der Behandlungsmethoden nach sich ziehen könnte. Da das gesäuberte Rinderhämoglobin keine Antikörper besitzt, ist es für jede Blutgruppe geeignet.
Im Bereich des Sportes könnte das Rinderhämoglobin ebenfalls zu einer Erschließung völlig neuer Wege führen. Die Ausdauerleistung wird dadurch massiv verbessert, da der arbeitenden Muskulatur mehr Sauerstoff zu Verfügung gestellt wird. Wie am Beispiel EPO zu sehen ist, führt eine vermehrte Sauerstoffversorgung zu einer enormen Leistungssteigerung. Die Anwendung erfolgt kurz vor der Belastung, da die Wirkung bereits nach wenigen Stunden nachlässt.
Man muss davon ausgehen dass diese Substanz bereits im Leistungssport eingesetzt wird. Zugänglich ist diese Substanz allerdings nur für einen sehr geringen Anteil an Athleten.
6.2 Gendoping
Unter dem Begriff Gendoping versteht man im Allgemeinen die Beeinflussung der natürlichen Gentranskription. Diese Möglichkeit des Dopings, ist auf die fast vollständige Entschlüsselung der menschlichen DNA zurückzuführen.
Mit Hilfe von Viren ist es möglich, bestimmte Genabschnitte in menschliche Zellen einzuschleusen. Denkbar wäre es zum Beispiel, dass auf diesem Genabschnitt die Synthese eines bestimmten Proteins angeregt wird. Handelt es sich dabei um einen Muskelwachstumsfaktor, so ist ein verstärktes Muskelwachstum vorprogrammiert.
So ist es zum Beispiel englischen Wissenschaftlern[67] (Geoffrey Goldspink und seinem Team) gelungen das fehlende Bindeglied zwischen dem mechanischen Reiz des Krafttrainings und des daraus folgenden Muskelwachstums zu finden, der „missing link“ namens MGF[68]. Goldspink ist es gelungen, den für das MGF-Protein codierten Genabschnitt an ein Virus zu binden, den er dann einer Maus in die Muskelzelle pflanzte. Im Laborexperiment ergab sich bei der Maus ein Muskelzuwachs von 20% in nur 2 Wochen. Eine intramuskuläre Injektion könnte Patienten mit Muskelschwund eine große Hilfe sein. Andererseits liegt das Missbrauchpotential auf der Hand. Zusätzlich erzeugte Wachstumsfaktoren sind identisch mit der natürlichen Substanz. Gendoping ist daher extrem schwer nachzuweisen. Die kraftspendende Pille oder Spritze könnte das Dopingmittel der Zukunft sein.
7. Schlussbetrachtung
Wie bereits im Einleitungsgedanken erwähnt, befindet sich der Leistungssport in einer gefährlichen Situation. Durch immer schlechter nachweisbare Dopingsubstanzen, ist die Gefahr, dass der Sport sich in einem „Dopingsumpf“ verwandelt durchaus gegeben, auch wenn gesagt werden muss, dass die Anzahl der dopenden Sportler eher gering ist[69]. Dies ist unter anderem dadurch bedingt, dass die Kontrollen immer häufiger abgehalten werden. Dies geschieht auch völlig unerwartet, es kann also jeden treffen.
Schlussendlich lässt sich sagen, eine sinnvolle Ernährung und zielgerichtet angewandte Physiotherapie sind als unterstützende Maßnahmen auf Dauer wirksamer und ungefährlicher als die Einnahme von Dopingsubstanzen. Die sogenannte „Wundertablette“ gibt es im Sport bisher nicht und es wird sie auch in nächster Zeit nicht geben. Denn wer über lange Jahre erfolgreich sein will, der wird das enorme Risiko, die eine dauerhafte Einnahme von Medikamenten mit sich bringt nicht eingehen. Die beste „Medizin“ ist immer noch ein wissenschaftlich gut aufgebauter Trainingsplan, sowie die gute Führung eines Sportlers durch kompetente Trainer und Sportmediziner. Weiterhin bleibt zu sagen, dass ein guter Trainingszustand immer noch die beste „Dopingprophylaxe“ darstellt.
8. Anhang / Glossar
- [1]
- Siehe 2.2
- [2]
- Siehe 4.
- [3]
- Vgl. Internetquelle 8
- [4]
- Siehe 6.
- [5]
- Vgl. Microsoft Encarta
- [6]
- Siehe 5.4
- [7]
- Siehe 5.5.5
- [8]
- Siehe 5.1
- [9]
- Siehe 5.5.1
- [10]
- Siehe 5.2
- [11]
- Siehe 5.5.4
- [12]
- Siehe 5.5.3
- [13]
- Siehe 5.5.2
- [14]
- vgl. Abbildung 1
- [15]
- vgl. 5.1
- [16]
- Schneller, höher, weiter
- [17]
- vgl. Lünsch
- [18]
- vgl. Internetquelle 5
- [19]
- Einnahme
- [20]
- Eine vermehrte Zugabe führt nicht zu einer vermehrten Leistungsverbesserung
- [21]
- Hormonspiegel
- [22]
- Muskelschwund
- [23]
- Vermännlichung
- [24]
- Follikelstimulierendes Hormon
- [25]
- Luteinisierendes Hormon
- [26]
- Bildung eines Tumors
- [27]
- Störung des Galleflusses
- [28]
- blutgefüllte Zysten in der Leber
- [29]
- Leberkrebserkrankungen
- [30]
- low density lipoproteins
- [31]
- high density lipoproteins
- [32]
- Abnahme der Spermabildung
- [33]
- z.B. Propionat, Decanoat, Enantat und Phenylpropionat mit Testosteron verestert
- [34]
- Energieverbrauch nach Nahrungsaufnahme
- [35]
- siehe 5.2.3
- [36]
- Biotransfusion von Enzymen in der Leber
- [37]
- siehe 5.1.1
- [38]
- siehe 5.1.2.2
- [39]
- siehe 5.1.2.4
- [40]
- unwillkürliche rhythmische Oszillation eines oder mehrerer Körperabschnitte („Zitteranfälle“)
- [41]
- vgl. Microsoft Encarta 2002
- [42]
- Adrenocorticotropes Hormon
- [43]
- Somatotropin
- [44]
- Hirnanhangsdrüse
- [45]
- human chorionic gonadotropine
- [46]
- Luteinisierendes Hormon = Lutropin = ICSH = Zwischenzellstimulierendes Hormon
- [47]
- Er liegt unterhalb des Thalamus, ist der Hauptteil des Zwischenhirns
- [48]
- Growth hormone releasing hormone
- [49]
- Growth hormone = STH = Somatotropin
- [50]
- Insulin-like growth factor = Somatomedin C
- [51]
- growth hormone inhibiting hormone = Somatostatin
- [52]
- Fähigkeit einen Stoff zu binden
- [53]
- siehe Internetquelle 6
- [54]
- Erythropoetin-Abgabe
- [55]
- regulierte Aktivierung der Enzymaktivität
- [56]
- z.B.: Etilferin und Clenbuterol / siehe 5.1.3
- [57]
- Nervenzellen
- [58]
- z.B.: Flucht, Kampf, etc.
- [59]
- siehe 2.2
- [60]
- vgl. Abbildung 6
- [61]
- Erschlaffung der Bronchialmuskulatur
- [62]
- Schlagkraft des Herzens erhöht sich
- [63]
- Leistung mit einer Unterversorgung an Sauerstoff
- [64]
- lokal betäubend
- [65]
- „Maskierung“ siehe 5.5.6
- [66]
- vgl. Internetquelle 7
- [67]
- vgl. Internetquelle 4
- [68]
- mechano growth factor
- [69]
- This reference points to an internal context.
- Internetquelle 1
- Interquelle 2
- Internetquelle 3
- Internetquelle 4
- Internetquelle 5
- Internetquelle 6
- Internetquelle 7
- Internetquelle 8
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Einleitungsgedanke des Textes?
- Der Text beginnt mit der Feststellung, dass der Wunsch nach Leistungssteigerung im Wettkampf, insbesondere im Sport, so alt ist wie die Menschheit. Im Spitzensport entscheiden oft Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage, und Sportler suchen nach Möglichkeiten, ihre Leistungsgrenzen zu überschreiten. Der Leistungssport befindet sich jedoch in einer gefährlichen Entwicklung, da Sportler bereit sind, große Risiken durch die Einnahme von Dopingmitteln einzugehen.
Wie ist der Dopingbegriff entstanden und wie wird er definiert?
- Das Wort "Doping" stammt aus einem südostafrikanischen Dialekt, in dem "dop" einen Schnaps bezeichnete, der bei Kulthandlungen als Stimulans diente. Der Begriff gelang nach England und wurde zunächst für die Stimulierung von Pferden mit Alkohol verwendet. 1889 erschien "Doping" erstmals in einem englischen Wörterbuch als eine Mischung von Opium und Narkotika für Tiere. Später wurde der Begriff auch auf den Menschen ausgedehnt.
Welche Missbräuche gab es in der Geschichte des Sports?
- Schon früh in der Geschichte der Menschheit gab es Versuche, die sportliche Leistung durch die Einnahme von Substanzen zu verbessern. Beispiele sind die Verwendung von Bufotein durch skandinavische Berserker, Kräutern und Stierhoden durch griechische Athleten und Cocablätter durch Inkas. Im modernen Sport gab es ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dokumentierte Dopingfälle, wie den Todesfall eines Radrennfahrers im Jahr 1886 und den Fall Ben Johnson bei den Olympischen Spielen 1988.
Wie definiert der Deutsche Sport Bund Doping?
- Die Definition des Deutschen Sport Bundes (2000) besagt, dass Doping der Versuch der Leistungssteigerung durch die Anwendung verbotener Substanzen oder Methoden ist. Die Liste der verbotenen Wirkstoffgruppen umfasst Stimulanzien, Narkotika, anabole Substanzen, Diuretika, Peptidhormone, Cannabinoide und sportspezifische Substanzen wie Alkohol und Beta-Blocker.
Welche biologischen Grundlagen gibt es für das Doping?
- Nur etwa 80 % der maximalen Leistungsfähigkeit sind durch normalen Willenseinsatz verfügbar. Die restlichen 20 % sind die autonom geschützten Reserven. Diese Reserven können durch Ausdauertraining erweitert werden, aber die Einnahme von Dopingsubstanzen kann diese Barriere ebenfalls durchbrechen. Dies birgt jedoch Gefahren, da es zu einem plötzlichen Leistungsabfall und Herz-Kreislauf-Zusammenbruch kommen kann.
Welche Gründe und Motive gibt es für den Griff zum Dopingmittel?
- Sportler und Trainer erhoffen sich durch Doping eine Steigerung der sportlichen Leistungsfähigkeit. Dies wird durch die zunehmende Leistungsdichte im Spitzensport, den Wettlauf von Werbemanagern und den allgemeinen "Citius-Altius-Fortius-Gedanken" beeinflusst. Athleten sehen sich einem permanenten Leistungsdruck ausgesetzt und wollen sich finanziell absichern.
Welche ausdauerspezifischen Dopingsubstanzen und ihre Wirkungsmechanismen werden beschrieben?
- Der Text beschreibt Anabolika (anabole Steroide, Prohormone, Beta-2-Mimetika), Peptidhormone (Testosteronliberatoren, Wachstumshormone, Erythropoetin (EPO)), Glukokortikoide und Stimulantien (Sympathomimetika, Methylxanthine, Kokain) sowie weitere Dopingmittel wie Diuretika, Betablocker, Alkohol, Cannabinoide und Narkotika.
Was ist Gendoping und was sind die Zukunftsperspektiven des Doping?
- Gendoping bezieht sich auf die Beeinflussung der natürlichen Gentranskription, beispielsweise durch das Einschleusen von Genabschnitten in menschliche Zellen mit Hilfe von Viren, um die Synthese bestimmter Proteine anzuregen. Die Zukunft des Dopings könnte neue Substanzen wie Rinderhämoglobin und Gendoping umfassen, die schwer nachzuweisen sind.
Was ist die Schlussbetrachtung des Textes?
- Der Leistungssport befindet sich in einer gefährlichen Situation, da immer schwerer nachweisbare Dopingsubstanzen verwendet werden. Eine sinnvolle Ernährung und zielgerichtet angewandte Physiotherapie sind jedoch auf Dauer wirksamer und ungefährlicher als die Einnahme von Dopingsubstanzen. Ein wissenschaftlich gut aufgebauter Trainingsplan, kompetente Trainer und Sportmediziner sowie ein guter Trainingszustand stellen die beste Dopingprophylaxe dar.
- Quote paper
- Benedikt Sperl (Author), 2003, Doping im Ausdauersport, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109105