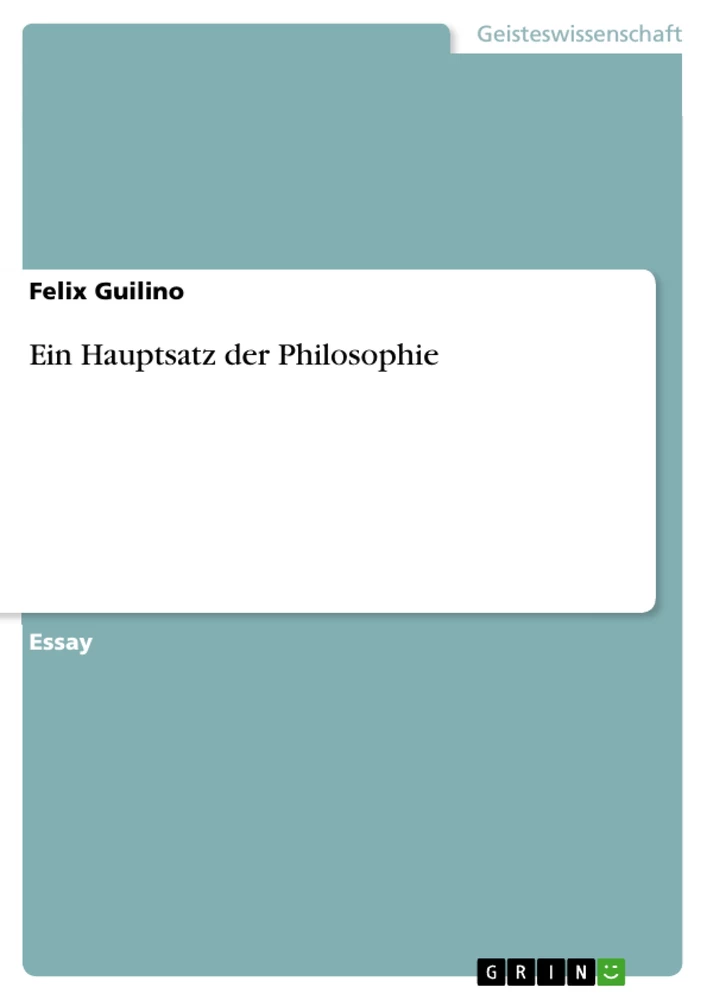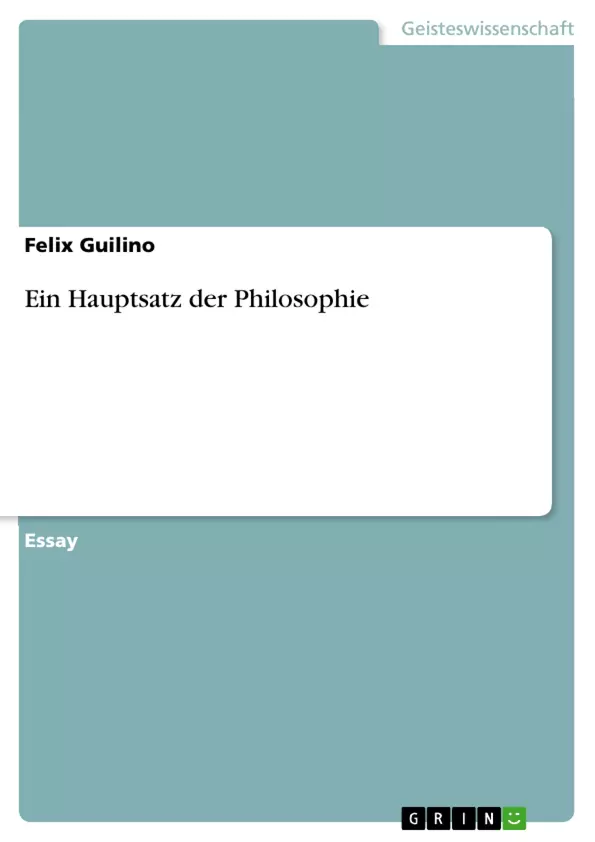Inhaltsverzeichnis
I. Der Hauptsatz
II. Erläuterungen
III. Beispiele
1. Geometrien
2. Zufall und Notwendigkeit
3. Allgemeine Relativitätstheorie und Quantentheorie
4. Körper und Geist („Leib und Seele“)
7. Linke und rechte Gehirnhälfte
8. Kooperation und Konkurrenz
9. Rational-nüchternes und dramatisch-erotisches Verhalten (Verstand und Gefühl)
10. Punkt der Erkenntnis und Punkt bestmöglicher Aussichten
11. Natürliche Sprachen
12. Frau und Mann
13. Demokratische Rechtsordnung und Selbstjustiz in Ausnahmefällen
IV. Folgerungen
I. Der Hauptsatz
Unser Universum ist komplementär.
II. Erläuterungen
„Unser“
In seinem vorzüglichen Buch „Warum gibt es die Welt?“ legt der Physiker Lee Smolin überzeugend dar, daß es vermutlich ungeheuer viele voneinander getrennte Universen gibt, darunter etliche, vielleicht die meisten, lebensfreundlich und dem, in dem wir leben, ähnlich. Für einen großen Teil der Parallelwelten könnte das Gesetz der Komplementarität gelten.
„Universum“
Damit meine ich die Gesamtheit all dessen, was es in unserem Weltall überhaupt gibt, also auch auf der obersten Betrachtungsebene diesen Kosmos als Ganzes. Die äußerst schwierige und umstrittene Frage, ob und wie man alles Existierende in Klassen aufteilen kann, überlasse ich anderen Denkern.
„komplementär“
Definition:
Komplementarität heißt die Eigenschaft unseres Universums, sich trotz seiner Einheitlichkeit nur auch mit gleichwertigen, einander ergänzenden und zugleich widersprechenden Ansätzen ausschöpfen zu lassen.
„Einheitlichkeit“ bedeutet folgendes:
1. Überall gelten dieselben Gesetze; alle materialistisch faßbaren Gegenstände sind aus den gleichen, bei jeder Sorte untereinander identischen Elementarteilchen aufgebaut.
2. Es ist unmöglich, ein Teilsystem vollkommen vom Rest des Universums zu isolieren: „Alles hängt von allem ab“ (Albert Einstein).
Zum Glück dürfen wir im Alltag weitgehend Abhängigkeiten mit sehr guter Näherung vernachlässigen. Meine Lebenserwartung mag an der 20. Stelle nach dem Komma von der Stellung des Pluto abhängen, aber darüber brauche ich mir keine Sorgen zu machen.
„Gleichwertigkeit“ der Ansätze bedeutet, daß es keinen allgemeingültigen objektiven (vom Beobachter unabhängigen) Grund gibt, einen dem anderen vorzuziehen.
Was genau die Formulierung „durch einander ergänzende und zugleich widersprechende Ansätze ausschöpfen zu lassen“ bedeutet, sieht von Fall zu Fall anders aus und erschließt sich hoffentlich aus den Beispielen unter III.
In Teil IV werde ich versuchen, die philosophische Tragweite des Komplementaritätssatzes weiter herauszuarbeiten.
III. Beispiele
Was für eine Welt von Wahrheit verbirgt sich hinter den vier Worten dieses Hauptsatzes! Das möchte ich Ihnen anhand einiger Beispiele vor Augen führen.
1. Geometrien
Literatur: Douglas R. Hofstadter, „Gödel, Escher, Bach“, Klett-Cotta, Stuttgart 1989, Seite 96 ff.
Die euklidische Geometrie fußt auf fünf Postulaten. Das letzte heißt Parallelenaxiom:
Zu jeder Geraden gibt es durch jeden nicht auf ihr liegenden Punkt genau eine Parallele.
Generationen von Mathematikern versuchten das fünfte Postulat mit Hilfe der ersten vier zu beweisen. Damit hätte man gezeigt, daß es sich nicht um ein Axiom, sondern um einen Satz der euklidischen Geometrie gehandelt hätte.
Im 19. Jahrhundert wies man nach:
Das fünfte Postulat kann nicht auf die ersten vier zurückgeführt werden, ist also von ihnen unabhängig. Zusammen bilden die fünf Fundamentalsätze den Kern einer in sich widerspruchsfreien Mathematik. Das gleiche gilt, wenn man das fünfte Axiom durch eine Variante ersetzt, zum Beispiel:
Zu jeder Geraden gibt es durch jeden nicht auf ihr liegenden Punkt keine Parallele.
Damit erhält man die elliptische Geometrie, die sich auf der Oberfläche einer Kugel veranschaulichen läßt.
Oder:
Zu jeder Geraden gibt es durch jeden nicht auf ihr liegenden Punkt mindestens zwei Parallelen.
Das führt auf die hyperbolische Geometrie. Im Alltag begegnet man ihr auf der Oberfläche eines Sattels.
Satz:
Euklidische, elliptische und hyperbolische Geometrie sind komplementär.
Um das zu zeigen, müssen wir prüfen, ob die „Tatbestandsmerkmale“ der Komplementarität erfüllt sind:
Die drei Geometrien sind gleichwertig, weil sie mathematisch gleich leistungsfähig sind. (Das gilt nicht für die sogenannte absolute Geometrie, die nur mit den ersten vier Postulaten arbeitet. Damit lassen sich weniger Sätze beweisen.)
Die drei formalen Systeme ergänzen einander, da sie zusammen die elementare Planimetrie umfassen. Je nachdem, ob die zugrunde liegende Fläche flach (euklidische Geometrie), positiv gekrümmt (elliptische) oder negativ gekrümmt (hyperbolische) ist, hilft genau eine Spielart weiter.
Die Widersprüchlichkeit der drei Arten von Mathematik zeigt sich darin, daß man sich in jedem geeigneten Fall für eine entscheiden muß, da sich die Axiomensysteme paarweise widersprechen.
Das ist nicht die Art von Widerspruch, die Mathematikern den Schlaf raubt. Könnte man mit derselben Alternative beweisen, daß die Winkelsumme in jedem Dreieck weniger als 180° beträgt, und zugleich, daß sie stets darüber liegt, würden sämtliche Alarmglocken schrillen! Kommt man mit unterschiedlichen Fundamentalsätzen zu verschiedenen Ergebnissen, ist daran nichts auszusetzen.
2. Zufall und Notwendigkeit
Die heillose Zerstrittenheit der Philosophen rührt zu einem beträchtlichen Teil daher, daß Begriffe nicht sauber definiert werden. Bei so schillernden Worten wie „Notwendigkeit“ und erst recht bei „Zufall“ müssen wir unbedingt festlegen, was genau wir darunter verstehen.
Definition:
S sei ein Sachverhalt.
Zum Zeitpunkt t werde das gesamte Universum einschließlich etwaiger Beobachter N -unendlich oft bis auf Quantenebene identisch vervielfältigt, ohne daß die Parallelwelten sich im geringsten beeinflussen können, während sie sich anschließend auseinanderentwickeln.
Der Quotient
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
heißt Wahrscheinlichkeit P des Sachverhalts S zur Zeit t.
Zugegeben, das ist ein Hammer! Leider muß ich Sie damit behelligen: Nur darauf aufbauend kann man meiner Meinung nach das Zusammenspiel von Zufall und Notwendigkeit verstehen. Ein Paradebeispiel dafür ist die Evolution.
Den Wesensgehalt dieser Definition veranschaulicht man am besten an Beispielen. Zuvor erläutere ich den Sprachgebrauch und kläre physikalische und mathematische Fragen.
Ein Sachverhalt kann ein Ereignis oder Vorgang sein:
– Am 11. August 1999 trat in München eine totale Sonnenfinsternis ein.
– X’ Bankguthaben wird in der zweiten Januardekade 2001 von 1000 DM auf 2000 DM wachsen.
Der folgende Sachverhalt ist ein Zustand:
– Gerhard Schröder war 1999 das ganze Jahr Bundeskanzler.
Eine Behauptung dieses Inhalts ist eine Aussage. Auch jede Aussage heißt unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt Sachverhalt. Bei Aussagen bedeutet „S tritt ein“ soviel wie: „Die Aussage ist wahr.“ Weitere Beispiele für Aussagen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Klarstellung „einschließlich etwaiger Beobachter“ meint folgendes:
Wenn Sie sich etwa fragen: „Wie groß ist zur Zeit die Wahrscheinlichkeit, daß es in ganz München an Heiligabend 2001 für eine geschlossene Schneedecke reicht?“, dann sind Sie der Beobachter. Bei dem Gedankenversuch sind Sie selbst unendlich oft mit zu vervielfältigen, da die gesuchte Zahl sehr schwach von Ihnen abhängt. Beispielsweise erzeugt Ihr Auto beim Fahren Wärme, diese beeinflußt etwas die lokale Thermik, das wiederum ganz schwach das Wetter. Ohne Sie fiele das Ergebnis einen Hauch kleiner oder größer aus!
Unseren Kosmos einschließlich unserer selbst unendlich oft perfekt zu kopieren und die Parallelwelten von Anfang an vollkommen voneinander zu isolieren ist quantenphysikalisch absolut unmöglich. Trotzdem ist es erlaubt, sich dieses Gedankenexperiments zu bedienen, weil es den Zustand zur Zeit t, in dem das Weltall gedanklich „eingefroren“ wird, gibt. Wir fragen: Was würde passieren, wenn das Universum bei diesem Zustand unendlich oft begänne?
Zum Glück dürfen wir im Alltag oft stark vereinfachen. Wenn Ihnen jemand eine Münze zeigt und fragt: „Kopf oder Zahl?“, dann pfeifen Sie zu Recht auf den Rest des Alls und denken: „Je 50 % Chance.“
„ N -unendlich oft“ ist ein laxer Ausdruck für folgendes: Die Zahl der kopierten Universen (strenggenommen: die Zahl der Originale) ist abzählbar unendlich; die Menge der Parallelwelten läßt sich bijektiv, also 1:1, auf die der natürlichen Zahlen (1; 2; 3; ...) abbilden.
Auf den elementarsten Ebenen, im Maßstab der Elementarteilchen bis etwa zu den Atomen, stößt man auf Schwierigkeiten:
Unter bestimmten Voraussetzungen verharrt ein Quantensystem (beispielsweise ein Elektron) im Zustand der Kohärenz, das heißt in einer Superposition oder Überlagerung von Quantenzuständen. Der springende Punkt: Solange das System nicht von außen gestört und damit gezwungen wird, sich für eine Möglichkeit zu entscheiden, befindet es sich in keinem Quantenzustand!
Nach der Definition der Wahrscheinlichkeit müssen wir uns folglich vorstellen, daß sämtliche Parallelwelten mit identischen Schwebezuständen beginnen. „Identisch“ bedeutet: Es ist nicht nur kein Unterschied feststellbar, sondern es gibt keinen.
Eine weitere, mathematische Frage steckt im Bruch der Definition:
Wenn die Unendlichkeit auftaucht, gibt es häufig Ärger. Hier haben wir es mit einem Quotienten zu tun, in dessen Zähler entweder Null oder Unendlich (genauer: Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten, Aleph Null) steht, im Nenner stets Unendlich (Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten). Dennoch hat der Quotient in jedem Fall, in dem es sich entscheidet, ob S eintritt, einen bestimmten – in der Regel irrationalen – reellen Wert, der mindestens 0 und höchstens 1 beträgt.
Entscheidet es sich nicht, ob S eintritt, ist keine Wahrscheinlichkeit definiert. Beispiel:
P (Pilot Pirx hat Blutgruppe 0) = nicht definiert
Aus dem brillanten Zyklus von zehn Erzählungen geht nicht hervor, welche Blutgruppe der Held hat. Obwohl die Frage sinnvoll ist – für die eine oder andere literarische Figur dürfte sie zu beantworten sein – steht in diesem Fall nicht einmal fest, ob S eintritt, geschweige denn, daß wir es feststellen könnten.
Bei nicht zeitbezogenen Aussagen wie der obigen brauchen wir zu P (englisch: possibility) keinen Zeitpunkt als Bezug anzugeben.
Unüberwindliche mathematisch-logische Hindernisse für diese Definition der Wahrscheinlichkeit würden auftauchen, wenn Raum und Zeit (besser: die Raumzeit) nicht wie heute angenommen als feinstkörnig – gequantelt – anzusehen wären, sondern als Kontinuum.
Gleichfalls hinfällig wäre das Modell der Wahrscheinlichkeit, falls unser Universum in Wirklichkeit determiniert, das heißt bis ins kleinste vorherbestimmt sein sollte. Dann gäbe es, abgesehen von nichtdefinierten Fällen, für P nur die Werte 0 und 1.
Zu meiner Beruhigung sind sich heute fast alle Physiker einig, daß der Determinismus ausgedient hat. Nach der allgemein anerkannten, aufgrund zahlloser Versuche als gesichert geltenden Quantentheorie können wir nicht nur nicht berechnen, wann ein gegebenes Radiumatom zerfallen wird, sondern es steht nicht einmal im vorhinein fest.
Man kann auch nach bedingten Wahrscheinlichkeiten fragen:
„Falls Frau XY mindestens ein Kind bekommen sollte – wie groß ist unter dieser Bedingung derzeit die Chance, daß das erste ein Mädchen sein wird?“
Frau XY habe derzeit kein Kind und sei nicht schwanger.
Wir müssen bei dieser Frage den Bruch für P ändern:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zum Wahrscheinlichkeitsmodell folgen abschließend zwei Beispiele und eine philosophische Deutung.
Wie groß ist derzeit die Wahrscheinlichkeit, daß George Mallory und Andrew Irvine bei ihrer Expedition am 8. Juni 1924 den Gipfel des Mount Everest erreichten?
Wir begegnen hier dem größten Rätsel in der Geschichte des Bergsteigens. Die Frage, ob die beiden auf dem Gipfel gestanden sind, ist bis heute (Ende 2000) unbeantwortet und leidenschaftlich umstritten, auch wenn die Mehrzahl der besten Bergsteiger tippt, daß sie es nicht geschafft haben. Für 2001 plant man eine Expedition, deren Mitglieder nach Irvines Leiche suchen sollen – Mallory fand man im Mai 1999.
Wenden wir unsere Definition an:
Wenn sämtliche Parallelwelten mit der unsrigen im jetzigen Zustand identisch sein sollen, muß das auch für alle Tatsachen gelten, insbesondere für alle geschichtlichen Tatsachen. Daraus folgt: Auch die gesamte Vorgeschichte muß jeweils der unserer Welt aufs Haar gleichen; sie wird mitkopiert.
Ebenso, wie unser Universum in seinem Jetztzustand existiert, gibt es eine Vergangenheit (die laufend reichhaltiger wird). Der Gedanke, alles Bisherige zu vervielfältigen, ist daher nicht völlig abwegig.
Was hat das mit unserer Frage zu tun? Ist es in unserem Universum Mallory und Irvine gelungen, den Gipfel zu stürmen, dann auch in jeder Parallelwelt. In diesem Fall: P = 1.
Sind sie gescheitert, dann auch in jeder Parallelwelt. Deshalb gälte: P = 0.
Welche der beiden Alternativen zutrifft, weiß bis auf weiteres niemand. Genau eine ist richtig, die andere falsch; das ist alles. P hat einen eindeutigen, wenn auch unbekannten Wert.
Die Ungewißheit von P ist nicht absolut, weil in Wirklichkeit feststeht, ob die Männer ihr Ziel erreicht haben – das hat sich am 8. Juni 1924 entschieden. Wir wissen es nur nicht und werden es vielleicht nie erfahren. Ob es in genau 24 Stunden am Münchner Marienplatz regnen wird, ist dagegen im absoluten Sinn offen – es steht nicht fest, sondern es gibt nur eine Wahrscheinlichkeit dafür. Bei vergangenen und damit im quasiklassischen Bereich stets objektiv entschiedenen Ereignissen oder Zuständen hat P, wenn definiert, in jedem Fall einen eindeutigen Wert: entweder 0 oder 1.
Es ist also Unsinn zu behaupten: „Mallory und Irvine haben mit 50 % Wahrscheinlichkeit den höchsten Punkt der Erde betreten.“ Zulässig, wenn auch subjektiv (vom Beobachter/Urteilenden abhängig), wäre es zu schätzen: „Es liegt fünfzigprozentig nahe, daß sie oben waren.“
Letztes Beispiel:
Wie stehen zur Zeit meine Chancen, mindestens 80 Jahre alt zu werden?
Man könnte auf die Idee kommen, in einer Sterbetafel nachzuschauen: Deutscher, männlich, 32 Jahre. Wie inzwischen klar sein sollte, würde dieser Wert von dem abweichen, der sich aus unserem Gedankenversuch ergäbe. Statistiken sagen gewöhnlich nur etwas über relative Häufigkeiten: Man kann damit ermitteln, wieviel Prozent mit mir vergleichbarer Männer nach bisheriger Erfahrung 80 werden. Meine persönlichen Aussichten sehen praktisch sicher anders aus. Zum Beispiel könnte ein Atomkrieg ausbrechen, so daß die fragliche Zahl nahe bei 0 läge. Oder alles wäre in Ordnung, und mit den Genen meiner Großmutter, die 98 wurde, läge die Wahrscheinlichkeit bei achtzig Prozent ...
Die Antwort läßt sich allenfalls vage schätzen, selbst nach einer peinlich genauen medizinischen Untersuchung. Wenn eine genau definierte Größe zu jedem Zeitpunkt einen eindeutigen Wert hat, folgt daraus leider keineswegs, daß wir ihn in jedem Fall auch nur näherungsweise bestimmen können.
Was ist der philosophische Wesensgehalt der Wahrscheinlichkeitsdefinition?
Satz:
Wahrscheinlichkeit ist ein Maß für die Neigung des Universums einschließlich etwaiger Beobachter, einen bestimmten Sachverhalt zu verwirklichen.
Nunmehr können wir Zufall und Notwendigkeit wasserdicht definieren.
Definition:
Ein verwirklichter Sachverhalt heißt genau dann zufällig, wenn seine Eintrittswahrscheinlichkeit sich zu mindestens einem Zeitpunkt wesentlich von 1 unterschied.
Schon wieder so eine Definition! Ich erkläre sie an einem Beispiel:
Beim Lotto „6 aus 49“ wurden am 04.11.2000 die Zahlen 17, 22, 37, 43, 46 und 48 gezogen. Das war ein Zufall, denn die Momentanwahrscheinlichkeit für dieses Ereignis (oder Ergebnis) schwankte bis kurz nach Beginn der Ziehung sehr schwach ungefähr um einen Wert von 1/13 983 816, den man in der Oberstufe des Gymnasiums errechnet. Da alles von allem abhängt, läßt sich die „Lehrbuchwahrscheinlichkeit“ nur mit guter Näherung realisieren.
Umgangssprachlich bedeutet Zufall ungefähr soviel wie: Es hätte anders kommen können. Für eine seriöse Untersuchung ist das jedoch zu ungenau!
Definition:
Ein verwirklichter Sachverhalt heißt genau dann notwendig, wenn seine Eintrittswahrscheinlichkeit sich zu keinem Zeitpunkt wesentlich von 1 unterscheidet.
Dazu zwei Beispiele:
1 + 1 = 2
Diese Tatsache ist notwendig, denn sie ist zeitunabhängig wahr. Jederzeit gilt P (1 + 1 = 2) = 1.
Am 4. November 2000 floß die Isar den ganzen Tag auf ihrer gesamten Länge bergab.
Aufgrund der Naturgesetze geschah dies notwendigerweise. Die Momentanwahrscheinlichkeit dafür betrug am 04.11.2000 bis unmittelbar vor Mitternacht fast genau 1 (Tendenz ganz leicht steigend), ab Mitternacht exakt 1.
Umgangssprachlich bedeutet Notwendigkeit ungefähr soviel wie: Es mußte so kommen.
Jeder verwirklichte Sachverhalt ist grundsätzlich Zufall oder Notwendigkeit, allerdings verschwimmt die Grenze zwischen beiden. Worum es sich jeweils handelt, ist nur im Einzelfall zu klären.
Das Wort „wesentlich“ in den zwei Definitionen markiert eine Schwäche und eine Stärke zugleich: Beide Begriffsbestimmungen bleiben so etwas unscharf, passen sich aber eben deshalb dem Einzelfall an. Häufig lassen sich nicht einmal genäherte Wahrscheinlichkeiten angeben, so daß man intuitiv entscheiden muß.
Jetzt sind wir soweit!
Satz:
Zufall und Notwendigkeit sind komplementär.
Ein größerer Gegensatz als der zwischen den beiden Prinzipien läßt sich kaum denken. Zufall bedeutet Unvorhersehbarkeit, Notwendigkeit steht für Ordnung und Gesetzmäßigkeit.
Zufall und Notwendigkeit widersprechen sich.
Alles Leben auf der Erde gehorcht den Gesetzen der Evolution. Der Zufall sorgt für immer neue Mutationen und erforscht so den Möglichkeitsraum der Genome. Die Notwendigkeit gewährleistet als Selektion, daß Fortschritte erhalten bleiben und das Komplexitätsniveau auf lange Sicht steigt: Zufall und Notwendigkeit ergänzen sich.
Ohne Notwendigkeit versänke die Welt im Chaos. Nachteilige Mutationen würden nicht mehr in Schach gehalten. Ohne Zufall würde die Welt erstarren. Vorteilhafte Kopierfehler im Erbgut kämen nicht mehr vor. Manchen neuen Stoff in der Chemie entdeckte man unbeabsichtigt!
„Zwei Dinge bedrohen die Welt: die Ordnung und die Unordnung“ (Paul Ambroise Valéry).
Zufall und Notwendigkeit sind gleichwertig.
3. Allgemeine Relativitätstheorie und Quantentheorie
Spezielle Relativitätstheorie und Newtonsche Mechanik sind Spezialfälle der allgemeinen Relativitätstheorie und inbegriffen, wenn ich von dieser spreche.
Satz:
Allgemeine Relativitätstheorie und Quantentheorie sind komplementär.
Beide Theorien sind durch zahllose Experimente immer wieder bestätigt worden und gelten als gesichert. Bis heute kennt man kein Versuchsergebnis, das der einen oder anderen widerspricht. Im Gegenteil, die zwei glänzen mit erstaunlichen Erfolgen:
Die allgemeine Relativitätstheorie erklärt die Periheldrehung des Merkur, an der die Newtonsche Mechanik scheitert.
Wie mir mein Freund Reinhard S. erklärt hat, sind die charakteristische Farbe des Goldes und Reflexionen an Glas zum Teil auf Quanteneffekte zurückzuführen.
Die beiden Ansätze sind einander ebenbürtig, und sie ergänzen sich:
Der eine behandelt vor allem die Physik auf elementarer Ebene, im Größenbereich von Elementarteilchen bis etwa zu Atomen. (Es gibt keine scharfe Grenze; man darf die Gesetze der Quantenmechanik auf makroskopische Systeme anwenden.) Der andere befaßt sich hauptsächlich mit der Physik im Größenbereich der Astronomie und Kosmologie.
Satz:
Allgemeine Relativitätstheorie und Quantentheorie widersprechen sich.
Wie das?
Die Relativitätstheorie ist deterministisch, das heißt, in ihrem Rahmen herrscht stets hundertprozentige Notwendigkeit. Es steht also in diesem Rahmen stets bis ins kleinste fest, was passieren wird. Daraus folgt keineswegs, daß wir alles berechnen können: In der Newtonschen Physik läßt sich das Dreikörperproblem nicht analytisch – mit absoluter Genauigkeit – lösen, in der Relativitätstheorie das Zweikörperproblem.
Die Quantentheorie ist indeterministisch, in ihrem Rahmen gibt es den Zufall. Dabei kann man sich keinesfalls damit herausreden, der Zufall existiere in Wirklichkeit nicht und Wahrscheinlichkeiten seien nur Hilfsgrößen, um eine gewissermaßen technische, mitnichten prinzipielle Ungenauigkeit, verursacht durch Meß- und Rundungsfehler, auszudrücken. Der springende Punkt: Es gibt unabänderlich objektive, absolute Ungewißheit. Wann ein Radiumkern zerfällt, steht wie gesagt bis zuletzt nicht einmal fest, geschweige denn, daß wir es vorhersagen könnten.
Auf den ersten Blick sieht es so aus, als sei die Komplementarität der zwei Ansätze damit bewiesen. Im Gegensatz zum ersten Beispiel (Geometrien) erscheint dieser Widerspruch bedenklich: Unser Universum kann unmöglich zugleich determiniert und nichtdeterminiert sein. Wir müssen den Gegensatz mildern – auch deswegen, weil sonst die Gleichwertigkeit der beiden Theorien nicht zu halten ist.
Wie ich beim vorigen Beispiel festgestellt habe, sind sich die Physiker heute praktisch einig, daß unsere Welt nicht vorherbestimmt ist. Wie rettet man dann die Relativitätstheorie?
In der Physik nimmt man es schon etwas weniger genau als in der Mathematik, der exaktesten aller Wissenschaften. Man unterscheidet zulässigerweise zum Beispiel nicht zwischen einer Wahrscheinlichkeit, die sehr nahe bei 1 liegt, und absoluter Gewißheit, weil es in der Praxis keinen Unterschied macht.
Könnte man etwa Beginn und Ende einer Sonnenfinsternis so genau berechnen, wie die Naturgesetze es zum betreffenden Zeitpunkt festlegen, ergäbe sich eine zeitliche Wahrscheinlichkeitsverteilung mit zwei so scharfen Spitzen, daß man die Abweichung gegenüber der Voraussage der deterministischen Physik getrost vergessen könnte. Man berechnet Sonnenfinsternisse mit den heutigen Methoden zuverlässig Tausende von Jahren voraus und zurück. Was eine physikalische Theorie taugt, erkennt man daran, ob sich ihre Voraussagen bestätigen. Im quasiklassischen Bereich wird Einsteins Meisterwerk unschlagbar bleiben.
Mit dem nur für die Theoretiker ärgerlichen Spannungsverhältnis zwischen den beiden genialsten physikalischen Theorien des 20. Jahrhunderts kann man also gut leben. Es beeinträchtigt nicht im geringsten die Genialität und Schönheit des Einsteinschen Gedankengebäudes.
4. Körper und Geist („Leib und Seele“)
Generationen von Philosophen haben sich über das sogenannte Leib-Seele-Problem den Kopf zerbrochen. Es lautet: Welche Beziehung besteht zwischen Leib und Seele des Menschen?
Unter „Leib“ versteht man in der Regel den Aufbau des menschlichen Organismus und die Abläufe darin. Heute verwendet man eher das Wort „Körper“. Mit beiden meint man den materialistischen Standpunkt.
„Seele“ ist einer der schillerndsten Begriffe in der Philosophie. Gewöhnlich bezeichnet man damit das, was einen Menschen unverwechselbar macht: sein Wesen, seine Persönlichkeit. Ich bevorzuge das Wort „Geist“, weil es etwas sachlicher ist und deutlicher an Intelligenz und Denken erinnert. „Seele“ und „Geist“ stehen für den idealistischen Standpunkt.
Satz:
Die hinter den Begriffen Körper/Leib und Geist/Seele stehenden Sichtweisen sind komplementär.
Die materialistische Variante anerkennt in ihrer reinen, radikalen Form allein die Materie; sie behauptet, es gebe nur den Körper.
Ein Neurochirurg, der so denkt, könnte feststellen: „Ich habe 1000 lebende Gehirne operiert, aber dem Geiz bin ich nie begegnet.“
Die idealistische Spielart anerkennt in ihrer Extremform allein den Geist.
Ein Psychologe dieses Schlags könnte bemerken: „Ich habe mit 1000 Patienten gesprochen, aber einem Hypothalamus bin ich nie begegnet.“
Die zwei Ansätze widersprechen sich; der Widerspruch verschärft sich um so mehr, je radikaler die Positionen vertreten werden.
Eine gemäßigte Ansicht stellt zum Beispiel der Epiphänomenalismus dar, der geistige Prozesse als Folgeerscheinungen materieller Vorgänge auffaßt.
Im Alltag ist es in manchen Fällen erlaubt, zu vereinfachen und ausschließlich den körperlichen Gesichtspunkt zu berücksichtigen. Wenn ein Arzt bei einer Patientin einen leichten Folsäuremangel diagnostiziert, könnte er zulässigerweise feststellen: „Ihr Körper braucht mehr Folsäure.“ In diesem Fall darf und muß man vernachlässigen, daß unter anderem dann, wenn sich am Stoffwechsel der Frau das Geringste ändert, sich Hand in Hand damit unweigerlich ihre Persönlichkeit (genauer: die Wahrscheinlichkeitsfelder ihres persönlichen Möglichkeitsraums) ein winziges bißchen verändert.
Umgekehrt kann und muß man von Fall zu Fall die Situation rein idealistisch sehen. Die Psychologin, die den Minderwertigkeitskomplex eines Patienten in Gesprächen zu beheben versucht, braucht nicht darüber nachzudenken, wie sich zugleich wiederum Hand in Hand und unweigerlich das Zusammenspiel der Neurotransmitter im Gehirn des Mannes ändert.
In dieser Hinsicht ergänzen sich die beiden Ansätze.
In jeweils gleich gemilderter oder verschärfter Lesart sind sie in vollkommener Symmetrie gleich falsch und damit gleichwertig.
Jeder Mensch ist eine mit Bewußtsein begabte, untrennbare körperlich-geistige Einheit, aber da unsere Welt komplementär ist, können wir nicht anders, als diese Einheit von komplementären Standpunkten aus zu sehen. Um solche Sichtweisen in Worte zu fassen, haben wir Begriffe wie Körper/Leib und Geist/Seele geschaffen.
In seinem empfehlenswerten Buch „Descartes’ Irrtum“ legt Antonio R. Damasio überzeugend dar, daß man unentbehrliche Fähigkeiten einbüßt, wenn das Zusammenspiel des Gehirns mit dem Rest des Menschen gestört wird oder abbricht.
Vielleicht hilft es, eine Analogie zu durchdenken:
Licht ist wie das Universum einheitlich, das heißt, es ändert nicht etwa je nach Versuchsanordnung seine Natur. Dennoch läßt sich sein Verhalten nur durch zwei miteinander unvereinbare – komplementäre – Modelle erklären: Wellen- und Teilchenmodell (Welle-Teilchen-Dualismus).
Das Licht entspricht dem Menschen, das Teilchenmodell dem materialistischen Standpunkt, das Wellenmodell der idealistischen Auffassung. Der Begriff „Teilchen“ läßt sich auf „Körper“ abbilden und „Welle“ auf „ Geist“.
Die Parallele zu unserer ursprünglichen Frage lautet:
Wie hängen Teilchen und Welle miteinander zusammen?
Der Witz besteht darin, daß weder das Teilchen- noch das dazu gewissermaßen symmetrische Wellenmodell das Phänomen Licht vollständig erfaßt: Zu beiden gibt es Experimente, deren Ergebnis mit dem jeweiligen Ansatz nicht zu erklären ist, diesem sogar widerspricht.
Genaugenommen gibt es keine Teilchen, bloß Annäherungen; genau besehen existieren keine „reinrassigen“ Wellen, sondern lediglich etwas mehr oder weniger Ähnliches. Selbst ein VW-Käfer sieht, durch die Brille der Physik betrachtet, minimal verschmiert aus, und die schönsten Wellen sind niemals chemisch frei vom Charakter eines Teilchens.
Auf unsere Ausgangsfrage übertragen:
Die Schablonen „Körper“ und „Geist“ mögen im Alltag vielfach nützlich, vielleicht unentbehrlich sein, doch verabsolutieren sie unzulässig Modellvorstellungen.
Merke: Niemals das Modell mit dem Rest der Wirklichkeit verwechseln!
Wenn schon die Begriffe – streng aufgefaßt – an der Wirklichkeit vorbeigehen, sollte man sich nicht wundern, daß die Frage, wie genau die vermeintlich dahinterstehenden Realitäten miteinander zusammenhängen, vollends in die Irre führt.
Zu fragen, wie Dinge zueinander stehen, die es letztlich nicht gibt, ist sinnlos!
5. Intelligenz und Unfehlbarkeit
Schon „Unfehlbarkeit“ ist ein mehrdeutiger Begriff; genau herauszuarbeiten, was man zweckmäßigerweise unter „Intelligenz“ verstehen sollte, wäre einen eigenen Aufsatz wert. Für dieses Beispiel genügt es, jeweils einen hoffentlich unstrittigen Gesichtspunkt zu betrachten.
Satz:
Unfehlbarkeit setzt Determinismus voraus.
Bei einfachen Problemen mit genau einer eindeutigen, in nicht zu vielen Schritten ermittelbaren Lösung – „Was ist 103 minus 5?“ – verlangt Unfehlbarkeit jedenfalls, daß das richtige Ergebnis innerhalb einer bestimmten Frist herauskommt. Ab dem Zeitpunkt, an dem sich die Frage stellt, müßte die Wahrscheinlichkeit für die Antwort „98“ bei exakt hundert Prozent liegen.
Das ist jedoch in einem nichtdeterminierten Universum wie dem unsrigen nur annähernd zu schaffen. Der geübteste Rechenkünstler kann sich vertun, auch wenn es ihm sehr selten passiert. Niemand könnte wirklich verläßlich mit Stift und Papier zwei 1000stellige Zahlen miteinander multiplizieren. Auch wenn sie oder er (in der Regel er) die Lösung herausbekäme, stünde das nicht von Anfang an fest.
Auf diesem Gebiet kommen Taschenrechner und Computer der Unfehlbarkeit sehr nahe.
Doch könnte beim Taschenrechner während des Rechenvorgangs ein LCD-Segment ausfallen, so daß aus der 98 eine 99 wird. Bei beiden Geräten können Kurzschlüsse auftreten, und ein allerdings außerordentlich unwahrscheinlicher quantenmechanischer Zufall, der das ausgegebene Ergebnis ändert, läßt sich nie vollkommen ausschließen.
Sind die Rechner fehlerfrei programmiert und auch sonst einwandfrei, spielt das alles im Alltag kaum eine Rolle.
Hundertprozentige Sicherheit gäbe es nur in einem bis ins kleinste vorherbestimmten Universum, in dem mit dem Urknall feststeht, daß die Antwort stimmen wird. In unserer Welt ist Unfehlbarkeit ein unerreichbares Ideal.
Satz:
Intelligenz setzt Indeterminismus voraus.
In einer determinierten Welt träfe einen Mörder keine Schuld, denn er hätte nicht anders handeln können. Die Vorherbestimmung entwertet genauso jede Intelligenzleistung. Intelligent kann man Verhalten nur nennen, wenn es möglich gewesen wäre, unvorteilhaftere Wege einzuschlagen. In einem vorherbestimmten All gliche der Mensch einer Marionette.
Satz:
Intelligenz und Unfehlbarkeit sind unvereinbar.
Unser Universum kann nicht zugleich determiniert und nichtdeterminiert sein. In der Quantentheorie ist zum Beispiel die Schrödingergleichung deterministisch, aber der Zufall kommt ins Spiel, sobald die Dekohärenz die Wellenfunktion ablöst, so daß die Theorie als Ganzes lückenlose Vorherbestimmtheit – und damit erst recht Berechenbarkeit ohne Wahrscheinlichkeiten – ausschließt: Das Weltall ist keine Schweizer Uhr, die einmal aufgezogen vorherbestimmt abläuft.
Während Unfehlbarkeit unerreichbar bleibt, gibt es Intelligenz nicht nur als Idealvorstellung: Michelangelo war intelligent!
Die Gleichwertigkeit der zwei Ansätze müssen wir somit verneinen.
Satz:
Intelligenz und Unfehlbarkeit sind nicht komplementär.
6. Innen- und Außenperspektive
Definitionen:
Innenperspektive heißt das Bild, das sich ein Mensch von sich selbst macht.
Außenperspektive heißt die Gesamtheit aller Bilder, die sich alle anderen Menschen von jemand machen.
Die beiden Begriffe sind subjektiv (vom Beobachter abhängig).
Satz:
Innen- und Außenperspektive sind komplementär.
Angenommen, ich habe starken Hunger. Aus meiner Sicht spüre ich unmittelbar ein starkes Gefühl und bin mir dessen sicher. Jeder andere, dem ich das mitteile und der es sich vorstellt, kann nicht anders, als seine eigene Erfahrung von Hunger in sein Bild von mir zu projizieren. Dieselbe Tatsache erscheint für mich unmittelbar und gewiß, für jeden anderen unabänderlich mittelbar – sich den Sachverhalt vorzustellen erfordert, sich in mich hineinzuversetzen – und mehr oder weniger ungewiß – niemand kann jemals mit letzter Sicherheit ausschließen, daß ich ihm den Hunger vortäusche oder darunter etwas völlig anderes verstehe als er.
Innen- und Außenperspektive widersprechen sich.
Wer eine Biographie Mozarts schreiben will, sollte unter anderem anhand von Tagebuchnotizen, Briefen und Äußerungen darzulegen versuchen, wie das Musikgenie sich selbst sah, und gleichberechtigt, was der Rest der damaligen Gesellschaft von ihm dachte.
Jeder von uns sieht sich selbst unentrinnbar ausschließlich aus der Innenperspektive. Alles vermeintlich andere, etwa unter Rauschgifteinfluß oder bei Nahtoderlebnissen, ist Selbsttäuschung, auch wenn mancher noch sooft gegen die Mauern des eigenen Ich anrennt! Alle anderen erscheinen jedem ebenso unabänderlich ausschließlich in der Außenperspektive. Mögen sich Liebende noch sosehr in der Illusion aalen, sie seien eins: Es stimmt nicht.
Innen- und Außenperspektive ergänzen sich.
Die Innenansicht ist unentbehrlich dafür, am Leben zu bleiben, die Außenansicht genauso wichtig: Eine Gesellschaft, in der sich nicht die meisten laufend die Welt einiger ihrer Mitmenschen auszumalen suchen, kann einpacken!
Innen- und Außenperspektive sind gleichwertig.
7. Linke und rechte Gehirnhälfte
Satz:
Linke und rechte Gehirnhälfte sind komplementär.
Die „Widersprüchlichkeit“ der beiden Hälften der Großhirnrinde ist harmlos: Die linke Hemisphäre steht eher für analytisch-logisches, die rechte mehr für ganzheitlich-assoziatives Denken und Fühlen. Keine kann die andere annähernd ersetzen: Patienten, denen eine Gehirnhälfte entfernt wurde, leiden in beiden Fällen unter charakteristischen Ausfallerscheinungen.
Die zwei Hälften ergänzen sich zu einer Einheit, die vom materialistischen Standpunkt aus als vollständiges Gehirn erscheint, aus der idealistischen Sicht zu Recht als einheitliche Persönlichkeit empfunden und angesehen wird.
Der linke und der rechte Teil verständigen sich laufend über den sogenannten Balken, jenes Nervengeflecht, das die zwei miteinander verbindet. Patienten, denen dieser Balken amputiert werden mußte (zum Beispiel bei einigen schweren Formen von Epilepsie) zeigen ebenfalls typische Ausfallerscheinungen.
Keine von beiden Hälften ist grundsätzlich wichtiger oder leistungsfähiger als ihr Gegenstück. Allerdings variiert das Kräfteverhältnis zwischen Links und Rechts von Mensch zu Mensch und im Laufe eines Lebens. Betont einseitige Persönlichkeiten haben es schwerer. In unserer Gesellschaft überwiegt zur Zeit wohl die „linke“ Sicht der Dinge.
8. Kooperation und Konkurrenz
Literatur: Spektrum der Wissenschaft, „Kooperation und Konkurrenz“, Heidelberg 1998.
Kooperation bedeutet spieltheoretisch soviel wie Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung. Konkurrenz steht für Sichausstechen und Verweigern der Zusammenarbeit.
Satz:
Kooperation und Konkurrenz sind komplementär.
Die beiden Gegenpole widersprechen sich: Bei einer spieltheoretischen Situation, in der man einem Mitspieler entweder eine Mark geben kann oder nicht, schließen sich die beiden Alternativen gegenseitig aus. Je mehr man kooperiert, desto weniger konkurriert man, und umgekehrt.
Kooperation und Konkurrenz ergänzen sich: Treten in einem spieltheoretisch-evolutionären Wettbewerb verschiedene Strategien gegeneinander an, zeigt sich, daß die erfolgreichsten auf beide Möglichkeiten zurückgreifen, je nachdem, was der Mitspieler tut.
In dieser Hinsicht sind die beiden Grundrichtungen auch gleichwertig. Auf keine kann eine erfolgreiche Strategie verzichten. Je nach Gegner kann sogar stures Aussteigen oder ausnahmsloses Kooperieren die meisten Punkte einbringen.
Die zwei Begriffe erinnern an Gut und Böse, decken sich aber nur zum Teil damit. Besiegt in einem Turnier mit vielen Strategien ein im wesentlichen kooperatives Programm einen andersgearteten Gegner, fällt dies unter „Konkurrenz“; dennoch empfinden wir das als gut, weil es sowohl dem kooperativen Programm nützt als auch den Strategienpool ethisch gesehen verbessert. Bei einem Kartell kooperieren die Beteiligten; wir beurteilen das mit Recht als unanständig, da sich einige auf Kosten des Restes der Gesellschaft bereichern.
Meines Erachtens sind Gut und Böse Anschauungsformen, die sich in der Evolution des Menschen unter dem Selektionsdruck herausgebildet haben und vor allem helfen, mit den Widersprüchen zwischen Einzel-, Gruppen- und gesamtgesellschaftlichen Interessen, auch auf gleicher Ebene, fertig zu werden.
Diese beiden schillernden, äußerst gefühlsbesetzten Worte eignen sich nicht, damit naturwissenschaftlich zu arbeiten, und sind philosophisch mit Vorsicht zu genießen! Der folgende Gedanke ist ein Aphorismus, keine Folgerung:
Das Leben ist gerade schlimm genug, um jede Hoffnung auf ein Paradies für immer zunichte zu machen, und gerade gut genug, um es nicht besser von vornherein bleiben zu lassen.
9. Rational-nüchternes und dramatisch-erotisches Verhalten (Verstand und Gefühl)
Satz:
Rational-nüchternes und dramatisch-erotisches Verhalten sind komplementär.
Den Ausdruck „dramatisch-erotisch“ hat sich mein Freund Stefan S. ausgedacht. Ihm gebührt es, den Begriff in einer philosophischen Arbeit zu entfalten und seine Nützlichkeit nachzuweisen.
10. Punkt der Erkenntnis und Punkt bestmöglicher Aussichten
Laut psychologischen Studien stehen die Chancen im Leben am besten, wenn man die eigenen Möglichkeiten deutlich, teils sogar kraß, überschätzt (Punkt bestmöglicher Aussichten). Jenseits davon fängt Leichtsinn, noch weiter draußen Größenwahn an; jenseits des Punktes, an dem man seine Möglichkeiten genau richtig einschätzt (Punkt der Erkenntnis), beginnen grundlose Angst und Selbstzerfleischung.
Satz:
Standpunkt der Erkenntnis, Standpunkt bestmöglicher Aussichten und alle Zwischenzustände sind komplementär.
Die Standpunkte widersprechen sich, weil sie sich gegenseitig ausschließen. Man kann nicht einmal beliebig hin- und herpendeln: „Auch im Denken gibt es einen Point of no return.“
Erkenntnis und bessere Fortpflanzungschancen gehen nur bis zu einem bestimmten Punkt Hand in Hand. Auf der Ebene des einzelnen Menschen mag es für die meisten in Krisen erträglicher sein, die Welt durch eine rosa getönte Brille zu sehen und so eher zu überleben – biologisch: sich mit höherer Wahrscheinlichkeit fortzupflanzen. Solange eine Schönwetterperiode anhält, kann mancher sich den Luxus ungeschminkter Wahrheit gönnen. Auf der Ebene der Menschheit überlebt ein Ensemble verschiedener Charaktere eher als eine Monokultur.
Die beiden Sichtweisen und alle Zwischenzustände ergänzen einander.
Anerkennt man Selbsterkenntnis und optimale Chancen als Werte, ist es Geschmackssache, welchen man wie gewichtet. Unter dieser Bedingung sind alle Punkte zwischen den beiden Grenzen gleichwertig.
11. Natürliche Sprachen
Mit dieser Bezeichnung grenze ich eine gewachsene, lebende allgemeine Umgangssprache (zum Beispiel Spanisch) gegen Kunstsprachen (PASCAL) ab.
Literatur: Ludwig Reiners, „Stilkunst“, C. H. Beck, Kapitel „Glanz und Elend der deutschen Sprache“.
Dieses vorzügliche Buch müßte im Deutschunterricht ein volles Jahr besprochen und guter Stil wieder und immer wieder geübt werden – was man in Deutschland viel zu oft liest und hört, schreit danach. Wie bei so vielem hat hier die Schule zu meiner Zeit versagt.
Satz:
Die natürlichen Sprachen sind komplementär.
Inwiefern „widersprechen“ sich diese Sprachen?
Jeder gute Übersetzer wird Ihnen bestätigen: Es ist unmöglich, in der Übertragung etwa eines Romans aus dem Englischen ins Deutsche exakt das und nur das wiederzugeben, was im Original steht.
Auf Schritt und Tritt in Schwierigkeiten gerät man bereits auf der Ebene einzelner Worte, weil sie sich nie genau entsprechen. Manche Sprachspiele verweigern sich jeder Übertragung, und wer wollte eine Entsprechung zu einem Titel wie „Primary colors“ finden? In solchen Fällen bleibt einem nur übrig, sich einen völlig neuen Titel auszudenken.
Umgekehrt: Wie man auf englisch das Verb „walten“ ausdrückt, erschließt sich erst aus dem Zusammenhang: to dispose, to govern, to rule – oder umschreiben. Bei einer Übersetzung Originaltreue und Stilsicherheit zu versöhnen gehört zu den großartigsten Leistungen menschlicher Intelligenz.
Inwieweit ergänzen sich die Sprachen?
Verglichen mit Englisch und Französisch, glänzt Deutsch unter anderem mit dem größten Wortschatz („Schrotschußtherapie“, „schöntrinken“). Man philosophiere auf deutsch, komponiere Opern auf italienisch, schreibe Gebrauchsanleitungen auf englisch!
Die natürlichen Sprachen sind gleichwertig: Jede hat ihre Stärken und Schwächen (Deutsch unterliegt Französisch, was die Schärfe der Begriffe betrifft), keine ist der anderen grundsätzlich vorzuziehen. Welche sich am besten eignet, richtet sich nach dem Einzelfall.
12. Frau und Mann
Ein unerschöpfliches Thema ...
Literatur: Prof. Dr. phil. Gertrud Höhler/Dr. med. Michael Koch, „Der veruntreute Sündenfall“, Deutsche Verlagsanstalt 1998.
Dieses monumentale Werk sollte an den Gymnasien zum Pflichtstoff gehören!
Satz:
Frau und Mann sind im Prinzip komplementär.
Wir untersuchen hier nur den Normalfall und ignorieren Homo-, Bi- und Asexualität sowie genetische Sonderfälle (XXY, ...).
Wie gut sich Frau und Mann ergänzen können, beweisen die wenigen wirklich harmonischen Beziehungen. In einer glücklichen addieren sich die Stärken, in einer unglücklichen die Schwächen.
Die Widersprüchlichkeit zwischen den Geschlechtern zeigt sich in unlösbaren Interessenkonflikten. Solche Probleme lassen sich auf Dauer nur lösen, wenn beide Partner nachgeben – oder mal der eine, mal der andere. Es gibt aber keinen Kompromiß, der beide hundertprozentig zufriedenstellt.
Zum Beispiel neigen Männer aus biologischen Gründen im Mittel merklich stärker dazu fremdzugehen als Frauen. Der Unterschied wird gern überschätzt (auffallend gleichbleibend stammen in allen Gesellschaften rund zehn Prozent aller Kinder nicht vom vermeintlichen Vater – „Kuckuckseier“), aber es gibt ihn, und nichts wird ihn aus der Welt schaffen.
Solange es Menschen gibt, wird man darüber streiten, ob ein Geschlecht dem anderen grundsätzlich überlegen ist – bei enormen Abweichungen im Einzelfall. Ich habe selbst jahrelang geglaubt, der Durchschnittsmann unterliege der Durchschnittsfrau.
In der Tat verteidigt sich diese Ansicht mit schweren Geschützen: Frauen leben statistisch deutlich länger, bringen sich viel seltener um, gebären Kinder und fühlen in der Regel wesentlich tiefer und vielseitiger als Männer.
Und doch stimmt die Behauptung nicht.
Die genialsten Einsichten und Theorien in Wissenschaft und Philosophie, die größten Kunstwerke der Menschheitsgeschichte sind zu 95 % den Männern gutzuschreiben – das reißt alles heraus, selbst wenn man diese Geniestreiche „verdünnt“, also durch die Zahl aller Männer teilt! Es gibt nur Väter der Quantentheorie, der Relativitätstheorie, der Evolutionstheorie. Als es nach über 300 Jahren Andrew Wiles gelang, Fermats letzten Satz zu beweisen, stützte sich der Mathematiker auf die Vorarbeit etlicher anderer Genies, darunter eine einzige Frau.
Diese Einseitigkeit liegt zum Teil daran, daß Frauen von jeher benachteiligt werden. Am Ende des 20. Jahrhunderts trennen uns trotz beträchtlicher Fortschritte noch immer Abgründe von wahrer Gleichberechtigung.
Doch selbst in der besten aller möglichen Welten hätte Frau Höhler recht: Das Periodensystem der Elemente wäre viel später oder nie entdeckt worden, gäbe es keine Männer. Lebenslang zäh um künstlerischen Ausdruck, um philosophische und wissenschaftliche Erkenntnis zu ringen, rastlos nach der Wahrheit zu suchen – das bleibt für immer eine Domäne der Männer, mag auch der Anteil der Frauen im Idealfall auf, sagen wir, 10 % steigen.
Die Geschlechter sind sich ebenbürtig.
13. Demokratische Rechtsordnung und Selbstjustiz in Ausnahmefällen
Unter demokratischer Rechtsordnung verstehe ich die Gesamtheit aller Rechtsnormen (Verfassung, Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Verwaltungsvorschriften, ...) in einem Staat, der in keinem Punkt wesentlich davon abweicht, was deutsche Verfassungsrechtler unter Demokratie verstehen.
Literatur:
In seinem vom ersten bis zum letzten Kapitel atemberaubenden Thriller Jagdzeit (englisch Open Season) erzählt David Osborn von drei angesehenen Ehemännern, die jedes Jahr in ein abgelegenes Naturparadies im Norden Michigans verreisen. Auf dem Weg dorthin entführen sie jedesmal ein Pärchen, lassen Tage später ihre beiden Opfer mit knappem Vorsprung laufen und jagen die zwei auf Leben und Tod. Jemand nimmt sich des Falls an ...
Satz:
Demokratische Rechtsordnung und Selbstjustiz in bestimmten Ausnahmefällen sind komplementär.
Unser Recht und Selbstjustiz widersprechen sich aufs schärfste: Einen Menschen zu töten ist zum Beispiel nur in seltenen Notfällen, bei akuter Gefahr, erlaubt. In zivilisierten Ländern steht das Gewaltmonopol dem Staat zu, von wenigen Ausnahmen abgesehen (unter anderem Notwehr, Notstand, verbotene Eigenmacht). Der Staat kann seinen Bürgern auf keinen Fall grundsätzlich gestatten, vermeintliches oder tatsächliches Recht in die eigene Hand zu nehmen, weil sich sonst viel zu viele zum Hilfssheriff berufen fühlten und das Ganze in Anarchie ausarten würde.
Die beiden Ansätze sind vollkommen unvereinbar.
Dennoch und deswegen ergänzen sich die Gegenpole zur bestmöglichen Annäherung an Gerechtigkeit, wenn sich die Selbsthilfe eng beschränkt. Als eingefleischter Demokrat – ich halte Demokratie für die beste aller Staatsformen – bin ich mir bewußt: Dieser hochbrisante Standpunkt verlangt im Ernstfall sorgfältigstes Abwägen!
Das hervorstechenste Beispiel für juristisch unzulässiges, moralisch einwandfreies eigenmächtiges Richten ist es wohl, einen Tyrannen zu beseitigen. Daß eine gewisse Frau Bachmann vor ungefähr zwanzig Jahren den Mörder ihres Kindes im Gerichtssaal erschoß, ist dagegen schon moralisch nicht in Ordnung – als Richter hätte ich die Täterin so milde wie gerade noch mit dem Gesetz vereinbar bestraft.
Bei Florenz erschossen die „Liebespaarmörder“ zwischen 1968 und 1994 acht Paare, darunter ein vermeintliches. Einen der drei Verbrecher verurteilte man 1994 zu lebenslänglich; er wurde 1996 in einem Berufungsverfahren freigesprochen und hätte 1998 erneut angeklagt werden sollen, starb aber kurz vorher. Seine beiden Komplizen erhielten 1998 lebenslänglich und 30 Jahre.
Angenommen, ein glaubwürdiger, unbescholtener Freund hätte sich Ihnen anvertraut, der die Täter auf frischer zweiter Tat gesehen, deren Leben und Gewohnheiten studiert und gedanklich ein Psychogramm der Monster entworfen hätte. Weiter angenommen, Ihr Freund hätte Ihnen angekündigt, er werde jedem der Mörder eine Kugel zwischen die Augen schießen, ohne gerichtsfeste Beweise zu besitzen.
Ich frage Sie: Wären Sie zur Polizei gegangen, wenn diese Ihren Freund aufhalten könnte?
Ich hätte sorgfältig überlegt: Auch weil sie so selten zuschlugen, würden die Psychopathen vermutlich noch lange unentdeckt bleiben; die Chancen der Polizei, sie, sagen wir, binnen eines Jahres zu schnappen, standen auf absehbare Zeit verdammt schlecht. Weitere Leichen würden ihren Weg pflastern. Ich hätte über meinen Freund nachgedacht und entschieden, er werde auch künftig keine Gefahr für die Gesellschaft darstellen. Ich hätte nicht eingegriffen.
Im Idealfall sind Recht und Selbstjustiz moralisch unanfechtbar und insofern gleichwertig. Auf keines von beiden kann man verzichten, wenn das Böse soweit wie möglich in Schach gehalten werden soll; wenn irgend möglich, sind rechtsstaatliche Methoden anzuwenden! Wer sich anschickt, Gott zu spielen, hantiert mit einem der gefährlichsten Gifte der Welt! Bleibt, von einem radikalen Skeptizismus abgesehen, der geringste Zweifel oder sind Sie persönlich nicht dafür geeignet: Stellen Sie das Fläschchen zurück in den Giftschrank, und gehen Sie Ihrer Wege!
Als überzeugter Atheist glaube ich meinen Standpunkt vertreten zu dürfen – auch wenn ich schon wegen nachweislicher Justizirrtümer energisch gegen die staatlich vollstreckte Todesstrafe eintrete.
Mit dieser Bewußtseinsspaltung muß ich leben. Und wenn die Allmachtsideologen tausendmal das Gegenteil behaupten – manchen Zwickmühlen entkommt man nie.
IV. Folgerungen
Erinnern wir uns an einen Satz aus III.5:
Intelligenz setzt Indeterminismus voraus.
Weiter gilt:
Jede Turing-Maschine arbeitet rein deterministisch.
Siehe dazu Roger Penrose, „Computerdenken“, Spektrum, Heidelberg 1991, S. 35.
Aus beiden Feststellungen folgt der
Satz:
Keine Turing-Maschine ist intelligent.
Damit stehen wir kurz vor dem Ziel:
„... die heutigen Computer sind jedenfalls bemerkenswert gute Annäherungen an Turings Idealisierung“ (Penrose, S. 34).
Inwiefern unterscheiden sie sich vom gedachten Idealfall?
1. Bei unseren Rechnern können Hard- und Software fehlerhaft sein.
2. Sie verfügen über begrenzte Rechnerleistung und Speicherplatz.
3. Sie können nicht beliebig lang arbeiten.
Wenn wir von der Turing-Maschine zum Computer übergehen, kann Intelligenz ins Spiel kommen? Nein: Ein Kurzschluß, ein Staubkörnchen in der Festplatte oder ein Programmierfehler verleihen der Maschine keine Intelligenz; die Unterschiede schränken ihre Leistungsfähigkeit gegenüber dem Modell ein.
Wir erhalten eine Folgerung von enormer Tragweite:
Satz:
Kein noch so leistungsfähiger Computer heutiger Bauart kann intelligent sein.
Der Schlüssel zur Intelligenz muß im Indeterminismus zu finden sein. Die einzige anerkannte nichtdeterministische Theorie in der Physik ist die Quantentheorie. Es liegt nahe zu vermuten:
Intelligenz und Quantentheorie hängen miteinander zusammen.
Ich halte es für durchaus möglich, daß eines Tages der erste Androide mit Persönlichkeit gebaut wird. Meiner Meinung nach wird sich die Architektur seines Gehirns grundlegend von der heutiger Computer unterscheiden.
Unseren Rechenanlagen wird Intelligenz für immer unerreichbar bleiben. Dies dürfte philosophisch gesehen daran liegen, daß die Turing-Maschine die Komplementarität unseres Universums in sich selbst unzureichend abbildet (III.2, 7, 9). Soviel ich weiß, ist bei allen höherentwickelten Tieren das Gehirn zweigeteilt. Könnte es sein, daß diese Besonderheit ab einem bestimmten Entwicklungsstand zwangsläufig auftritt?
Ein Professor der LMU München hat behauptet: „Auf dem Markt sind nur Zufall und Notwendigkeit; das läßt keinen Platz für Freiheit.“
Wir erkennen den Denkfehler: Professor X verwechselt Zufall mit Wahllosigkeit und Notwendigkeit mit Determinismus. Wie wir gesehen haben, schließt Determinismus Freiheit aus. Welche Augenzahl ein Würfel zeigt, hat mit menschlicher Selbstbestimmung nichts zu tun. Aber Zufall und Notwendigkeit im Sinne meiner Definition stecken im Leben den Rahmen der Freiheit ab.
Wenn ich ein Rechengenie frage: „Was ist 10 mal 10?“ und die Antwort „100“ erhalte, ist das Notwendigkeit.
Angenommen, eine Frau muß sich zwischen zwei Heiratskandidaten A und B entscheiden. Derzeit betrage die Wahrscheinlichkeit unter der Bedingung, daß sie jemals genau einmal genau einen von beiden heiratet und beide ihre Entscheidung erleben, knapp 60 % für A und gut 40 % für B. Erhört die Angebetete einen der Männer, ist das Zufall.
In den zwei Beispielen sind die Beteiligten so frei – Freiheit heißt Reichhaltigkeit des persönlichen Möglichkeitsraums –, wie man im Leben sein kann, einschließlich der Gefahr, sich zu verrechnen oder für den falschen Kandidaten zu entscheiden. „Am Steuer ist man zu einem kleinen Teil schon frei“ (Stanislaw Lem).
Satz:
Kein Computer heutiger Bauart vermag allgemeine Texte (Sachliteratur, Romane, Dramen, Lyrik usw.) zugleich originalgetreu und stilsicher von einer natürlichen Sprache in eine andere zu übersetzen.
Trotz miserabler Ergebnisse hält man bis heute an diesem Ziel fest.
Warum scheitern alle Versuche, ausschließlich mit Computern zu übersetzen?
Unsere Rechner hängen den Menschen locker ab, wenn es darum geht, Unmengen formalisierbarer Daten so schnell wie möglich zu verarbeiten. Eine natürliche Sprache ist aber notorisch informal; darin liegt ihre Stärke und Schwäche. Wörter haben niemals vollkommen scharf umrissene Bedeutungen, und oft gibt es keine genauen Regeln: Von Ausnahmen abgesehen, überfordert Sprache den Computer.
Wenn es, wie ich glaube, Intelligenz erfordert, zugleich präzise und elegant zu übersetzen, sind Rechenanlagen dem auf keinen Fall gewachsen. Die Aufgabe ist so schwer, daß sie nur die sprachlich Begabtesten von uns meistern.
In Abschnitt III.4 schrieb ich dem Menschen Bewußtsein zu.
Definition:
Bewußtsein heißt die Gesamtheit der obersten Ebenen des Vorgangs, mittels dessen ein genügend komplexes, seinen Aufbau- und Ablaufprinzipien nach nichtdeterministisches informationsverarbeitendes System laufend danach strebt, sein Abbild des Universums einschließlich seiner selbst der Wirklichkeit anzupassen.
Wir „spüren“ nur die obersten Schichten, sonst versänken wir im Chaos, ähnlich, wie jemand nichts damit anfangen könnte, im Rahmen der Unbestimmtheitsrelation über jedes einzelne Atom und Molekül seiner Katze Bescheid zu wissen. Bewußt erleben wir materialistisch gesehen ungefähr die Ebenen von größeren Nervenzellverbänden bis zum Gehirn als Ganzes und ihre Wechselwirkungen auch auf gleicher Stufe, idealistisch betrachtet etwa die vom Gedanken oder Gefühl bis zum Gesamtgeisteszustand sowie die entsprechenden Wechselwirkungen.
Bewußtsein gleicht im Ebenenmodell des Menschen einer „Oberfläche“ und Schnittstelle zum gesamten Universum einschließlich seiner selbst. Entgegen früheren Annahmen beschränken sich Bewußtsein, Intelligenz und Persönlichkeit keineswegs auf das Großhirn (siehe Damasio und Prof. Dr. Hans Goller, „Das Rätsel von Körper und Geist“)[2004].
Bewußtsein ist ein Vorgang, kein Zustand. Vor allem im Schlaf verarbeitet und ordnet das Gehirn Eindrücke und Erfahrungen: Entgegen dem üblichen Sprachgebrauch ist Schlaf als Sonderform des Bewußtseins anzusehen.
Nach meinem Dafürhalten erfüllen auf jeden Fall höherentwickelte Tiere, vermutlich sogar etliche Pflanzen das Kriterium hinreichender Komplexität.
Den eher nach Informatik klingenden Ausdruck „informationsverarbeitendes System“ habe ich gewählt, damit die Begriffsbestimmung auch mögliche Androiden erfaßt.
Information bedeutet objektiv beseitigte Ungewißheit: Genau eine von mehreren Möglichkeiten tritt ein (wird verwirklicht), ohne Rücksicht darauf, ob ein Bewußtsein – ein Beobachter – dies zur Kenntnis nimmt.
Somit gibt es unzugängliche Information. Beispiele: die Antwort auf die Frage nach der Existenz Gottes (naturgesetzlich unzugänglich) und die Angabe von Cäsars Rhesusfaktor (verlaufsbedingt unzugänglich).
Bewußtsein beginnt in aller Regel Hand in Hand damit, daß sich das Gehirn im vierten und fünften Schwangerschaftsmonat in seinen Grundzügen ausbildet, und endet ausnahmslos mit dem Tod.
Daher befürworte ich die grundsätzliche Dreimonatsfrist im deutschen Abtreibungsrecht (vorpersonales Leben).
Ich vertrete einen verschärften Monismus.
Gemäßigtere Abarten sind der Physikalismus (jedem Bewußtseinszustand entspricht genau ein physikalischer Gehirnzustand) und die Identitätstheorie (Leib und Seele sind eins).
Nach meinem Weltbild gehen diese Auffassungen in die richtige Richtung: weg vom Dualismus Descartes’, an dem die Schulmedizin bis heute festhält – aber nicht weit genug. Beide anerkennen noch immer physikalische und geistige Zustände des Menschseins. Das bleibt strenggenommen selbst denn falsch, wenn man diese für identisch erklärt.
Der Mensch wechselwirkt mit sich selbst – aber nicht seine stoffliche mit der geistigen Seite, sondern seine Ebenen, von der untersten, elementarsten bis zur obersten, ganzheitlichsten, untereinander und mit sich selbst.
Satz:
Es gibt keine psychophysischen Wechselwirkungen.
Wie wir gesehen haben, setzt Bewußtsein enorme Komplexität voraus. Hingegen kommt die Materie schon auf der elementarsten Ebene, der Elementarteilchenstufe, ins Spiel.
Bewußtsein erscheint also erst auf einer weit höheren Ebene als Materie. Jedes Bewußtsein läßt sich vom materialistischen Standpunkt aus betrachten, auch wenn man jenem nicht gerecht wird, wenn man sich auf diese Sichtweise beschränkt.
Satz:
Es gibt kein Bewußtsein, das sich nicht auch rein materialistisch betrachten läßt.
Damit verweisen wir sogenannte Astralwesen, Geister und andere angeblich nichtkörperliche Geschöpfe dahin, wo sie hingehören: ins Reich des Märchens.
Jeder Mensch ist eine untrennbare körperlich-geistige Einheit, aber das bewahrt ihn nicht davor zu sterben.
Satz:
Es gibt kein Leben nach dem Tod.
Wenn jemand stirbt, zerfällt materialistisch gesehen ihr oder sein Gehirn – und damit ein Bewußtsein – unwiederbringlich innerhalb von etwa 15 Minuten. Völlig zu Recht haben sich die Ärzte 1968 auf das Hirntodkriterium geeinigt: Ein Mensch ist tot (nicht: gilt als tot), wenn sich im gesamten Gehirn keine elektrischen Ströme mehr nachweisen lassen. Wenn substantiell gesehen der Körper sich im und nach dem Tod endgültig auflöst, dann erlischt idealistisch betrachtet der Geist, die Seele oder was auch immer. Etwas anderes anzunehmen würde die Gleichwertigkeit der Standpunkte verletzen und widerspräche damit dem Hauptsatz.
Aus der Außenperspektive erleben wir das Vergehen eines Bewußtseins ebensowenig mit wie jeden Vorgang in ihm. Aus der Innenperspektive läßt sich der Tod weder beobachten noch vorstellen: Sich irgend etwas vorzustellen oder es zu beobachten setzt das eigene Bewußtsein voraus. Der Tod ist jedoch gerade der Vorgang, bei dem dieses Bewußtsein erlischt.
Satz:
Der eigene Tod ist die Singularität des Bewußtseins.
Unser Universum wird den Entropietod sterben.
Seit 1998 sind sich die Kosmologen weitgehend sicher: Das All wird sich ewig und sogar immer schneller ausdehnen. Das letzte Stadium unseres Weltalls sieht so aus: nichts außer extrem vereinzelten stabilen Elementarteilchen und etwas Strahlung in einem sich unaufhörlich ausdehnenden Raum. Selbst die Schwarzen Löcher sind nach unvorstellbar langer Zeit explodiert.
Die Wahrscheinlichkeit, daß dann jemals wieder etwas Erwähnenswertes passiert, liegt so nahe bei 0, daß wir diese Welt als einmal aufgezogene, für immer abgelaufene Uhr betrachten müssen.
Mit dieser Arbeit möchte ich auch zeigen, wie weltfremd Ideale wie Allwissenheit und Unsterblichkeit sind. Lange, lange vor dem Endstadium unseres Alls wird es unmöglich geworden sein, die zirka 100 W–150 W Leistung in geeigneter Form bereitzustellen, die ein Erwachsener braucht, um zu überleben.
Passen Frau und Mann zusammen?
Es kommt darauf an, was man damit meint.
Versteht man unter „zusammenpassen“ eine Beziehung ohne Meinungsverschiedenheiten, Interessenkonflikte und Mißverständnisse, passen die Geschlechter unbehebbar nicht zusammen.
Dagegen ergänzen sich im Einzelfall Frau und Mann mit ihren Stärken zum evolutionär bestmöglichen Team. (Das Optimum liegt bei zwei Geschlechtern im Verhältnis 1:1.) Hinzu kommt der unschätzbare Vorzug, daß bei der sexuellen Fortpflanzung in jeder Generation die Gene von neuem durchmischt werden. So gesehen passen Frau und Mann perfekt zueinander.
Nach der Komplementaritätstheorie ist es aussichtslos, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern einebnen zu wollen. Wer das versucht, stürzt die Menschen ins Unglück! Wir müssen – und dürfen – damit leben:
Dieselbe Quelle, die den Geschlechtern untereinander ständig Ozeane von Leid beschert (welcher Horror allein hinter dem Ausdruck ungepaarte Individuen lauert!), sorgt für die Anziehungskraft und das Prickeln zwischen Frau und Mann. Was wäre das Leben ohne Liebe!
Wählen Sie eines der folgenden Beispiele, und weisen Sie die Komplementarität nach:
a) Verbindlichkeit und die in der jungen Generation verdächtig hochgelobte Spontaneität
b) Verteidigung und Anklage vor Gericht
c) Vertrauen und Kontrolle
d) Menge und Güte (Quantität und Qualität)
e) Holismus und Reduktionismus
f) Generalismus und Spezialismus
g) Internalismus und Externalismus
h) Behaviorismus und Genetizismus
i) Schulmedizin und alternative Medizin
j) die Arten der Psychotherapie
k) Gewissenhaftigkeit und Sorglosigkeit in der medizinischen Vorsorge (SZ-Magazin 49/2002)
l) die Formen des Wachens und Schlafens
m) die menschlichen Lebensalter (DIE ZEIT, April 2002)
n) die beiden Halbstränge der menschlichen DNS (DIE ZEIT, November 2000)
o) Individualismus und Kollektivismus
„Das Gegenteil der Hölle ist die Hölle“ (von mir). Erörtern Sie.
„Man soll die Dinge so einfach sehen, wie sie sind, aber nicht einfacher.“
Albert Einstein
Ich hoffe, es ist mir gelungen zu zeigen, wie die Komplementarität unser aller Leben berührt, gestaltet, prägt.
Was kann man aus diesem Hauptsatz der Philosophie lernen?
Eine vorletzte Folgerung daraus:
Satz:
Zu jeder hinreichend aussagekräftigen allgemeinen Verhaltensregel gibt es mindestens ein Gegenbeispiel.
Diese Formulierung erinnert an den Gödelschen Satz. Entweder man nimmt das Gegenbeispiel, also einen Widerspruch, hin und befolgt in jedem Fall die Anweisung, oder man opfert die Vollständigkeit und prüft in jedem Einzelfall, ob man sich an die Regel hält.
Zu abstrakt? Einige Beispiele:
Kants kategorischer Imperativ lautet:
„Handle so, daß die Maxime deines Wollens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte.“
Eine ausgezeichnete Verhaltensregel! Gegenbeispiele:
1. siehe Osborn
2. Ein Biologieprofessor entdeckt insgeheim eine Methode, mit der er das Geschlecht der zwei Kinder, die seine Frau und er sich wünschen, sicher vorherbestimmen kann. Schon zuvor hätten beide zwei Mädchen vorgezogen. In dem Land, in dem das Ehepaar lebt, wünschen sich die Paare insgesamt deutlich mehr Jungen als Mädchen (zum Beispiel in Deutschland und Indien).
Der Professor erzählt seiner Frau von der Entdeckung. Diese bringt mit Hilfe des Verfahrens zwei Töchter zur Welt. Ihr Mann vernichtet sämtliche Aufzeichnungen und verwischt alle Spuren. Beide bewahren bis zu ihrem Tod absolutes Stillschweigen über die Angelegenheit.
Der Professor und seine Gattin verhalten sich moralisch absolut einwandfrei:
Sie schaden nicht im geringsten der Gesellschaft, da die zwei Mädchen im Zufallsrauschen eines x-Millionen-Volks untergehen.
Man kann auch nicht argumentieren, durch die Bestimmung des Geschlechts verletzten die beiden das Lebensrecht andernfalls geborener Kinder. Diese ungezeugten Kinder sind keine existierenden Personen, sondern bloße Punkte im Möglichkeitsraum, denen insbesondere kein Recht auf Verwirklichung, das heißt Leben, zusteht.
Das Stillschweigen des Ehepaars ist ebenfalls in Ordnung. Veröffentlichte man die Erfindung, würden die meisten Paare das Geschlecht ihrer Kinder festlegen wollen. Dann verschöbe sich das Verhältnis der Geschlechter spürbar zugunsten der Männer, mit schlimmen Folgen: mehr Einsamkeit, mehr Vergewaltigungen, Pflegenotstand und andere Tragödien.
Wegen solcher Folgen darf kein Gesetz jedem erlauben, das Geschlecht seiner Kinder frei zu wählen. Auch ein 1:1-Verhältnis bei der Summe aller Kinderwünsche könnte sich jederzeit ändern.
Letztes Jahr verbrachte ich ein Wochenende bei einem weit entfernt wohnenden Ehepaar, das ich vorher nicht gekannt hatte. Wie sich herausstellte, litt (und leidet, soweit ich weiß) die Frau unter Verfolgungswahn, einer Form der Schizophrenie – daran hätte kein gebildeter Laie gezweifelt.
Ich beschwor den Mann der Bedauernswerten, etwas zu unternehmen, doch der brachte es nicht über sich, obwohl er einsah, daß seine Ehefrau ernstlich krank war. Deprimiert fuhr ich nach Hause.
Eine Freundin von mir meinte dazu: „Solange die Leute nicht gemeingefährlich sind, soll man sie in Ruhe lassen.“ – Falsch! Wer so denkt, macht es sich zu leicht!
An Stelle des Ehemanns hätte ich sorgfältig abgewogen: Die Kosten einer Zwangsbehandlung dürfen in solchen Fällen keine Rolle spielen; in der Regel zahlt die Krankenkasse anstandslos, wenn ein nervenärztliches Gutachten vorliegt. Notfalls hätte ich die Mehrkosten etwa für bessere Medikamente selbst getragen.
Hätte ich die Kranke gegen ihren Willen einweisen und behandeln lassen, hätte das ihre Qualen zunächst erheblich gesteigert.
Aber nach einer Zwangseinweisung wäre sie mit starken Psychopharmaka stabilisiert und anschließend psychologisch therapiert worden – man hätte sie wohl aus ihrer Hölle retten können und damit zugleich den Mann erlöst.
Wenige Monate nach dieser Begegnung besuchte ich mit zwei Freunden eine Informationsveranstaltung der LMU München, bei der Fachärzte erklärten, was in genau solchen Fällen zu tun ist: Viele Patienten mit Verfolgungswahn können stabilisiert oder sogar geheilt werden – den ersten Schritt muß man jedoch mit Gewalt und gegen den Widerstand des Betroffenen tun, da man kaum darauf hoffen kann, daß die Wahnvorstellungen von selbst verschwinden.
Zugegeben, in vielen Fällen läßt sich kaum entscheiden, ob jemand gerade noch als Exzentriker durchgeht oder schon als verrückt anzusehen ist. Ich beurteile so etwas recht liberal. Doch diese Frau war verrückt; sie glaubte unerschütterlich, ich und andere würden sie heimlich abhören und überwachen, man versuche, sie und ihren Gatten umzubringen, und so fort.
Der Möglichkeitsraum dieser Bemitleidenswerten war innerhalb kurzer Zeit verarmt – sie hatte ihre Freiheit an die Krankheit verloren. Eines ist sicher: Ich hätte nicht lang gefackelt!
Eine allgemeine Verhaltensregel wäre auch „Glaube immer Stanislaw Lem!“
In seinem weltanschaulichen Bekenntnis Eine Art Credo stößt man auf folgenden Satz:
„Der Zufall wollte es, daß meine Genkonstellation mich mit Begabungen beschenkte, die einen im XX. Jahrhundert zum Schriftsteller befähigen.“
Vorausgesetzt, der Übersetzer hat nicht geschlampt, leistet sich Lem hier einen Schnitzer. Mit welchen Begabungen seine Gene den Autor ausstatten, ist keineswegs Zufall, sondern Notwendigkeit, da die Gene die Begabungen im wesentlichen vorgeben.
Der Satz muß heißen:
„Der Zufall wollte es, daß die Begabungen, mit denen meine Genkonstellation mich beschenkte, einen im XX. Jahrhundert zum Schriftsteller befähigen.“
Leider dürfen Sie auch mir allenfalls Schritt für Schritt glauben ... Das eigene Denken ist durch nichts zu ersetzen!
Aus der Sicht der Komplementarität gibt es nur eine goldene Lebensregel:
Entscheiden Sie im Einzelfall!
Damit ist eine Haltung genau auf halbem Weg zwischen Beliebigkeit und Nibelungentreue gemeint. Haben Sie Grundsätze, aber lassen Sie sich niemals von ihnen versklaven! Bleiben Sie offen für Neues, für die „unaufhebbare Rätselhaftigkeit dieser Welt“ (Stanislaw Lem)! Verlernen Sie nicht, zu staunen und sich zu wundern!
Konrad Lorenz hat empfohlen, jeden Tag eine Lieblingshypothese über Bord zu werfen. So weit geht wohl niemand, aber ich glaube, er meint dasselbe wie ich.
Mag die Gefahr, sich zu verrennen, noch so groß sein – Goethe war ein schwacher Naturwissenschaftler, Einstein weigerte sich, den Zufall hinzunehmen –, ich kann Ihnen nichts Besseres raten, als sich immer wieder neu auf den Einzelfall mit seinen meist unwiederholbaren Umständen einzustellen. Wir müssen jede Hoffnung auf ein Patentrezept für immer begraben!
Meine Empfehlung ist keine allgemeine Verhaltensregel, jedenfalls nicht im üblichen Sinn. Diese Regel sagt Ihnen weder mittelbar noch unmittelbar, was Sie tun sollen, sondern nur, was es heißt, sich dem Leben zu stellen.
Wer diesen Rat befolgt, wird immer wieder Fehler machen. Niemand, auch nicht der genialste Künstler, kann die unermeßliche Vielfalt unseres Universums in sich abbilden. Daß in manchem Blödsinn, zum Beispiel in der Astrologie, eine Prise Wahrheit steckt, verschärft die Schwierigkeiten.
Selbst wenn sich alle daran hielten – wir alle werden immer und immer wieder mit ansehen müssen, wie etliche von uns, die das Menschenmögliche versucht haben, scheitern. Um mit so etwas fertig zu werden, hat man die Religionen erfunden.
Aber wer sich dazu versteigt zu behaupten, Licht sei weiter nichts als Welle und Teilchen und nicht auch die Klarheit der Aussicht vom Münchner Olympiaberg auf die Alpen an einem kristallklaren Abend Ende Mai und die bleierne Schwere eines Nachmittags im Dschungel und unzählige andere Facetten, wer allen Ernstes glaubt, Liebe sei weiter nichts als Biochemie – der hat schon verloren:
Häufig gestellte Fragen zum Komplementaritätssatz
Was ist der Hauptsatz, um den es in diesem Dokument geht?
Der Hauptsatz lautet: Unser Universum ist komplementär.
Was bedeutet "komplementär" in diesem Zusammenhang?
Komplementarität bedeutet die Eigenschaft unseres Universums, sich trotz seiner Einheitlichkeit nur auch mit gleichwertigen, einander ergänzenden und zugleich widersprechenden Ansätzen ausschöpfen zu lassen.
Was wird unter der "Einheitlichkeit" des Universums verstanden?
Einheitlichkeit bedeutet:
- Überall gelten dieselben Gesetze; alle materialistisch faßbaren Gegenstände sind aus den gleichen, bei jeder Sorte untereinander identischen Elementarteilchen aufgebaut.
- Es ist unmöglich, ein Teilsystem vollkommen vom Rest des Universums zu isolieren: „Alles hängt von allem ab“ (Albert Einstein).
Was bedeutet die "Gleichwertigkeit" der Ansätze?
Gleichwertigkeit der Ansätze bedeutet, daß es keinen allgemeingültigen objektiven (vom Beobachter unabhängigen) Grund gibt, einen dem anderen vorzuziehen.
Welche Beispiele werden zur Illustration des Komplementaritätssatzes angeführt?
Es werden folgende Beispiele angeführt:
- Geometrien (Euklidische, Elliptische, Hyperbolische)
- Zufall und Notwendigkeit
- Allgemeine Relativitätstheorie und Quantentheorie
- Körper und Geist („Leib und Seele“)
- Linke und rechte Gehirnhälfte
- Kooperation und Konkurrenz
- Rational-nüchternes und dramatisch-erotisches Verhalten (Verstand und Gefühl)
- Punkt der Erkenntnis und Punkt bestmöglicher Aussichten
- Natürliche Sprachen
- Frau und Mann
- Demokratische Rechtsordnung und Selbstjustiz in Ausnahmefällen
Wie wird Zufall definiert?
Ein verwirklichter Sachverhalt heißt genau dann zufällig, wenn seine Eintrittswahrscheinlichkeit sich zu mindestens einem Zeitpunkt wesentlich von 1 unterschied.
Wie wird Notwendigkeit definiert?
Ein verwirklichter Sachverhalt heißt genau dann notwendig, wenn seine Eintrittswahrscheinlichkeit sich zu keinem Zeitpunkt wesentlich von 1 unterscheidet.
Inwiefern widersprechen sich Allgemeine Relativitätstheorie und Quantentheorie?
Die Relativitätstheorie ist deterministisch, während die Quantentheorie indeterministisch ist und den Zufall berücksichtigt.
Was ist die zentrale Aussage zum Leib-Seele-Problem im Kontext der Komplementarität?
Die hinter den Begriffen Körper/Leib und Geist/Seele stehenden Sichtweisen sind komplementär. Der Mensch ist eine untrennbare körperlich-geistige Einheit, die von komplementären Standpunkten aus betrachtet werden muss.
Was wird über die Beziehung zwischen Intelligenz und Unfehlbarkeit gesagt?
Intelligenz setzt Indeterminismus voraus, während Unfehlbarkeit Determinismus voraussetzt. Daher sind Intelligenz und Unfehlbarkeit unvereinbar.
Wie werden Innen- und Außenperspektive definiert und inwiefern sind sie komplementär?
Innenperspektive ist das Bild, das sich ein Mensch von sich selbst macht. Außenperspektive ist die Gesamtheit aller Bilder, die sich alle anderen Menschen von jemand machen. Sie sind komplementär, da sie sich widersprechen, ergänzen und gleichwertig sind.
Welche Folgerungen werden aus dem Komplementaritätssatz gezogen?
Einige Folgerungen sind: Keine Turing-Maschine (und damit kein heutiger Computer) kann intelligent sein. Intelligenz und Quantentheorie hängen zusammen. Kein heutiger Computer kann allgemeine Texte originalgetreu und stilsicher übersetzen.
Was ist Bewusstsein laut dieser Abhandlung?
Bewußtsein heißt die Gesamtheit der obersten Ebenen des Vorgangs, mittels dessen ein genügend komplexes, seinen Aufbau- und Ablaufprinzipien nach nichtdeterministisches informationsverarbeitendes System laufend danach strebt, sein Abbild des Universums einschließlich seiner selbst der Wirklichkeit anzupassen.
Was ist die Grundaussage zu Leben nach dem Tod?
Es gibt kein Leben nach dem Tod.
Welche Empfehlung wird abschließend aus dem Komplementaritätssatz abgeleitet?
Entscheiden Sie im Einzelfall! Haben Sie Grundsätze, aber lassen Sie sich niemals von ihnen versklaven!
- Quote paper
- Felix Guilino (Author), 2000, Ein Hauptsatz der Philosophie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109106