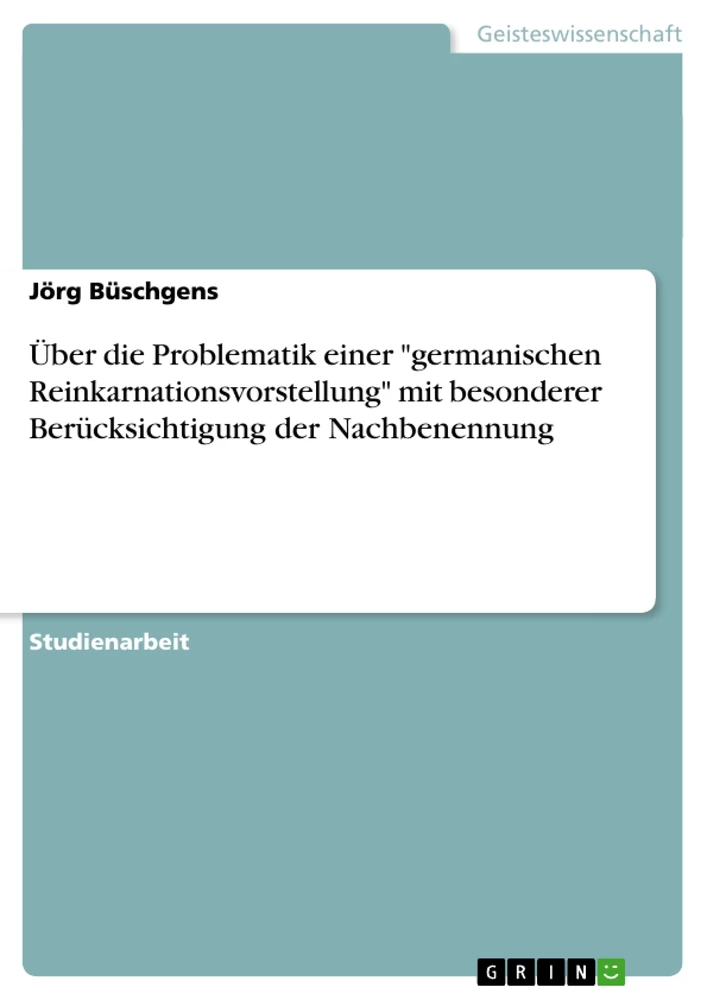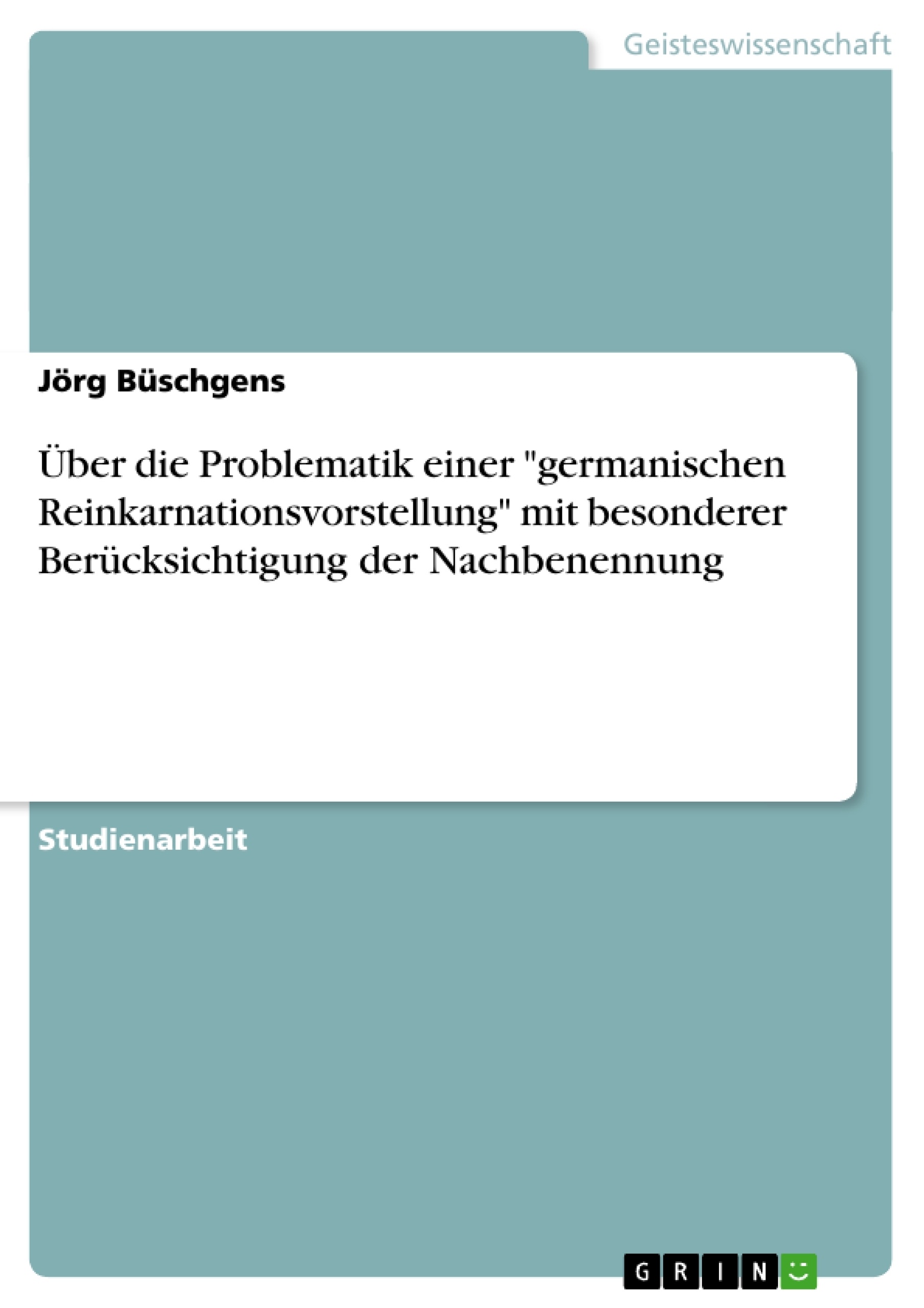Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die kontinentalgermanische Situation
Die Literatur des skandinavischen Mittelalters
Exkurs: Das Bild des Toten in der altnordischen Literatur
“...und ich erhoffe ihm Glück um des Namens willen”
Nachwort und Resümee
Literaturverzeichnis
1) Vorwort
Im Jahr 1893 veröffentlichte Gustav Storm im Arkiv för Nordisk Filologi den Aufsatz „Vore Forfædres Tro paa Sjælevandring og deres Opkaldelsessystem“1 in dem er versuchte, den in der altnordischen Literatur kaum belegbaren Glauben an eine Wiederverkörperung Verstorbener mit Hilfe der sich im 8. Jahrhundert in Skandinavien etablierenden Nachbenennungssitte zu beweisen. Dabei stand für ihn „Seelenwanderung“ synonym für „Metempsychose“2, also der „Wiederbeseelung“ eines Körpers durch die Seele eines Verstorbenen3. Das Ergebnis seiner Forschungen wurde schon durch den Titel seiner Arbeit impliziert; er meinte sogar nachweisen zu können, dass die Seelenwanderung an ein ethisch korrektes Verhalten zu Lebzeiten gebunden war4, im Endeffekt also eine Belohnung für rechtschaffenes Verhalten darstellt. Dabei trennte er allerdings zwischen „Seele“ und „Person“, und kam zu dem Resultat, dass es einen Glauben an die „Unsterblichkeit der Seele“ gegeben hat, dessen Entstehungszeit zwar nicht festzumachen ist, der allerdings „heidnisch“ im Sinne von „nicht christlich“ war5. Storm ging in seiner Arbeit noch nicht auf die Problematik ein, ob es überhaupt einen „Seelenbegriff“ in den germanischen Religionen gab, bzw. was er in seinem Arbeitsgebiet als „Seele“ definierte.
R.M. Meyer dagegen ging in seiner Altgermanische Religionsgeschichte 6 auf die Problematik der germanischen Seelenvorstellungen ein7 und verwarf den Begriff „Seelenwanderung“ zugunsten des Begriffes „Wiedergeburt“, unter der er eine „ periodische Wiederkehr der Seele in ihre Sippe “8 verstand; was vom Menschen allerdings wiederkehrt, schrieb er nicht.
Grönbech9 analysierte die verschiedenen altnordischen Termini, die sich im weitesten Sinne auf das Innenleben beziehen, und stellte fest, dass einige „Seelenanteile“ keine rein persönliche Qualität darstellen, sondern direkte und teilweise generationenübergreifende Auswirkungen auf die gesamte Sippe haben10. Dagegen gab es für ihn aber auch strikt individuelle Qualitäten, von denen die wichtigste das Schicksal ist11, und eben dieses Schicksal entscheidet über Wiedergeburt bzw. Reinkarnation12. Weiter im Text trennte er sich indirekt von den beiden Begriffen, und ersetzte sie durch Unsterblichkeit; der Held stirbt nicht, wenn er sein Heil und seine Ehre durch seinen Namen weitergeben kann13. Auch wenn Grönbech im Endeffekt stillschweigend zu dieser abstrakten Auffassung einer Wiedergeburts- bzw. Unsterblichkeitsidee überging, die nichts mit der christlichen Seelenvorstellung zu tun hat, zeigt sich hier ein modernerer Forschungsansatz als bei seinen Vorgängern.
Bahnbrechend für das Verständnis der altnordischen Nachtodvorstellungen war die Arbeit Walhall, die G. Neckel 1913 veröffentlichte. Neckel verwarf ältere, v.a. auf W. Wundt basierende Seelenkonzepte, die man versuchte auf die Germanen anzuwenden, und brachte seine Arbeit in dem Satz „ der heidnische Germane wusste nichts davon, daß er eine Seele hatte, die länger zu leben vermöge als der Leib “14 pointiert auf den Punkt; unabhängig von Neckel kam H. Schreuer bei der Untersuchung des rechtlichen Status Verstorbener 1915 zu einem sehr ähnlichen Ergebnis15.
M. Keil nahm 1931 wieder den Gedanken Storms über die engen Zusammenhänge zwischen Nachbenennung bzw. Namensgebung und Wiedergeburt auf; den Begriff Seelenwanderung lehnte er dagegen ab16. Für ihn war der Name eine im Endeffekt überindividuelle Größe, die mit „Kraft“ geladen ist, und Charakter, Glück und Schicksal des Nachbenannten bestimmt17; gleichzeitig zeigte er aber, dass es sich nur sehr begrenzt um eine „persönliche“ Wiedergeburt handeln konnte, da manche Verstorbenen gleichzeitig in mehreren Nachkommen einer Generation nachbenannt wurden18. Er versuchte auch zu belegen, dass die Nachbenennung und somit Wiedergeburt einen willentlichen Akt der Familienmitglieder darstellt, also nicht als Automatismus angesehen wurde19.
Dass der Name mit „Kraft“ geladen ist, bemerkte bereits Schomerus20; er zeigte aber ebenfalls, dass die Wiedergeburtsvorstellungen der Skandinavier komplexer und weniger strukturiert gewesen sein müssen als es sich in den Sagatexten darstellt; er bemerkte, dass häufig anlässlich der Namensvergabe in diesen Texten von der Ähnlichkeit des Kindes mit dem Verstorbenen berichtet wird21.
Einen weiteren wichtigen Beitrag zu der Problematik brachte H.-J. Klare in seiner Arbeit Die Toten in der Altnordischen Literatur 22, in der er der Frage nachging, was denn den Toten vom Lebenden unterscheidet; ein unverzichtbarer Beitrag wenn man herauszufinden versucht, welche Qualität vom Verstorbenen auf den Nachkommen übergehen kann.
Im Rahmen des nun politisch geförderten Arierwahns der 30er Jahre kam es kaum noch zu einer kritischen Auseinandersetzung mit den Quellen, und vor allem K.A. Eckhardt tat sich in seinem Buch Irdische Unsterblichkeit 23 durch eine ausgesprochen unkritische Quellenauswertung hervor, die sehr das Moment des „Erlebens“ bzw. „Empfindens“ bei der Auseinandersetzung mit Wiedergeburtsvorstellungen betonte24.
De Vries dagegen blieb quellenkritisch, und betonte in seiner Altgermanische Religionsgeschichte I von 1935 die schon von Grönbech formulierte Eingebundenheit des Individuums in die Sippe, die als geschlossenes und ewiges Kollektiv immer wieder dieselben Erscheinungsformen hervorbringt25. Er wendete als erster für die Religion der Germanen den Begriff „Partizipation“ an, der das Phänomen des endr-/aptrborin besser umschreibt als „Seelenwanderung“ oder „Wiedergeburt“.
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts spielt die Frage nach einer Wiedergeburtsvorstellung bei den Germanen keine große Rolle mehr, im Wesentlichen berief sich die Forschung auf de Vries bzw. das Partizipationsmodell, wie z.B. Ström26, oder ignorierte das Problem, wie z.B. in den beiden neuesten Darstellungen über die germanische Religion im deutschsprachigen Raum von Maier27 und Simek28. Soweit mir bekannt, ist H.P. Hasenfratz der einzige Religionswissenschaftler im deutschsprachigen Raum, der in jüngerer Zeit wieder mit Begriffen wie Reinkarnationsseele u.ä. arbeitet29. Das Quellenmaterial das er benutzt ist im Wesentlichen aber dasselbe, welches auch schon seine Vorgänger benutzt haben, nämlich vor allem die Lieder des Helgizyklus und die Vatnsdœla saga.
Ich will mit diesem kurzen Abriss der Forschungsgeschichte nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erheben, sondern nur einige der wichtigen Eckpunkte in der Forschung über das Problem der, wie auch immer gearteten, „Wiederkehr ins Leben“ aufzeigen. Im Folgenden möchte ich einige Quellenprobleme ansprechen die sich bei der Beschäftigung mit der Thematik ergeben, um dann auf die Belege in der altnordischen Literatur einzugehen.
Dabei ist der Begriff „germanisch“ hier abstrakt zu sehen; für den ersten Punkt meiner Arbeit bezieht er sich auf die Völker, die auch von antiken und spätantiken Schriftstellern als Germanen bezeichnet wurden. Dies trifft für die wikingerzeitlichen und mittelalterlichen Skandinavier nicht zu, sie laufen in dieser Arbeit lediglich aufgrund ihrer sprachlichen Verwandtschaft unter der Bezeichnung „germanisch“. Meinen Schwerpunkt möchte ich dabei auf die Nachbennungssitte richten, die in der späten Völkerwanderungszeit bei den dominanten Großstämmen auftaucht, um dann in Richtung Norden zu wandern, wo uns zum ersten mal in der mittelalterlichen Literatur Islands eine Reflexion über diese eigentümliche Form der Namensvergabe begegnet.
2) Die kontinentalgermanische Situation
Den frühesten Hinweis auf einen Wiedergeburtsglauben bei germanischen Völkern lieferte Appian von Alexandria in seiner ca. Mitte des 2. Jh. n.Chr.30 entstandenen Römische Geschichte. Bezüglich des Gallienfeldzuges Caesars weiß er von den Kriegern des Ariovist zu berichten, dass sie deshalb den Tod verachten, „w eil sie auf eine Auferstehung hoffen “31. De Vries bemerkt zu diesem Zitat, dass er einem Kommentar Strabos bezüglich der Kelten gleicht, was Appians Bemerkung relativiert, allerdings nicht von vornherein unglaubwürdig macht, da zwischen keltischen und germanischen Völkern von je her enge Beziehungen geherrscht haben32. Er bemerkt aber daraufhin folgerichtig, dass Appian nicht klärt, ob es sich um eine Wiedergeburt im Diesseits oder in einer jenseitigen Welt handelt.
Diese Bemerkung Appians steht in der antiken Germanenethnographie isoliert da, und um weitere Hinweise auf evtl. vorhandene Wiedergeburtsideen zu finden, muss man das Gebiet der ethnographischen Quellen verlassen und sich z.B. den germanischen Verwandtschaftsbeziehungen zuwenden. Bereits 1691 bemerkte K. Stieler, dass das Wort Enkel etymologisch mit Ahn zusammenhängt33. Das althochdeutsche eniklîn stellt eine Deminutivform des althochdeutschen ano dar, bedeutet also „kleiner Ahn“ oder „Ähnlein“34. In Teilen der Forschung sah man in diesem Ausdruck einen Beleg für die Vorstellung, dass die „Seele“ des Großvaters im Enkel weiterlebe35.
Neben der Problematik eines germanischen Seelenbegriffs wies Müller auf eine gewisse Denklücke dieser Theorie hin. In Anschluss an E. Hermann36 schreibt er, dass die grundsätzliche Frage gestellt werden muss, von welchem Familienmitglied die Bezeichnung „kleiner Ahn“ ausgeht37. Es ist nämlich ebenfalls denkbar, dass der Ausdruck ursprünglich eine kosende Bezeichnung darstellte, d.h. der (lebende) Großvater gab die Anrede ano dem Kind im Diminutiv zurück; aus der Anrede entwickelte sich dann der Appellativ38, ohne dass eine wie auch immer geartete religiöse Vorstellung zu Grunde lag. Hasenfratz, der dagegen ein klarer Befürworter einer Reinkarnationsvorstellung bei den Germanen ist, verbindet indirekt diese Etymologie mit der Sitte der Nachbenennung nach Verstorbenen und dem altisländischen Begriff endrborin bzw. aptrborin (erneut- bzw. wiedergeboren) um zu dem (m.E. Zirkel-) Schluss zu gelangen „ die Vorstellung einer Wiedergeburt (er spricht vorher von eine (r) Art Reinkarnationsseele) war überhaupt den Germanen nicht fremd “39. Er geht also den nicht unproblematischen Weg, aus drei zeitlich und räumlich auseinanderliegenden Erscheinungen seine Theorie zu bilden. Neben dem Problem der im Endeffekt unklärbaren Frage, aus welcher Kontextsituation das Wort Enkel entstand, steht auch noch das Problem, dass seine Entstehung zeitlich nicht festzumachen ist, und es innerhalb der deutschen (!) Dialekte ein zunächst bis weit in das Mittelalter hinein nur sehr begrenztes Verbreitungsgebiet hatte40, während z.B. in den skandinavischen Sprachen eine Entsprechung fehlt.
Auch die Nachbenennungssitte kann nur bedingt als Stütze für eine Reinkarnation- oder Wiedergeburtsvorstellung herhalten, da sie in den frühesten Schichten, d.h. vor- völkerwanderungszeitlichen, germanischer Namen nicht belegt ist; sie scheint sogar erst im Laufe der Christianisierung an Bedeutung zu gewinnen41. Germanische Namen sind meist zweigliedrig und stehen im engen Zusammenhang mit Heldenepitheta bzw. in Wechselwirkung mit der Heldendichtung42. Die frühesten Prinzipien der Namensbildung innerhalb einer Familie sind dabei Alliteration und Variation, wie es z.B. bei der spät- urnordischen Häuptlingsfamilie in Lister der Fall ist, deren Namen Hariwulfr/Haþuwulfr/Heruwulfr, sowohl alliterieren, Variationen vor dem konstanten Endelement –wulfr aufweisen und bei der sowohl Hariwulf als auch Heruwulf Entsprechungen im angelsächsischen Beowulfepos haben43. Dabei scheint aber die genealogische Signifikanz des Namens eine sekundäre Erscheinung zu sein44, die sich zunächst in den herrschenden Schichten durchsetzte45. Meist ist ein Namensbestandteil genealogisch determiniert, wie z.B. in dem oben genannten Beispiel aus Lister oder in den angelsächsischen Königshäusern, in denen meist der erste Namensbestandteil die familiäre Bindung zeigt, ggf. reduziert auf den Anlaut46. Auffallend ist, dass bei den Angelsachsen die vollständige Nachbenennung nach verstorbenen und/oder lebenden Vorfahren scheinbar erst unter Einfluss des Danelag Mitte des 10. Jh. eine gewisse Bedeutung für die Herrscherhäuser gewann47.
Früheste Belege für die Nachbenennung nach verstorbenen Vorfahren lassen sich bei den Westgoten des 5./6. Jahrhunderts finden, wenn man davon ausgehen möchte dass Eurich (gest. 485) seinen Sohn Alarich nach dessen 410 verstorbenen Urgroßvater Alarich benannt hat, während sie im Königshaus der Salfranken seit dem 6. Jahrhundert am deutlichsten in Erscheinung tritt 48. Gerade bei den Franken zeigt die Nachbenennung nach Verstorbenen eine Kontinuität bis in die Mitte des 9. Jahrhunderts49 und erlischt dann allmählich. Dabei fällt auf, dass anfänglich bei den Merowingern im Gegensatz zu der späteren Praxis der Skandinavier ein langer zeitlicher Abstand von bis zu vierzig Jahren zwischen Tod des Namensgebers und Nachbenennung lag50, und erst später wurde nach gerade Verstorbenen nachbenannt.
In der Generation Karls des Großen erfolgte dann ein partieller Umbruch dieser Sitte, da Karl der erste karolingische Herrscher war, der eindeutig einen legitimen Sohn zu Lebzeiten nach sich nachbenannte51, auch wenn es scheint dass sein Vater Pippin dieses ebenfalls schon praktiziert hatte. Für Eckhardt war dieser Umbruch in der Benennungspraxis auf das Wirken Bonifatius zurückzuführen52, der ja maßgeblich an der Reformierung der fränkischen Reichskirche bzw. ihrem Zusammenschluss mit der römischen Kirche beteiligt und ein eifriger Kämpfer gegen den Aberglauben war.
Allerdings war die Nachbenennung nach Lebenden eine Praxis, die im römischen Stadtadel schon lange praktiziert wurde, und auch der fränkische Senatsadel übernahm diese Praxis, lange bevor es die Königshäuser taten53. Es ist fraglich, warum ein gerade demonstrativ zum Christentum übergetretenes Herrscherhaus plötzlich dazu übergehen sollte, einem
„heidnischen“ Wiedergeburtsglauben durch die Nachbenennung Ausdruck zu verleihen, der dann im Lauf der Jahrhunderte bei den mit ihnen in Kontakt stehenden Völkern eine solche Popularität genießt, dass sie ebenfalls zu dieser Praxis übergehen.
Mitterauer schließt einen Wiedereinkörperungs- bzw. Wiederbelebungsglauben in Verbindung mit Nachbenennung bei den Skandinaviern nicht aus54, aber auch im Falle Dänemarks und Norwegens muss bedacht werden, dass die Nachbenennung im Endeffekt erst mit dem Aufkommen einer neuen Königsideologie, nämlich des allvaldskonungs/þjóðskonungs nach fränkisch/christlichem Vorbild, populär wurde. Es sei an dieser Stelle auch kurz angemerkt, dass wir die Nachbenennung mit explizit formuliertem Wiedergeburtsgedanken nur aus der isländischen Literatur kennen; ein nicht unerhebliches Problem, auf das ich später noch eingehen werde.
Trotzdem schien sich die Nachbenennung nach Verstorbenen, die auch für das antike Judentum, mediterrane Christen und Byzantiner belegt ist55, gerade im nordgermanischen Bereich einer großen Beliebtheit zu erfreuen, nachdem die Sitte um das 8. Jahrhundert zunächst Dänemark erreichte und die ältere Variation langsam ablöste56. Auch in Skandinavien waren es zunächst einmal die Königsfamilien, die die Nachbenennung übernahmen; hier zeigt sich allerdings wieder das Grundproblem, dass wir über die Genealogien der breiten Volksschichten nichts wissen, während uns die (mit aller Vorsicht als solche zu bezeichnenden) Königsfamilien durch fränkische und irische Annalen überliefert sind. Es ist allerdings auffallend, wie parallel (wenn auch zeitversetzt) die Entwicklung der Nachbenennung in den kontinentalgermanischen und skandinavischen Reichen verläuft57, die Nachbenennung wurde jedes Mal dann populär, wenn sich eine neue Herrschaftsideologie bzw. eine neue Herrscherdynastie etablierte.
Was bleibt also an Belegen für einen germanischen Wiedergeburtsglauben bei Sichtung der kontinentalgermanischen Quellen und Indizien? Ersteinmal nicht viel, vor allem wenn man sieht dass die Nachbenennung zu einem Zeitpunkt populär wurde an dem sich die kontinentalgermanischen Großstämme dem Christentum öffneten und schon lange an der mediterranen Welt partizipierten. Auch wenn im Endeffekt die Nachbenennung das gleiche Ziel verfolgt wie die ältere Variation, nämlich die Anbindung an eine Sippe oder Herrscherlinie58, so ist es doch fraglich ob dieser Anbindung ein Wiedergeburtsgedanke zu Grunde lag.
3) Die Literatur des skandinavischen Mittelalters
Betrachtet man die reichhaltig überlieferte Literatur des isländischen Mittelalters, so scheint hier auf den ersten Blick ein reichhaltigeres Quellenmaterial vorhanden sein, welches Hinweise auf eine (nord-)germanische Wiedergeburtsvorstellung geben könnte. Doch bei der Beschäftigung mit Eddischer Dichtung oder Prosaliteratur kann man in viele Fallen treten wenn man nicht ständig vor Augen hat, dass man das Werk eines mittelalterlichen Literaten vor sich hat, der mit nicht geringer Wahrscheinlichkeit Kleriker war und zusätzlich in einem Land lebte, dessen Isolation vom europäischen Festland ein romantischer Gedanke der frühen Forschung war.
[...]
1 G. Storm, 1893; „Unserer Vorväter Glauben an die Seelenwanderung und ihr Namensgebungssystem“
2 ebd.; S. 201
3 ebd.; S. 199
4 ebd.; S. 200
5 ebd.; S. 222
6 R.M. Meyer, 1909
7 ebd.; S. 73ff
8 ebd.; S. 84
9 Grönbech, I; 1912
10 ebd.; S. 259f; explizit: S. 279ff
11 ebd.; S. 264
12 ebd.; S. 265. Grönbech trennt die beiden Termini nicht von einander
13 ebd.; S. 320ff
14 Neckel, 1913; S. 37
15 Klare, 1933; S.2
16 Keil, 1931; S. 98f
17 ebd.; S. 88ff
18 ebd.; S. 105
19 ebd; S. 107
20 Schomerus, 1928; S. 223
21 ebd.; S. 223f
22 Klare, 1933
23 Eckhardt, 1937
24 ebd.; S.2
25 De Vries, 1935/³1970; S. 80 f.
26 Ström, 1975
27 Maier, 2003
28 Simek, 2003
29 Hasenfratz, 1986 und 1992
30 Brodersen in: Veh, 1987; S.2
31 Appian; Keltike 1,9 : „θαυάτου καταφρουηταί δί έλπίδα άυαβιώσεως“
32 de Vries, ; S. 217f
33 Müller,1979; S. 71
34 Beck, ; S.303/ Müller, 1979; S. 72
35 Müller, 1979; S. 72
36 Hermann, 1918; S. 215
37 Müller, 1979; S. 73
38 ebd.; aaO.
39 Hasenfratz, 1992; S. 65
40 Müller 1979; Karten S. 85ff
41 Mitterauer, 1993; 222f. Mitterauer verwendet den Ausdruck „Repetition“
42 Andersson; S. 592 / Reichert, 1992; S. 568
43 Andersson, S. 592
44 Haubrichs, 2000; S. 180
45 Sonderegger, 1997; S. 23
46 Mitterauer, 1993; S. 228f; siehe auch Stammtafel der ags. Könige von Northumbria S. 226
47 Storm, 1893; S. 208
48 ebd.; S. 206f
49 ebd.; S. 209
50 Mitterauer, 1988; S. 395
51 ebd.; S. 376
52 Eckhardt, 1937; S. 63f
53 Mitterauer; 1988; S. 393
54 ebd.; S. 394
55 Ders., 1993; S. 33ff.
56 Storm, 1893; S. 209
57 ebd.; S. 209ff
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text?
Dieser Text ist eine umfassende Sprachvorschau, die Titel, Inhaltsverzeichnis, Ziele und Hauptthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Der Fokus liegt auf der Untersuchung altnordischer Vorstellungen von Wiedergeburt und verwandten Konzepten in der germanischen Religionsgeschichte, insbesondere im Kontext der Namensgebung.
Was sind die Hauptthemen des Textes?
Die Hauptthemen umfassen:
- Die Forschungsgeschichte zu Wiedergeburtsvorstellungen bei Germanen.
- Die Bedeutung der Nachbenennungssitte und ihre Verbindung zu Wiedergeburt.
- Die Analyse verschiedener altnordischer Begriffe, die sich auf das Innenleben und Schicksal beziehen.
- Die Problematik eines germanischen Seelenbegriffs.
- Die Rolle des Namens und seiner "Kraft" in Bezug auf Charakter, Glück und Schicksal.
- Die kontinentalgermanische Situation bezüglich Wiedergeburtsglauben.
- Die Quellenprobleme bei der Beschäftigung mit Eddischer Dichtung oder Prosaliteratur.
Welche historischen Figuren und Werke werden in der Einleitung erwähnt?
Die Einleitung erwähnt Gustav Storm, R.M. Meyer, Grönbech, G. Neckel, M. Keil, Schomerus, H.-J. Klare, K.A. Eckhardt und de Vries sowie ihre jeweiligen Beiträge zur Forschung über Wiedergeburtsvorstellungen bei Germanen. Es werden auch Werke wie Gustav Storms Aufsatz „Vore Forfædres Tro paa Sjælevandring og deres Opkaldelsessystem“, R.M. Meyers "Altgermanische Religionsgeschichte" und G. Neckels Arbeit "Walhall" genannt.
Was sagt der Text über die kontinentalgermanische Situation bezüglich Wiedergeburtsglauben?
Der Text argumentiert, dass die Belege für einen germanischen Wiedergeburtsglauben in kontinentalgermanischen Quellen spärlich sind. Die Nachbenennung wurde populär zu einem Zeitpunkt, als sich die germanischen Großstämme dem Christentum öffneten und an der mediterranen Welt teilnahmen. Es ist fraglich, ob dieser Anbindung ein Wiedergeburtsgedanke zugrunde lag.
Welche Probleme werden bei der Analyse der altnordischen Literatur angesprochen?
Der Text warnt vor Fallen bei der Beschäftigung mit Eddischer Dichtung oder Prosaliteratur, da es sich um Werke mittelalterlicher Literaten handelt, die wahrscheinlich Kleriker waren. Die vermeintliche Isolation Islands vom europäischen Festland wird ebenfalls als romantische Vorstellung der frühen Forschung kritisiert.
Welche frühesten Hinweise gibt es auf einen Wiedergeburtsglauben bei germanischen Völkern?
Der früheste Hinweis stammt von Appian von Alexandria, der in seiner "Römischen Geschichte" über die Krieger des Ariovist berichtet, dass sie den Tod verachten, weil sie auf eine Auferstehung hoffen.
Was wird über die Etymologie des Wortes "Enkel" gesagt?
Es wird diskutiert, dass das Wort "Enkel" etymologisch mit "Ahn" zusammenhängt, was in der Forschung als Beleg für die Vorstellung gesehen wurde, dass die "Seele" des Großvaters im Enkel weiterlebt. Allerdings wird auch darauf hingewiesen, dass der Ausdruck ursprünglich eine kosende Bezeichnung gewesen sein könnte, ohne religiöse Grundlage.
- Citation du texte
- Jörg Büschgens (Auteur), 2004, Über die Problematik einer "germanischen Reinkarnationsvorstellung" mit besonderer Berücksichtigung der Nachbenennung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109109