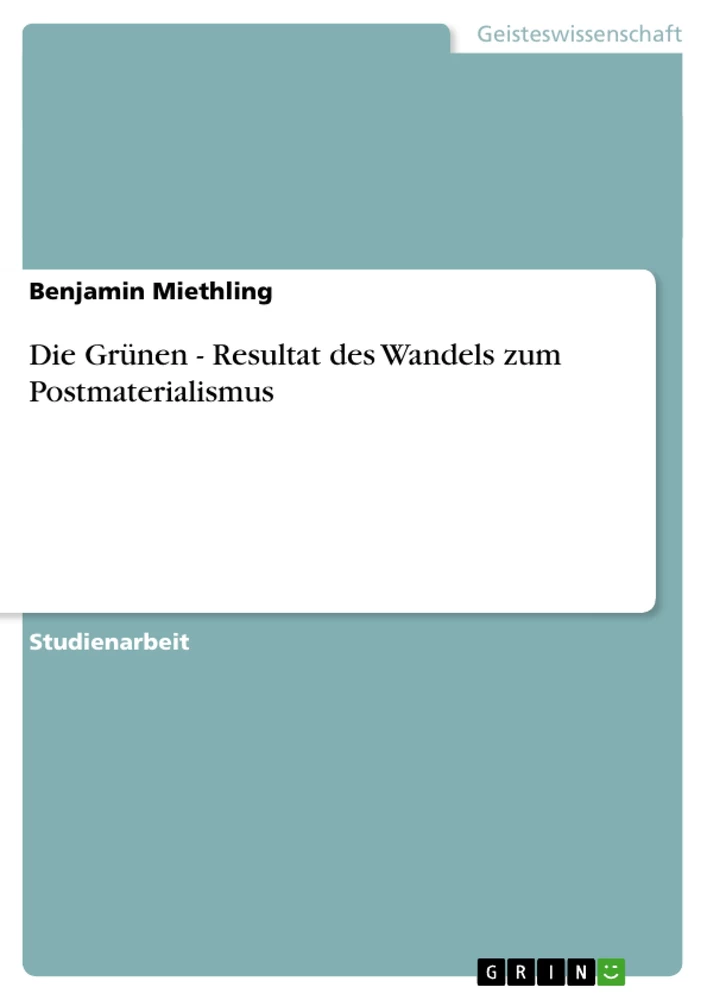I. Die Einleitung
"Die Grünen" - das Resultat des Wandels zur postindustriellen Gesellschaft: Der Titel macht deutlich, dass die 1980 gegründete Partei ein Novum in der deutschen Parteienlandschaft darstellt. Gegründet aus diversen Verbänden, Bürgerinitiativen und Bewegungen etablierte sie sich in der Bundesrepublik Deutschland und nimmt seit 1998 an der Bundesregierung teil. Dabei sind ihre Prämissen und Forderungen oft sehr unterschiedlich und nicht selten gegensätzlich zu denen, der übrigen Parteien, ebenso differiert ihr innerer Aufbau deutlich mit dem der anderen Parteien. Mit neuen Ideen, Forderungen und Zielen zogen "Die Grünen" 1983 in den Bundestag ein und erreichten seitdem sowohl ein Umdenken in der bis dahin vom sturen rechts- links Denken beherrschten Politik, als auch eine Veränderung im Denken der Bevölkerung, wie im Verlaufe der Arbeit weiter erläutert werden wird. Desgleichen wurden sie jedoch auch selbst verändert und verloren viele ihrer Ideale in der Einsicht, dass Übermut oft kontraproduktiv ist und viele gute Vorsätze unerfüllbar sind. Fakt ist jedoch: keine Partei, die in den letzten Jahrzehnten gegründet wurde, schaffte es, sich ähnlich erfolgreich in der deutschen Politiklandschaft durchzusetzen, wie "Die Grünen", oder, wie sie seit 1993 heißen: "Bündnis90/ Die Grünen".
In dieser Hausarbeit möchte ich die Ursachen behandeln, die zur Gründung einer Partei wie dieser führten und dabei auf die Unterschiede und Neuerungen im Vergleich zu den großen Volksparteien und den übrigen Parteien hinweisen, um schließlich die These des Titels, dass „Die Grünen“ das Ergebnis eines Wandels in der Gesellschaft verkörpern, zu belegen.
Beginnen werde ich mit einem Überblick über den Vollzug des Wertewandels, welcher sich seit den 60er Jahren in unserer Gesellschaft abspielte und sich der Öffentlichkeit in den Unruhen um das Jahr 1968 wohl am deutlichsten offenbarte. Damit verbunden hat sich für die Gesellschaft ein Umdenken im Bereich der Teilnahme am politischen Alltagsgeschäft ergeben, welches massive Auswirkungen auf die Strukturen und die Programme der Parteien hatte und ebenfalls ein Grund für den stetigen Rückgang der Wählerstimmen der beiden großen Volksparteien CDU und SPD ist.
Weiter wird meine Arbeit sich mit den daraus resultierenden Herausforderungen für die Politik befassen, die unter anderem durch ein verändertes Wahlverhalten, einen Rückgang der Wähler bei den Volksparteien, sowie die Entstehung neuer sozialer Bewegungen charakterisiert sind.
II. Die Entstehung der „Grünen“
II.1. Politisch- kulturelle Wandlungsprozesse
a) Der Wertewandel:
Wenn man heute von einem Wertewandel spricht, meint man einen zumeist einen spontanen Wandel, das heißt, er kann sich auch unabhängig von institutionellen Strukturen (und unter Umständen auch in einem Spannungsverhältnis zu diesen) vollziehen (vgl. Klages 2001: 727). In den 70er Jahren vollzog sich eben dieser „spontane Wertewandel“, so behauptet Inglehart, der wie im Folgenden weiter erläutert wird, einen Wandel von „materialistischen“ zu „postmaterialistischen“ Werten beobachtet hat. Er bezeichnet dieses Phänomen als „silent revolution“ (Alemann 2001: 189, zitiert Inglehart 1977). Diese Ansicht ist in Fachkreisen jedoch umstritten, so spricht Klages von einem Wandel von „Pflicht- und Akzeptanzwerten zu Selbstentfaltungswerten“ (Klages 1988: 56ff), Bürklin und andere von „Periodeneffekten“ und „lebenszyklischen Effekten“, das heißt von einem stetigen Wandel von Werten im Periodenrhythmus (Bürklin/Klein/Ruß: 1994).
Zu Beginn der 60er Jahre hatte sich die Bundesrepublik Deutschland von den Folgen des Krieges soweit erholt, dass, verglichen mit vielen anderen europäischen Staaten, ein hohes Maß an ökonomischer Sicherheit, Wohlstand und resultierend daraus eine subjektive Sicherheit in der Bevölkerung herrschte (vgl. Sontheimer/Bleek 1999: 153 und Inglehart 1998: 129). Die Verbindung seiner sogenannten „Mangtelhypothese“ (knappe Dinge werden vom Individuum höher bemessen, als andere) und der „Sozialisationshypothese“ (grundlegende Wertvorstellungen resultieren aus dem Umfeld, in dem ein Mensch aufgewachsen ist) (vgl. Greiffenhagen 2000: 20) bringt Inglehart zu dem Schluß, „(...) dass jüngere Altersgruppen in westlichen Ländern aufgrund des anhaltenden Friedens seit 1945 ihrer ökonomischen und physischen Sicherheit viel weniger Wert zumessen als ältere Menschen, die größere ökonomische Unsicherheit erlebt haben. Umgekehrt weisen Menschen der jüngeren Generation den nicht-materiellen Bedürfnissen wie Gemeinschaftsgefühl und Lebensqualität eine höhere Priorität zu.“ (Inglehart 1989: 77). Will sagen: wenn in einer Gesellschaft ein hohes Maß an ökonomischer Sicherheit und subjektivem Wohlbefinden herrscht, wird das Aufkommen von „postmaterialistischen“ Werten begünstigt (vgl. Inglehart 1998: 129).
Als obersten Gesichtspunkt in Bezug auf die Charakterisierung von (Post-) Materialismus nennt Bell die „Wirtschaftlichkeit“, also „das Bestreben, die Mittel nach den Grundsätzen des geringsten Aufwands, der Substitution, Optimierung, Maximierung usw. zu verteilen“ (Bell 1985: 30). Die daraus abgeleiteten Schlagwörter der Politik sind Partizipation und Mitbestimmung, die bald vorangetrieben, bald eingedämmt und bald von unten gefordert werden (vgl. Bell 1985: 30). Im kulturellen Bereich herrscht der Wunsch nach Selbstverwirklichung und Entfaltung der eigenen Person vor (vgl. Bell 1985: 30).
Versucht man, diese neuen Werte zu katalogisieren, so fällt vor allem auf, dass solche Werte, die schon seit Generationen ihre Gültigkeit hatten, verschwanden, bzw. an Bedeutung verloren und ein immer stärker werdendes Gefühl der Zwiespältigkeit in der Gesellschaft erwuchs. Dieses verursachte (wie man später sehen wird) einen Wandel in vielen Bereichen der Gesellschaft:
Das Vertrauen in die zuvor hoch gepriesene Technik und Wissenschaft sank in Folge der immer dramatischer werdenden ökologischen Bedingungen. Zugleich erhob sich die Forderung nach einer stärkeren Integration der Frau in die Gesellschaft (vgl. Inglehart 1998: 133) sowie der verstärkten Teilnahme an den politischen Entscheidungsprozessen. Die vormals hoch gelobten Verwaltungen mit ihren Glieder- und Untergliederungen verloren an Unterstützung, man favorisierte wieder kleine, dynamische und menschennahe Verwaltungen, die das "zwischenmenschliche Vertrauen" (Inglehart 1998: 133) und den direkten Kontakt erhalten sollten. Außerdem fand ein Wandel in den für wichtig empfundenen Themen statt; das Konzept des wirtschaftlichen Wachstums um jeden Preis verlor in Anbetracht der zunehmenden Sorge um die Auswirkungen der Industrie auf die Umwelt an Bedeutung. Frauenfragen, Umweltschutzthemen, die Abtreibungsproblematik und ethnische Konflikte rückten in den Mittelpunkt des politischen Interesses.
Diese Veränderungen auf Mikro- Ebene verursachten das Aufkommen neuer politischer Schwerpunkte und damit verbunden, eine Spaltung in der Politik, sowie einen „Wählerwandel“.
Seit den 60er Jahren organisieren sich Postmaterialisten in Organisationen, Interessenverbänden und Bewegungen, wie der Friedens-, Öko- oder Frauenbewegung (vgl. Inglehart 1998: 337). 1980 wurde mit der Gründung der Partei "Die Grünen" erstmals eine solche postmaterialistische Orientierung in der Bevölkerung auf der politischen Ebene in Form einer Partei sichtbar, vor allem, weil sie versuchte, die neu gewachsenen Ansprüche der Gesellschaft im Bezug auf politische Mitbestimmung in ihr Konzept zu integrieren.
b) Neue Formen politischer Partizipation
Der Begriff der politischen Partizipation beschreibt in der Regel jene Verhaltensweisen von Bürgern, die sie „alleine oder mit anderen freiwillig mit dem Ziel unternehmen, Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen. Diese Einflussnahmen können sich auf eine oder mehrere Ebenen des politischen Systems (Gemeinde, Land, Bund) richten“ (Kaase 2000: 473).
Die Erhöhung der Ansprüche an die Politik und die Demokratie im Zuge des „Wertewandels“ ließ den bloßen Wahlakt in den Augen der Bevölkerung als wenig befriedigend erscheinen (vgl. Bürklin/ Klein 1998: 164), die Menschen forderten mehr Mitspracherechte und die Möglichkeit, durch ihr eigenes direktes Zutun, Politik gestalten und verändern zu können, um ihrem Bedürfnis nach Selbstentfaltung zu genügen. Diese Möglichkeit bot ihnen der Wahlgang in ihren Augen nicht, die Menschen forderten Mitwirkung im politischen Tagesgeschehen (vgl. Greiffenhagen 2000: 27). Bedingt wurde diese Einstellung durch eine Reihe von Krisen, angefangen von der Legitimationskrise bis hin zur Ölkrise (Kaase 1982: 174). Des weiteren waren zu dieser Zeit „weder Arbeit noch Kapital bereit und in der Lage, eine Verantwortung in Europa zu übernehmen, was den Eindruck der Unregierbarkeit des Landes in der Bevölkerung hinterließ“ (Kaase 1982: 174). Dieses Gefühl einer beinahe alles umfassenden Krise wirkte sich auf die Menschen in dem Maße aus, dass man sich von Wissenschaft, Massenmedien und Politik überwältigt sah und löste den Drang nach einem Eingreifen und einer Veränderung und somit ein Misstrauen in die Demokratien Westeuropas aus (vgl. Kaase 1982: 174). Diese umfassende Forderung der Bürger nach Ausweitung ihrer sozialen und politischen Beteiligungsrechte wird auch als "partizipatorische Revolution" (Kaase 1982: 177) bezeichnet.
Nach außen hin charakterisierte sich diese Veränderung besonders durch neue Dimensionen der politischen Beteiligung, welche sich zu Beginn der 60er Jahre entwickelten und zuvor in der Gesellschaft wenig verbreitet waren. Zu den konventionellen Formen politischer Partizipation zählten bis dato Aktivitäten wie das Führen einer politischen Diskussion, das Lesen des Politikteils in der Zeitung, das Gespräch mit Politikern, der Gang zu einer politischen Veranstaltung, Versammlung, Wahl oder ähnliches (vgl. Kaase 1982: 180). Als Neuerungen konnte man nun Formen unverfasster und unkonventioneller Partizipationsmöglichkeiten konstatieren, welche von der Beteiligung an Unterschriftensammlungen und politischen Demonstrationen über Boykotte und Miet-, Steuer- oder Ratenverweigerungen, bis hin zu wilden Streiks oder aggressiven Demonstrationen reichten.
Die Grundlage dieses veränderten Verhaltens seitens der Wähler beschreiben Verba und Nie in ihrem „Standardmodell“ (Verba/Nie 1972: 125 ff.): Danach vermittelt ein hoher ökonomischer Status über bestimmte politische Einstellungen das Ausmaß an politischer Beteiligung (Kaase 1982: 182). Die empirisch nachgewiesene positive Korrelation zwischen verfasstem (konventionellen) und unverfasstem (unkonventionellen) Auftreten der politischen Partizipation interpretiert Kaase dahingehend, „dass die neuen direkten Formen der politischen Beteiligung das Repertoire der Bürger an politischen Verhaltensweisen erweitern und sie damit vermutlich in den Stand versetzen, ihre eigenen politischen Vorstellungen flexibler als in der Vergangenheit in dem politischen Entscheidungsprozeß zu vertreten“ (Kaase 1982: 183).
Doch nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb der politischen Parteien vollzog sich ein Wandel bezüglich der Forderung nach mehr Partizipation. Der Wandel zum Postmaterialismus, welcher ebenfalls einen Wandel in der politischen Tagesordnung und eine zusätzliche politische Schiene (s. II.2.a ) ins Spiel brachte, bereitete den Parteien entlang der "klassischen Konfliktlinien" große Probleme (vgl. Kaase 1892: 185). Sie mussten sich umorientieren, einige ihrer Themen in den Hintergrund stellen und gleichzeitig neue Themen diskutieren, ausarbeiten und Stellung beziehen. Dies barg jedoch eine Gefahr in sich, welche den Parteien durchaus bewusst war: wollten sie die "Basis" miteinbeziehen, so wie diese es wünschte, würde es aufgrund der vielen verschiedenen Ansichten schwer werden, die Meinungs- und Willensbildungsprozesse auf eine gemeinsame Außendarstellung zu koordinieren, d.h. einen Kompromiss, bzw. einen zufriedenstellenden Abschluss, zu erlangen. Ohne die Einbeziehung der Basis liefen die Parteien jedoch Gefahr, Mitglieder zu verlieren, da diese sich nicht in der Lage fühlten, in dieser Partei ihrem Streben nach Selbstverwirklichung nachkommen zu können.
Dieses Dilemma beruht auf einer Gegebenheit, die sich ebenfalls in den Zusammenhang zu den neuen Werten bringen lässt: Durch die aktive Teilnahme an den politischen Entscheidungsprozessen wollten die Bürger ihren Drang nach Selbstverwirklichung (vgl. Kaase 1982: 185) befriedigen, die bereits dargestellten Probleme trugen jedoch zu einer Frustration der Bürger bei, da Beteiligungsmöglichkeiten entweder von der Partei nicht zur Verfügung gestellt, oder von der Bevölkerung nur mit mäßigem Interesse wahrgenommen wurden, weil die Chance, vor allem bei den beiden großen Volksparteien, in einer so großen Menge unterschiedlicher Meinungen und Ansichten etwas zu erreichen, eher gering und mühselig war.
Dies ist auch ein Grund für den stetigen Wählerverlust der Volksparteien (s. II.2. b) und stellt noch heute eine große Herausforderung für die Politik dar.
II.2. Herausforderungen für die Politik
a) Veränderungen im Wahlverhalten
Durch den „Wertewandel“ veränderte sich nicht ausschließlich die politische Agenda und neue Formen der politischen Partizipation entstanden: es kam ebenfalls zu einer Wählerwanderung und einem generellen Umdenken im Wahlverhalten, eine Entwicklung, welche die Politik nun direkt herausforderte:
Durch das Entstehen einer neue Trennungslinie zwischen den Parteien, orthogonal zu der bisherigen rechts- links- Schiene, die gekennzeichnet war durch postmaterialistische Ziele auf der einen und materialistische Ziele auf der anderen Seite, begann sich die Bedeutung der Begriffe "rechts" und "links" zu wandeln (vgl. Inglehart 1989: 347 ff.). Dies bedingte einen Wählerwandel: die Lager der eher rechten Parteien, die man früher mit einem Großteil der Mittel- und Oberschicht in Verbindung brachte, wurden mit Anhängern aus unsicheren Segmenten der Arbeiterklasse besetzt, Postmaterialisten aus der Mittelschicht wandten sich hingegen den linksorientierten Parteien zu.
Bis in die 80er Jahre hinein, war die Wahlbeteiligung in der Bundesrepublik ungebrochen hoch. Erst Mitte der 80er Jahre, in einer Zeit vieler Krisen (s. II.1.b ) und dem Aufkommen neuer sozialer Bewegungen, sank die Wahlbeteiligung, die Prozentzahlen der extremen, v.a. der rechtsextremen Parteien nahmen drastisch zu.
Man fand heraus, dass vor allem die rückläufige Verbreitung affektiver Parteibindungen und die zunehmende Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Politik und den Politikern, für die steigenden Nichtwählerzahlen verantwortlich gemacht werden konnten (vgl. Bürklin/ Klein 1998: 162). Nur jeder vierte Nichtwähler zeigte eine affektive Parteibindung auf. Genauer bedeutete das, dass die rückläufige Wählerzahl auf einen Prozess der Individualisierung und den damit verbundenen Austritt aus den traditionellen sozial- moralischen Milieus, sowie eine rückläufige Akzeptanz der Wahlnorm und der politischen Legitimität im Ganzen zurückzuführen war (vgl. Bürklin/Klein 1998: 162). Daraus resultierte für den Wähler oft die Nichtwahl als Strategie für ihren Protest gegen das demokratische System in dieser Form.
Auch die Wahl extremer Parteien sollte Ausdruck des Protests vieler Bürger gegen die bestehende politische Ordnung sein, gleichzeitig schlossen sich jene, die sich im Zuge der Modernisierung als auf der Strecke geblieben ansahen und den radikalen Wahlslogans der extremen Parteien Glauben schenkten, dem Votum für eine rechtsextreme Partei an (vgl. Bürklin/ Klein 1998: 175).
Die Parteien, vor allem die beiden großen Volksparteien (CDU und SPD) sahen sich in dieser Zeit mit einem Legitimitäts- und Autoritätsverlust konfrontiert, dem sie sich stellen mussten, um ihre Macht und ihren Einfluss nicht zu verlieren.
b) Die Krise der Volksparteien
Den Wandel im Wahlverhalten der Bürger in Deutschland bekamen vor allen Dingen die beiden großen Volks- oder Massenparteien, die CDU und die SPD zu spüren. Sie verloren stetig an Mitgliedern und Wählerstimmen und dieser Trend ist bis heute noch nicht abgewendet.
Um dieses Phänomen zu erklären ist es von Nöten, zunächst den historischen Ursprung dieser Parteien zu umreißen: Die Massenintegrationspartei ist ein Parteitypus, welcher sich in Zeiten der Klassenunterschiede und Konfessionsstrukturen herausbildete und sich in den letzten Jahrzehnten zu Allerwelts- oder Volksparteien umformte. Eine solche Partei „opfert“ eine tiefere ideologische Durchdringung für eine weitere Ausstrahlung und - damit verbunden- einen rascheren Wahlerfolg (Kirchheimer 1965: 27). Die Ziele der alten Massenintegrationspartei werden oft als erfolgsmindernd angesehen, weil sie potentielle Wähler in der Gesamtbevölkerung abschrecken könnten.
Aufgrund dieser Veränderungen rückte, in den 60er Jahren, vor allem der Führer einer solchen Volkspartei in den Vordergrund, da tiefergehende Ideologien fehlten, an denen der Wähler seine Wahl orientieren konnte. Der Wähler musste entscheiden, ob er der Partei führung die Regierung der Bundesrepublik zutraute oder nicht. Dadurch wurde die Rolle des einzelnen Parteimitglieds entwertet, er diente der Partei oft lediglich zur finanziellen und repräsentativen Unterstützung ohne eine wirkliche Funktion oder Kompetenz inne zu haben. Des weiteren orientierten sich Volksparteien immer mehr zu Interessenverbänden hin, da sie dort eine große Gruppe an potentiellen Wählern erreichen konnten und Interessenverbände oft miteinander verknüpft waren (Kirchheimer 1965: 32).
Der Wandel barg jedoch auch Nachteile in sich, so kann als ein Grund für den Stimmen- und Mitgliederverlust der Volksparteien die mangelnde Selbstentfaltungs- und Mitwirkungsmöglichkeit der Mitglieder im Hinblick auf die Handlungsprozesse genannt werden: Die bis dato geltenden Funktionen der Parteien (Transmission, Selektion, Integration und Legitimierung) weiteten sich zu insgesamt 7 Funktionen (s.o. + Integration, Sozialisation und Selbstregulierung) aus (vgl. Alemann 2001: 208/209). Aus Gründen der Unvereinbarkeit so vieler Ansprüche und Interessen in einer Volkspartei, werden Entscheidungen beinahe ausschließlich von einer Elite getroffen, das „normale“ Parteimitglied bleibt außen vor und, da es sich seiner Partizipationsmöglichkeiten „beraubt“ sieht, verlässt es frustriert die Partei, um nach anderen Wegen zu suchen, aktiv an der Politik in Deutschland teilnehmen zu können.
Und hier lag und liegt das Dilemma der heutigen Volksparteien begründet: Das höchste Ziel dieser Parteien, im Wahlkampf möglichst viele Wählerstimmen zu erbeuten, zwingt sie dazu, viele Forderungen und Ansichten zu integrieren und somit loyalen Parteianhängern abzusagen. Im Konkurrenzkampf mit den anderen Parteien nähern sich die Parteiprogramme einander immer weiter an, wobei sie schließlich beinahe identisch werden und jeder versucht, die besten Programmteile des Kontrahenten zu übernehmen, um dessen Stimmen abzuwerben. Die Rolle der Allerweltspartei in der Politik ist folglich vergleichbar mit der eines Markenartikels in der Wirtschaft (vgl. Kirchheimer 1965: 34): Es geht im Grunde darum, einen identischen Artikel in der schönstmöglichen Verpackung zu verkaufen. Wenn sich eine Partei von Sonderinteressen fernhält kann sie ein potentiell größeres Wählerklientel erreichen. Bringt eine andere Partei jedoch das selbe Programm mit einer schöneren "Verpackung", also einem überzeugenderen Führer oder ähnlichem heraus, so wandern die Stimmen schnell über und die Partei fährt Verluste ein (vgl. Kirchheimer 1965: 34).
„Im Endeffekt lässt sich konstatieren, dass die Volksparteien aufgrund ihrer halboffiziellen und mitgliederfremden Struktur eine Organisation geworden sind, die das Interesse des Bürgers oft nicht mehr zu wecken imstande sind“ (Kirchheimer 1965: 40).
c) Neue Soziale Bewegungen
Eine weitere Herausforderung für die Politik in Zeiten des Wertewandels war das Auftauchen neuer sozialer Bewegungen in Europa, welche die neuen Forderungen und Ansprüche der Bevölkerung über Proteste und Demonstrationen zu realisieren versuchten.
Dabei ist es zunächst einmal von Nöten, eine soziale Bewegung zu charakterisieren: nach Rucht stellt eine soziale Bewegung ein "auf gewisse Dauer gestelltes und durch kollektive Identität abgestütztes Handlungssystem mobilisierter Netzwerke von Gruppen und Organisationen dar, welche sozialen Wandel mit Mitteln des Protests- notfalls bis hin zur Gewaltanwendung herbeiführen, verhindern oder rückgängig machen wollen" (Rucht 1994: 77). Voraussetzung für die Gründung einer sozialen Bewegung ist ein rascher oder sogar krisenhafter sozialer Wandel, das Ausbleiben einer notwendigen Veränderung der sozialen Bedingungen, die Entstehung neuer Wert- oder Rechtsvorstellungen oder aber eine Bündelung von individuellen Deprivationen oder Unzufriedenheiten durch Menschen, welche in der Lage sind, eine Bewegung zu organisieren und zu führen (vgl. Rucht 1994: 90). In der Regel müssen mehrere der eben genannten Aspekte gleichzeitig vorhanden sein, um eine soziale Bewegung entstehen zu lassen (vgl. Rucht 1994: 90).
Die Handlungsmöglichkeiten der sozialen Bewegungen beschränken sich nicht auf Mikro- oder Makroebene, sondern kommen auf beiden Ebenen vor: sie sind sowohl relativ authentische Verkörperungen der Forderungen und Wünsche ihrer Unterstützer, "als auch strategisch operierende Handlungssysteme mit Interventionsabsichten auf der Makroebene" (Rucht 1994: 80).
Im Gegensatz zu Parteien oder sonstigen Betrieben oder Unternehmen sind Bewegungen nicht im Stande, ihre Motive und Absichten in Geld oder Macht umzuwandeln. Ihr Sinn beschränkt sich auf die Einflussnahme und das Aufmerksammachen auf aktuelle gesellschaftliche oder politische Probleme.
Betrachtet man unter diesem Aspekt die Gründung der Grünen, so zeigt sich, dass - wie in dem folgenden Kapitel noch intensiver bearbeitet wird- die Parteigründung eine Notwendigkeit besaß, da die Forderungen der Umwelt- und Friedensbewegungen, die eng mit dem Aufkommen neuer Werte, also dem Wandel zum Postmaterialismus, verknüpft waren, von der damaligen Regierung um Schmidt nicht weiter für voll genommen, sondern belächelt und verunglimpft wurden ( vgl. Hallensleben 1984: ). Da das Ziel von Bewegungen jedoch eine Einflussnahme auf politische Entscheidungen und die Verbesserung der sozialen und/oder politischen Bedingungen in einem Land ist, sah sich Carl Beddermann 1977 schließlich als erster gezwungen, seine Bürgerinitiative in Niedersachsen in eine "grüne Partei" umzuwandeln (vgl. Hallensleben 1984: ).
II.3. Die Grünen
a) Ihre Entstehung
Im Gegensatz zu den „herkömmlichen Parteien“ und hingegen der allgemeinen Ansicht, "Die Grünen" wären durch den Zusammenschluss einiger Bürgerinitiativen und Bewegungen entstanden, ist der Beginn auf das Engagement von Einzelpersonen zurückzuführen, deren Einsatz für eine politische Vertretung von alternativen Interessen in Form von Öko- und Friedensbewegungen zunächst eher kritisch betrachtet und abgelehnt wurde (vgl. Hallensleben 1984: 42). Dennoch kann man konstatieren, dass die Wurzeln der Grünen im Klientel der neuen sozialen Bewegungen zu finden waren: vor allem aus der Studentenbewegung, der Antikernkraftbewegung, der Frauen-, Friedens- und Ökobewegung, aus enttäuschten Sozialdemokraten, die aus Protest gegen die Kernkraft- und Verteidigungspolitik ihre Partei verließen, sowie aus jungen Postmaterialisten, rekrutierte sich die breite Unterstützerbasis für die neue Partei (vgl. Lösche 1993: 148-149).
Die Wurzeln der heutigen Partei "Die Grünen" liegen in Niedersachsen, wo der damals 36 jährige Jurist Carl Beddermann eine Bürgerinitiative gegen den Bau einer Entsorgungsanlage in dem nahe seines Wohnortes gelegenen Lichtenmoor begründete (vgl. Hallensleben 1984: 43). Doch Beddermann machte ähnliche Erfahrungen, wie viele andere Umweltinitiativen jener Jahre: obwohl 1978 etwa allein 1000 Bürgerinitiativen unter dem Dachverband "Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz e.V." existierten und viele weitere unter anderen Dachverbänden zusammengefasst waren, sahen sie ihre Interessen von der Politik nicht in ausreichendem Maße repräsentiert und sie wurden in der Auseinandersetzung mit öffentlichen Verwaltungen des öfteren als „Quälgeister“ abgewimmelt, hingehalten oder diffamiert (vgl. Hallersleben 1984: 43). Aus dieser Behandlung resultierte nach einiger Zeit eine große Ablehnung staatlicher Institutionen und die Forderung nach mehr Demokratie (vgl. Hallensleben 1984: 43). Diese Haltung der Parteien gegenüber seinem Anliegen, eine Konfrontation mit der Polizei bei einer Demonstration in Grohnde (März 1977), sowie die Erfolge der "Ecologistes" in Frankreich im März 1977, motivierten Beddermann, den Parteien durch die Gründung einer Protestpartei einen "Denkzettel" zu verpassen (vgl. Hallensleben 1984: 50). So entstand die "Umweltschutzpartei" (USP), welche später in "Grüne Liste Umweltschutz" (GLU) umbenannt wurde.
Die GLU entsprach aufgrund ihres Organisation- Konzeptes und ihres Minimal- Programms, in der Gründerphase, eigentlich dem Modell einer kurzlebigen Protestpartei, so verwundert doch stark, dass sie es schaffte, sich in Niedersachsen und später auch bundesweit zu etablieren. Das eigentliche Ziel, nämlich den Parteien einen "Denkzettel" zu verpassen, gelang mit dem Abschneiden bei der Landtagswahl in Niedersachsen am 4.6.1987, das der Partei einen Stimmenanteil von 3,9% bescherte und der FDP den Einzug in den Landtag verwehrte. Eigentlich hätte sich die Partei nun wieder auflösen können, doch die hohen Wahlkampfkosten und die Aussicht auf eine große Wahlkampfkostenerstattung bei der Teilnahme an weiteren Wahlen ließen die Gründungsväter ihre Partei weiterführen, außerdem war sie die Initiativzündung für die Gründung "grüner" Parteien im gesamten Bundesgebiet gewesen.
Um eine Chance auf viele Wählerstimmen und eine ordentliche Wahlkampfkostenerstattung bei der Europawahl 1979 zu haben, schlossen sich GLU, GAZ, AUD und weitere Kleinparteien im März 1979 schließlich zur "Sonstigen Politischen Vereinigung DIE GRÜNEN" (SPV) zusammen und erreichten 3,2% der Stimmen und damit 4,9 Millionen Mark Wahlkampfkostenerstattung (vgl. Raschke 1993: 895).
Der erste Einzug einer grünen Partei in einen deutschen Landtag gelang der BGL in Bremen, welcher als großer Erfolg des "Bremer Modells" gefeiert wurde, das in der folgenden Zeit auch die Gründung der Partei "Die Grünen" beeinflussen sollte: dieses Modell beinhaltete sowohl eine Öffnung zur Integration diverser Positionen (von konservativen bis hin zu sozialistischen), zugleich aber auch eine Abgrenzung zu Kommunistischen Organisationen, vor allem solcher, die in Fragen der Gewaltanwendung anderer Auffassung als die Alternativen waren (vgl. Hallensleben 1984: 188ff.).
Unter Berücksichtigung dieser Ereignisse trafen sich am 12.1.1980 etwa 1000 Delegierte zur Gründungsversammlung der Partei "Die Grünen" in Karlsruhe. Sie begannen, eine Präambel der Satzung zu entwerfen und diskutierten über die gleichzeitige Mitgliedschaft in anderen Parteien. Am Ende stimmen etwa 90% der Delegierten einer Parteigründung zu und die Partei "Die Grünen"- mit neuartigen Forderungen an die politische Agenda und an sich selbst (s.u.)- war ins Leben gerufen (vgl. Raschke 1993: 896).
b) Ihre Grundsätze
Eine eindeutige Bestätigung der These „Die Grünen - Resultat des Wandels zur postindustriellen Gesellschaft“ leitet sich aus dem Parteiprogramm der Partei ab:
Wie sich aus ihrer Entstehungsgeschichte deutlich ablesen lässt, lag die Initiativzündung der grünen Parteigründung in dem Kampf gegen die Atomenergie begründet und dennoch beinhalteten die ersten Parteiprogramme der Grünen ein breitgefächertes Spektrum an Forderungen und Anregungen zur friedlichen und ökologischen Umgestaltung des Staates, sowie „revolutionäre“ Anforderungen an die eigene Parteistruktur.
Bezogen auf die politischen Forderungen der Partei lässt sich aus dem Wählerklientel ablesen (s.II.3.c), dass die neue Partei in ihren Anfängen vor allem von postmaterialistisch eingestellten Menschen Unterstützung bekam. Dementsprechend waren die Forderungen postmaterialistisch orientiert, das heißt, sie spiegelten die Veränderung des Lebensstandards und der gesellschaftlichen Werte wieder. Im Detail umfasste das Grüne Parteiprogramm folgende Kernaussagen, die teilweise bis heute existent geblieben sind:
Grundsätzlich sollten die Menschen sich selbst und ihre Umwelt als Teil der Natur begreifen und aus diesem Grund die Natur auch wie einen Teil von sich selbst behandeln. Ökonomische Ziele sollten nur im Rahmen ökologischer Notwendigkeiten verwirklicht werden (vgl. Lösche 1993: 150).
Wirtschafts- und sozialpolitische Vorstellungen der Grünen waren daraufhin ausgerichtet, Einkommensdifferenzen durch höhere Besteuerung von Großverdienern abzumildern (vgl. Lösche 1993: 150).
Ein weiterer wichtiger Punkt der grünen Programmatik bestand in der Forderung nach mehr Basisdemokratie, sowohl auf der politischen Bühne, als auch auf der innerparteilichen Ebene, was konkret mehr Volksentscheide, sowie eine Verstärkung der Autonomie auf den unteren Ebenen des politischen Systems bedeutete (vgl. Lösche 1993: 151).
Weiter verlangten die Grünen eine Quotierung, um die Stellung der Frau in der Gesellschaft zu verbessern und stellten selbst demonstrativ reine Frauenlisten bei einigen Landtagswahlen (z.B. in Hamburg) auf (vlg. Lösche 1993: 151).
Schließlich lässt sich noch der Punkt Gewaltfreiheit anführen, ein Kernthema der Grünen, welcher vor allem nach deren Gründung auf Bundesebene zu einem der wichtigsten Maximen werden sollte und der Partei, nach deren Einzug in den Bundestag im Jahr 1998, große innerparteiliche Querelen einhandelte.
Wie bereits erwähnt gingen "Die Grünen" weiter über die oppositionellen Forderungen hinaus und stellten ebenfalls an sich selbst hohe basisdemokratische Ansprüche:
Zunächst galt das Prinzip der kollektiven Führung: innerparteiliche Gruppierungen und Flügel wählten Delegierte in einen Vorstand, welcher für die grundsätzlichen Entscheidungen zuständig war. Durch die immerfortwährende Bewährungsprobe der Abgesandten vor ihrem Flügel wurde die innerparteiliche Polarisierung vorangetrieben und Konflikte nicht totgeschwiegen, sondern immer wieder aufgerollt (vlg. Lösche 1993: 155). Weiter führten "Die Grünen"als einzige Partei das Rotationsprinzip ein, wonach ein Abgeordneter nach der Hälfte der Legislaturperiode ausgewechselt wurde, um den Kontakt zur Basis nicht zu verlieren. Das "Imperative Mandat" stand in diesem Fall für die Anbindung des Abgeordneten an die "Basis" in seinem Wahlkreis oder seiner Partei. Auch dies sollte den Abgeordneten immer wieder an seine "Wurzeln" zurückführen, ebenso wie die Idee der Trennung von Amt und Mandat, die besagte, dass Inhaber hoher Parteiämter nicht gleichzeitig Abgeordnete sein durften. Weiter wollten "Die Grünen" durch die Öffentlichkeit der Sitzungen Basisnähe demonstrieren und interessiertem Publikum die Möglichkeit zur Kontrolle der Parteielite geben. Schließlich waren die Abgeordneten der neuen Partei in Bundes- und Landtagen dazu angehalten, einen Teil ihrer Diäten und Aufwandsentschädigungen an die Partei bzw. an einen eigens dafür geschaffenen "Ökofonds" abzuführen (vgl. Kleinert 1992: 296).
Mit den Jahren stellten sich jedoch viele dieser Ideen zur Verbesserung der Basisnähe als nicht durchführbar heraus (vgl. Lösche 1993: 150 ff.), so wurde das Rotationsprinzip wieder zurückgenommen, da ein Abgeordneter zumeist gerade dann wegrotiert wurde, wenn er Kenntnisse auf einem Gebiet erworben hatte. Weiter führte die Trennung von Amt und Mandat des öfteren zu einer Polarisierung zwischen Abgeordneten und Parteiführung, was sich als äußerst hinderlich für die politische Arbeit erwies. Aber trotz einer Vielzahl von Problemen war der Grundgedanke entscheidend, den Forderungen der Bevölkerung nach einem größeren Einfluss auf die Politik nachzukommen und mit Sicherheit trugen diese basisdemokratischen Elemente in der Parteistruktur auch zu der rasanten Mitgliederentwicklung bis ca. 1987 und den Wahlerfolgen in den 80er Jahren bei (vgl. Arzheimer/Klein 1997: 15).
c) Das Wählerklientel
Die These der Überschrift, dass die Grünen das Resultat des Wandels zur Postindustriellen Gesellschaft darstellen, verifiziert sich bei einem Blick auf ihr Wählerklientel. Im folgenden Teil stelle ich verschiedene Eigenschaften der Grünen- Wähler zusammen, die deutlich machen, dass das Klischee von dem jungen, gebildeten und postmaterialistisch eingestellten Wähler (vgl. Raschke 1993: 668) zutrifft. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass sich die Wählerstruktur der Grünen im Laufe der letzten 2 Jahrzehnte geändert hat und ein "Ergrauen" der grünen Partei (vgl. Arzheimer/ Klein: 3) festgestellt wurde, welches sich auf diverse Probleme und Veränderungen in den Jahren nach der Parteigründung zurückführen lassen. Diese Tatsache werde ich jedoch unbearbeitet lassen, da sie zum Zeitpunkt der grünen Parteigründung unrelevant waren.
Die Grünen stellten in ihrem Anfangsstadium eine Sammelpartei dar, die außer den verschiedenen Sektoren der neuen sozialen Bewegungen auch Rechte und Linke umfasste. Dennoch ließ sich ein spezielles Wählerprofil der Partei zum Zeitpunkt ihrer Anfänge herauslesen:
Zunächst sollten sich die befragten Personen im Jahr 1980 selbst in das politische rechts- links- Schema einordnen. Dabei stellt sich heraus, dass sich neben 15% linken und 8% rechten, das Gros der Wähler zu der politischen Mitte zählte (eine links- Orientierung war jedoch unverkennbar, vgl. Raschke 1993: 668).
Eine Umfrage aus dem Jahre 1983 ergab, dass überproportional viele Azubis, Studenten, Abiturienten und Arbeitslose (vgl. auch: Veen 1998: 43) ihre Stimme den "Grünen" gaben, wohingegen der „normale Arbeiter“ in dieser Partei eher unterrepräsentiert war. Damit lösten "Die Grünen" die FDP in diesem Bereich der formalen Bildung ab, ein interessanter Punkt, vor allem in Hinblick auf die Grundidee Carl Beddermanns, der mit der Gründung der USP (später GLU) den Parteien einen Denkzettel verpassen und vor allem die FDP aus dem Landtag „katapultieren“ wollte. Der Wertewandel und die neue Alternative in der Parteienlandschaft ließ die deutsche Bildungselite folglich zu den "Grünen" überwandern.
Die Geschlechterverteilung war bis ins Jahr 1990 in etwa ausgeglichen, erst dann übernahmen die Frauen die Überhand, gleichzeitig konnte ein hoher Anteil an protestantischen und konfessionslosen Wählern festgestellt werden, Katholiken waren in der neuen Partei eine Seltenheit (vgl. Raschke 1993: 673).
Als Hochburgen der Grünen werden bei Kleinert und Raschke die Städte, vor allem solche mit einer Einwohnerzahl über 100.000 und Universitätsstädte genannt, was hinsichtlich der Formierung des grünen Protestes in den ländlichen Gebieten (s.II.3.a) überrascht.
Betrachtet man die - für diese Arbeit essentiell wichtigen- Orientierungen der Grünen- Wähler im Hinblick auf ihre Werte, so ergaben Forschungen, dass eine starke Affinität zwischen den Wählern der neuen Partei und einer postmaterialistischen Werteorientierung bestand (vgl. Raschke 1993: 674). Vor allem die Issues "Umwelt" und "Abrüstung" rangierten in der Präferenzliste der Wähler ganz oben. Daher erstaunt die Tatsache, dass gleichzeitig auch das Thema "Arbeitslosigkeit bekämpfen" sehr weit oben in der eben erwähnten Liste stand, was sowohl auf eine direkte Betroffenheit, als auch auf Erfahrungen oder Befürchtungen bezüglich dieses Themas schließen lässt. Des weiteren wurde festgestellt, dass die Stammwählerschaft der Grünen mit etwa 50% über der der FDP aber deutlich unter dem Wert der beiden großen Volksparteien lag (vgl. Raschke 1993: 674/675).
Zusammenfassend lässt sich das oben bereits angesprochene Bild des jungen, gebildeten und postmaterialistisch eingestellten Grünen- Wählers zur Zeit der Parteigründung bestätigen, welcher -in einer detaillierteren Fortführung des Klischees- protestantischer Konfession oder konfessionslos ist, sich auf der politischen Ebene eher links als rechts einordnet und aus einer großen Stadt mit einer Universität kommt. Unter diesem Gesichtspunkt trifft die These, dass die Grünen das Resultat eines Wandels in der Gesellschaft darstellen, voll zu.
III. Resümee: „Die Grünen“ als „Partei neuen Typs“
Im Laufe dieser Arbeit kristallisierte sich heraus, dass die Grünen eine „Partei neuen Typs“ (Kleinert 1992: 385, Guggenberger 1980: 107) darstellen, „die aus sozialen Protestbewegungen hervorgegangen ist und dadurch charakterisiert sein soll, dass es sich um einen parteipolitischen Organisationsversuch auf dem Felde der „neuen Politik“ handelt“ (Kleinert 1992: 385). Die Einordnung der Partei in die „neue Politik“ stellt folglich eine klare Abgrenzung zu den Parteien aus der Zeit des Materialismus, bzw. zu der „alten Politik“ dar.
Die Behandlung der Entstehung, der Grundsätze und des Wählerklientels der Grünen förderte zu Tage, dass „Die Grünen“ nach der Beseitigung einiger Startprobleme eine immer umfassendere Unterstützungsbasis in der Bevölkerung erwarben und ihre Mitglieder aus unterschiedlichen politischen Lagern und gesellschaftlichen Schichten rekrutieren konnten. Im Gegensatz zu vielen „herkömmlichen“ Parteien in der Bundesrepublik stützte sich die Partei in ihre Anfängen nicht auf eine Gesellschaftsschicht (wie z.B. die SPD auf die Arbeiter), sondern war offen für jene Personen, die postmaterialistische Ziele in den Vordergrund der politischen Tagesordnung drängen wollten.
Auch der Anspruch nicht als Partei fungieren zu wollen stellt ein Novum in der deutschen Parteienlandschaft und eine Konsequenz aus den, dem Wandel zum Postmaterialismus resultierenden, veränderten Vorstellungen von den Funktionen und Aufgaben der Parteien dar. Der von Petra Kelly geprägte Begriff der „Anti-Parteien-Partei“ brachte dieses Selbstverständnis in der Anfangszeit bis etwa zum Jahr 1990 plakativ zum Ausdruck (vgl. Kleinert 1992: 383). „Die Grünen“ beabsichtigten, in Grunde als Protestbewegung erhalten zu bleiben und mit ihrer Intervention auf der politischen Bühne lediglich eine deutlichere Aufmerksamkeit und ein höheres Maß an Respekt zu erhalten.
Weiter setzten sich „Die Grünen“ in Punkto Basisanbindung deutlich von der übrigen Parteienlandschaft ab, womit sie, wie bereits erläutert, dem gestiegenen Anspruch in der Bevölkerung nach Selbstverwirklichung durch Einflussnahme auf die Politik genüge tun wollten; sie schufen neue Formen der Partizipationsmöglichkeiten für die Parteimitglieder und ließen ihre Abgeordneten durch diverse Regelungen und Auflagen kontrollieren, um die geforderte Bindung der Parteielite an die Basis zu erhalten. Die Parteiführung und die Mandatsträger sollten sich –nach Vorstellung der Gründer- nicht als Elite, sondern immer als Repräsentant der Partei und als Kämpfer für die Ideale der Grünen verstehen.
Mit diesen Ansprüchen war die Partei, wie von Guggenberger (1980: 108) im Jahr 1980 bereits prognostiziert, zwar einer Vielzahl korrektiver „Basiseinflüsse“ ausgesetzt, welche ihren Charakter, ihre Organisationsweise und ihre praktisch-politische Orientierung nachhaltig beeinflussen sollten, dennoch waren diese aus den neuen Werten entstandenen Innovationen richtungsweisend für die Politik und Parteistrukturen bis heute.
IV. Literaturliste:
- Ahlemann, Ulrich von 2001: Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland, Opladen: Leske+Budrich
- Arzheimer, Kai/ Klein, Markus 1997: Grau in Grau: Die Grünen und ihre Wähler nach eineinhalb Jahrzehnten, Zitate aus der Internetveröffentlichung, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 49, S. 650- 673
- Bell, Daniel 1985: Die nachindustrielle Gesellschaft, Frankfurt a.M./ New York: Campus
- Bürklin/ Klein 1998: Wahlen und Wählerverhalten. Eine Einführung, 2. Auflage, Opladen: Leske+Budrich
- Bürklin/Klein/Ruß 1994: Dimensionen des Wertewandels, in Politische Vierteljahresschrift, 35, S. 579-606
- Gerlach, Irene: Wertewandel, in: Andersen/Woyke (Hrsg.): Handbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, Opladen: Leske+Budrich, S. 661-664
- Greiffenhagen, Martin und Sylvia 2000: Wertewandel, in: Werte in der politischen Bildung, Schwalbach: Wochenschau Verlag, S. 16-28
- Guggenberger, Bernd 1980: Bürgerinitiativen in der Parteiendemokratie: von der Ökologiebewegung zur Umweltpartei, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz: Kohlhammer.
- Hallensleben, Anna 1984: Von der grünen Liste zur Grünen Partei?, Göttingen/Zürich: Muster- Schmidt
- Inglehart, Ronald 1977: The silent revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Publiks, Princton/ New Jersey: Princeton University Press
- Inglehart, Ronald 1989: Kultureller Umbruch. Wertewandel in der westlichen Welt, Frankfurt/ New York: Campus
- Inglehart, Ronald 1998: Modernisierung und Postmodernisierung. Kultureller, wirtschaftlicher und politischer Wandel in 43 Gesellschaften, Frankfurt a.M./New York: Campus
- Jaide, Walter 1983: Wertewandel? Grundfragen zu e. Diskussion, Leverkusen/ Opladen: Leske+Budrich
- Kaase, Max 1982: Partizipatorische Revolution- Ende der Parteien?, in: Raschke, Joachim, Bürger und Parteien: Ansichten und Analysen einer schwierigen Beziehung, Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 173-189
- Kaase, Max 2000: Politische Beteiligung/Politische Partizipation, in: Andersen/Woyke (Hrsg.): Handbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, Opladen: Leske+Budrich, S. 473-478
- Kirchheimer, Otto 1965: Der Wandel des westdeutschen Parteiensystems, in: Politische Vierteljahresschrift, 6, S. 20-41
- Klages Helmut 1988: Wertedynamik. Über die Wandelbarkeit des Selbstverständlichen, Zürich: Ed. Interfrom
- Klages, Helmut 2001: Werte und Wertewandel in: Schäfers/Zapf (Hrsg.): Handbuch zur Gesellschaft Deutschlands, Opladen: Leske+Budrich, S. 726-738
- Kleinert, Hubert 1992: Aufstieg und Fall der Grünen: Analyse einer alternativen Partei, Bonn: Dietz
- Lösche, Peter 1993: Kleine Geschichte der deutschen Parteien, Stuttgart/Berlin/Köln: Kohlhammer
- Raschke, Joachim 1993: Die Grünen: Wie sie wurden, was sie sind, Köln: Bund
- Rucht, Dieter 1994: Modernisierung und neue soziale Bewegungen. Deutschland, Frankreich und USA im Vergleich, Frankfurt a.M./New York: Campus
- Sarcinelli/Wissel 1998: Mediale Politikvermittlung, politische Beteiligung und politische Bildung: Medienkompetenz als Basisqualifikation in der demokratischen Bürgergesellschaft, in: Sarcinelli (Hrsg.): Politikvermittlung und Demokratie in der Mediengesellschaft, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, S. 408-431
- Sontheimer/Bleek 1999: Grundzüge des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, München: Piper
- Veen, Hans Joachim 1998: Die schwindende Berechenbarkeit der Wähler und die Zukunft des deutschen Parteinsystems - Auch eine Analyse der Bundestagswahlen nach der Vereinigung, in: Oberreuter, Heinrich (Hrsg.), Ungewissheiten der Macht. Parteien, Wähler, Wahlentscheidung, München: Olzog, S. 42-67
Häufig gestellte Fragen
- Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit über „Die Grünen“?
- Diese Hausarbeit analysiert die Ursachen für die Entstehung der Partei "Die Grünen" in Deutschland und untersucht, inwiefern die Partei das Ergebnis eines gesellschaftlichen Wandels, insbesondere des Wertewandels zur postindustriellen Gesellschaft, verkörpert. Die Arbeit vergleicht "Die Grünen" mit den etablierten Volksparteien und beleuchtet die Neuerungen, die sie in die deutsche Parteienlandschaft einbrachten.
- Welche Hauptthemen werden in der Arbeit behandelt?
- Die Hauptthemen umfassen den Wertewandel in der deutschen Gesellschaft seit den 1960er Jahren, neue Formen politischer Partizipation, Herausforderungen für die Politik durch verändertes Wahlverhalten und die Krise der Volksparteien, sowie die Entstehung neuer sozialer Bewegungen. Die Arbeit geht auch auf die Gründung, die Grundsätze und das Wählerklientel der Partei "Die Grünen" ein.
- Was wird unter dem Begriff "Wertewandel" in dieser Arbeit verstanden?
- Der Wertewandel wird als ein Übergang von materialistischen zu postmaterialistischen Werten beschrieben. Dieser Wandel beeinflusste die politische Agenda und führte zu neuen Formen der politischen Beteiligung. Die Arbeit diskutiert verschiedene Theorien zum Wertewandel, darunter Ingleharts "Silent Revolution" und Klages' Wandel von Pflicht- und Akzeptanzwerten zu Selbstentfaltungswerten.
- Welche Rolle spielen neue Formen politischer Partizipation bei der Entstehung der "Grünen"?
- Die Arbeit argumentiert, dass die Forderung nach mehr Mitspracherechten und direkter politischer Beteiligung, ausgelöst durch den Wertewandel, zur Unzufriedenheit mit dem traditionellen Wahlakt führte. Bürgerinitiativen und neue soziale Bewegungen entstanden, um Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen. "Die Grünen" versuchten, diese neuen Ansprüche nach politischer Mitbestimmung in ihr Konzept zu integrieren.
- Wie beeinflusste das veränderte Wahlverhalten die Politik und die Volksparteien?
- Der Wertewandel führte zu einer neuen Trennungslinie in der Politik, die über die traditionelle rechts-links-Einteilung hinausging. Die Wahlbeteiligung sank, und extreme Parteien gewannen an Bedeutung. Die Volksparteien (CDU und SPD) erlitten Verluste an Mitgliedern und Wählerstimmen, da ihre Mitglieder nur wenig Möglichkeit zur Selbstentfaltung hatten.
- Wie trugen neue soziale Bewegungen zur Entstehung der "Grünen" bei?
- Neue soziale Bewegungen, wie die Friedens-, Öko- und Frauenbewegung, spielten eine zentrale Rolle bei der Entstehung der "Grünen". Da die Forderungen dieser Bewegungen von der Regierung oft ignoriert wurden, erkannten Einzelpersonen die Notwendigkeit einer politischen Vertretung in Form einer Partei. Die Grünen entstanden somit aus dem Wunsch, die Anliegen dieser Bewegungen in die politische Arena zu tragen.
- Welche Grundsätze vertraten "Die Grünen" bei ihrer Gründung?
- Die Grünen setzten sich für ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, Basisdemokratie, Gewaltfreiheit und die Gleichstellung der Geschlechter ein. Sie forderten mehr Bürgerbeteiligung, eine stärkere Gewichtung ökologischer Aspekte in der Wirtschaftspolitik und eine friedliche Konfliktlösung.
- Wie sah das Wählerklientel der "Grünen" in ihren Anfängen aus?
- Das Wählerklientel der "Grünen" bestand hauptsächlich aus jungen, gebildeten und postmaterialistisch eingestellten Menschen. Zu den Wählern zählten überproportional viele Studenten, Abiturienten und Arbeitslose. Auch Anhänger der Friedens-, Anti-Atomkraft- und Frauenbewegung wählten oft die Grünen.
- Inwiefern stellen "Die Grünen" eine "Partei neuen Typs" dar?
- Die Grünen werden als eine "Partei neuen Typs" betrachtet, da sie aus sozialen Protestbewegungen hervorgingen und versuchten, neue Formen der politischen Organisation und Partizipation zu etablieren. Sie grenzten sich von den traditionellen Parteien ab und setzten auf Basisdemokratie, Transparenz und die Einbeziehung der Mitglieder in politische Entscheidungsprozesse.
- Welche Literatur wurde für diese Hausarbeit verwendet?
- Die Hausarbeit stützt sich auf eine Vielzahl von wissenschaftlichen Werken, darunter Arbeiten von Ulrich von Ahlemann, Kai Arzheimer, Daniel Bell, Max Kaase, Otto Kirchheimer, Ronald Inglehart, Helmut Klages und Joachim Raschke. Eine vollständige Literaturliste befindet sich am Ende der Arbeit.
- Arbeit zitieren
- Benjamin Miethling (Autor:in), 2001, Die Grünen - Resultat des Wandels zum Postmaterialismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109144