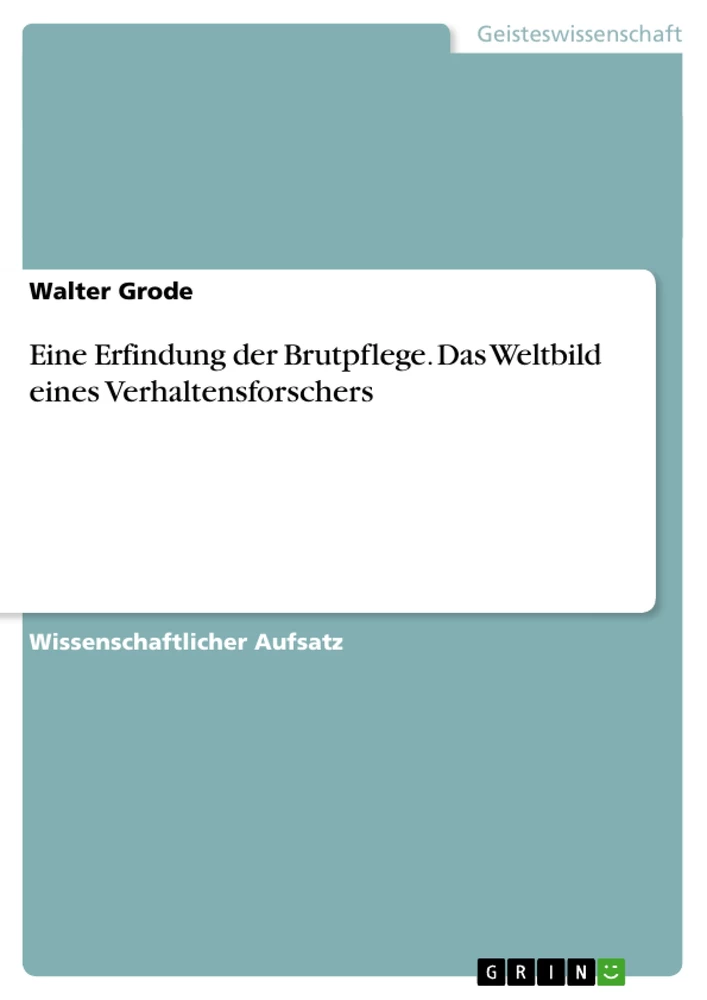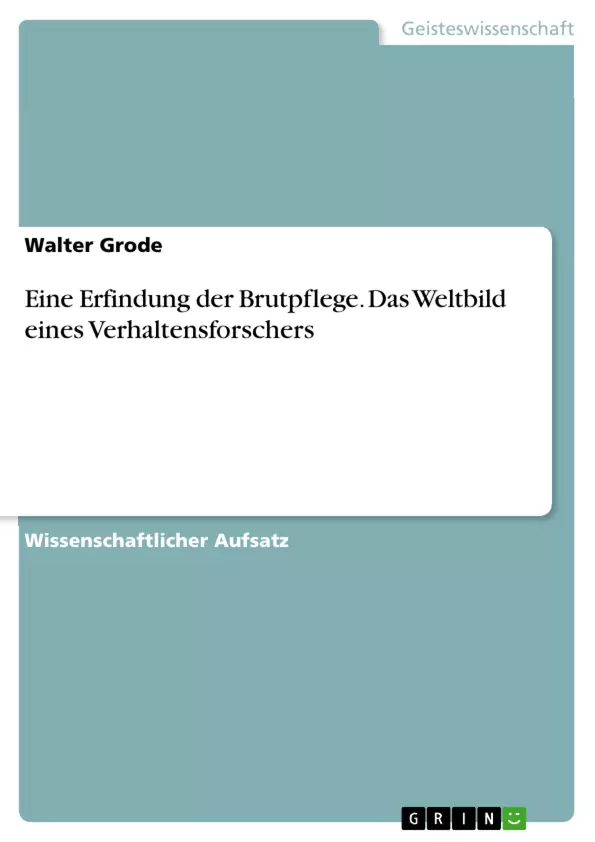Walter Grode
Eine Erfindung der Brutpflege. Das Weltbild eines Verhaltensforschers
(Rezensionessay zu: Irenäus Eibl-Eibesfeldt: Der Mensch - Das riskierte Wesen. Zur Naturgeschichte menschlicher Unvernunft. München 1991. Erschienen in: Lutherische Monatshefte, Heft 11/1991, S. 514/ 515.]
Auch in der Neuausgabe seines Buches zur Geschichte menschlicher Unvernunft erweist sich der Zoologe und Ethologe Irenäus Eibl-Eibesfeldt einmal mehr als ein Forscher, der die Ergebnisse seines Fachs in brillanter Weise populärwissenschaftlich darzustellen weiß.
Und diese Ergebnisse bieten durchaus Anlaß zur Nachdenklichkeit. So kann die vergleichende Verhaltensforschung einen gewichtigen gedanklichen Anstoß für die Diskussion über die Hilfe der westlichen Industrieländer für die Dritte Welt liefern, der über die bekannte Kritik an der Ineffizienz der Entwicklungshilfe hinausgeht, wenn sie darauf verweist, alles Geben müsse, wenn es freundlich sein und ein Band knüpfen und festigen solle, auf Reziprozität angelegt sein. Und dieser Grundsatz sollte erst recht für das Zusammenwachsen der beiden Teile Deutschlands gelten.
Ähnliches gilt für die Erkenntnis der Ethologie, wir hätten keinen Sinn für Ereignisse, die nach der Wahrscheinlichkeit seltener eintreten als einmal pro Menschenleben. Denn unser biologisches Erbe ist räumlich und zeitlich an die Bedingungen der Kleingesellschaften der Jäger und Sammler angepaßt. Diese Naturausstattung - und da ist Eibesfeldts Diagnose zweifellos zuzustimmen - reicht offensichtlich allein nicht mehr aus, um adäquate Antworten auf die globalen Zukunftsfragen zu geben.
Nun ließe sich ja aus der Erkenntnis, daß der Mensch den Kräften, die er entfesselt hat, nicht gewachsen ist, durchaus die Forderung herleiten, es müsse nun besondere Vorsicht, Behutsamkeit und Verantwortung im Umgang zwischen den Menschen und der Natur walten.
[EIB: R / 24.6.91]
Walter Grode
Eine Erfindung der Brutpflege. Das Weltbild eines Verhaltensforschers
(Rezensionessay zu: Irenäus Eibl-Eibesfeldt: Der Mensch - Das riskierte Wesen. Zur Naturgeschichte menschlicher Unvernunft. München 1991. Erschienen in: Lutherische Monatshefte, Heft 11/1991, S. 514/ 515.]
Auch in der Neuausgabe seines Buches zur Geschichte menschlicher Unvernunft erweist sich der Zoologe und Ethologe Irenäus Eibl-Eibesfeldt einmal mehr als ein Forscher, der die Ergebnisse seines Fachs in brillanter Weise populärwissenschaftlich darzustellen weiß.
Und diese Ergebnisse bieten durchaus Anlaß zur Nachdenklichkeit. So kann die vergleichende Verhaltensforschung einen gewichtigen gedanklichen Anstoß für die Diskussion über die Hilfe der westlichen Industrieländer für die Dritte Welt liefern, der über die bekannte Kritik an der Ineffizienz der Entwicklungshilfe hinausgeht, wenn sie darauf verweist, alles Geben müsse, wenn es freundlich sein und ein Band knüpfen und festigen solle, auf Reziprozität angelegt sein. Und dieser Grundsatz sollte erst recht für das Zusammenwachsen der beiden Teile Deutschlands gelten.
Ähnliches gilt für die Erkenntnis der Ethologie, wir hätten keinen Sinn für Ereignisse, die nach der Wahrscheinlichkeit seltener eintreten als einmal pro Menschenleben. Denn unser biologisches Erbe ist räumlich und zeitlich an die Bedingungen der Kleingesellschaften der Jäger und Sammler angepaßt. Diese Naturausstattung - und da ist Eibesfeldts Diagnose zweifellos zuzustimmen - reicht offensichtlich allein nicht mehr aus, um adäquate Antworten auf die globalen Zukunftsfragen zu geben.
Nun ließe sich ja aus der Erkenntnis, daß der Mensch den Kräften, die er entfesselt hat, nicht gewachsen ist, durchaus die Forderung herleiten, es müsse nun besondere Vorsicht, Behutsamkeit und Verantwortung im Umgang zwischen den Menschen und der Natur walten.
Doch das ist Eibesfeldts Sache nicht. Denn er ist nicht nur ein Naturwissenschaftler, sondern auch ein Ideologe von hohen Graden, der die Ergebnisse seines Fachs und seine eigene "Privatphilosophie" in beeindruckender Weise miteinanander vermengt, die es unmöglich macht seine Position "ohne Furcht und Hader" zu würdigen.
Anknüpfend an real vorhandene gesellschaftliche Mißstände, wie beispielsweise die ökologische Situation, versucht er nicht etwa den Ursachen nachzugehen, sondern zieht auf der Erscheinungsebene Parallelen zu zoologischen und ethologischen Forschungen, die er dann übergangslos auf das zwischenmenschliche Zusammenleben überträgt. Damit schwebt seine Botschaft stets in der Gefahr den deutschen Stammtischen wissenschaftlich verbrämtes, ideologisches Unterfutter zu liefern.
Hierzu eine Kostprobe unter vielen: Vollkommen zutreffend beklagt Eibl-Eibesfeldt die zunehmende Degradierung der Landschaft durch Straßenbau, Industrie und Luftverschmutzung und plädiert für ein "Gesundschrumpfen". Schrumpfen soll jedoch nicht etwa unser Naturverbrauch, sondern unsere Geburtenrate. Das heißt, eigentlich nicht "unsere", denn die ist ja - mit 1,5 Kindern "auf eine verheiratete deutsche Frau" - durchaus in Ordnung. Denn getragen wird unsere Geburtenrate von einer Reproduktionsstrategie, die in wenige Nachkommen viel Energie investiert.
Doch ist dies - wie uns die Verhaltensforschung lehrt - nicht die einzige Reproduktionsstrategie: unter Bedingungen der "Neubesiedlung von Lebensräumen" wird von verschiedenen Arten die Strategie angewandt, eine möglichst große Zahl von Nachkommen in die Welt zu setzten. Hätten sie dieses Vorwissen, so würden die bundesdeutschen Politiker, nach Ansicht von Eibl-Eibesfeldt, sicherlich nicht weiterhin eine solch "gedankenlose Einwanderungspolitik" betreiben. Denn bereits 1981 entfielen auf eine verheiratete türkische Frau statistisch 3,5 Kinder. Hält dieser Trend an, dann "kommt es unausweichlich zur Verdrängung des eigenen biologischen Erbes". Und die Fähigkeit, in Nachkommen zu überleben, d.h. sein Erbgut zu tradieren, bleibt für Eibesfeldt nach wie vor das Kriterium, an dem sich Eignung mißt.
Doch sollten diese Aussagen keineswegs dazu verleiten Irenäus Eibl-Eibesfeldt vorschnell als Ewig-Gestrigen abzustempeln. Denn sein Projekt ist gleichermaßen zukunftsorientiert und darin liegt seine eigentliche Gefährlichkeit. So unternimmt er keineswegs den Versuch den überholten Nachweis der Überlegenheit bestimmter Gruppen oder Völker über andere zu führen. Statt dessen propagiert er - stets anknüpfend an seine seriösen ethologischen Forschungsergebnisse, daß es allgemeine Bedingungen gibt, die grundlegend sind für die gedeihliche Entwicklung sämtlicher Populationen, bis hin zu den von den Menschen selbst geschaffenen gesellschaftlichen Organisationen. Und zu diesen Bedingungen gehört für ihn zweifellos und zuförderst das quasi natürliche Bedürfnis nach Abgrenzung.
Denn weil "der Mensch an sich", ein Wesen ist, das an die Kleingesellschaft angepaßt ist, wird er seine Probleme nur lösen, wenn er unter sich - in der eigenen Gruppe, dem eigenen Volk, der eigenen Kultur - bleibt. Alles andere führt zum Verlust der ethnischen Vielfalt. Und so fordert Eibesfeldt das Recht auf ungestörte Entwicklung für die Buschleute in der Kalahari und - in majestätischer Gleichheit - natürlich auch für uns selbst, die Angehörigen des gesicherten Teils der westlichen Zwei-Drittel-Gesellschaften.
Doch damit nicht genug: Wenn die kulturelle Differenz die wahrhaft "natürliche Umwelt" des Menschen bildet, gleichsam die Atmosphäre, ohne die sein historischer Atem nicht möglich wäre, dann muß jede Verwischung dieser Differenz notwendig Abwehrreaktionen auslösen, zu interethnischen Konflikten und generell zu einem Anstieg der Aggressivität führen.
Die Abgeschlossenheit der Kulturen und Traditionen ist also - folgt man Eibesfeldts Vorstellung von Multikulturalität - zugleich der beste Garant gegen Xenophobie und gesellschaftliche Aggessivität. Zudem ist sie von lebenswichtiger Bedeutung für die Akkumulation unserer individuellen und gesellschaftlichen Fähigkeiten, bis hin zur moralisch ungestörten Entwicklung unseres westlichen Lebensstandards und unserer Spitzentechnologien.
Denn wenn es richtig ist, daß jede Gruppe nicht nur das Recht, sondern "vor den Schranken des biologischen Gerichts" geradezu die Pflicht hat, zunächst ihr eigenes biologisches Erbe zu wahren und zu mehren, dann ist es zumindest legitim die Spitzenleistungen unserer Zivilisation immer weiter zu steigern - das Leben einiger Menschengruppen immer weiter zu verlängern und gleichzeitig vor dem Hunger in Afrika, der Cholera in Südamerika und dem Zerfall unserer großen Städten die Augen zu verschließen.
Daß Eibl-Eibesfeldt damit auch die Einheit des Menschengeschlechts und das spezifisch Menschliche überhaupt in Frage stellt, nimmt er zumindest billigend in Kauf. Denn für ihn sind Empfindungen wie Freundlichkeit und persönliche Bindung nicht der Ausdruck von spezifischer Humanität, sondern eine Folge der "Erfindung der Brutpflege".
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Walter Grodes Rezensionessay zu Irenäus Eibl-Eibesfeldts Buch "Der Mensch - Das riskierte Wesen"?
Der Essay befasst sich kritisch mit Irenäus Eibl-Eibesfeldts Buch, in dem er verhaltensbiologische Erkenntnisse mit einer eigenen Ideologie vermischt. Grode analysiert, wie Eibl-Eibesfeldt Forschungsergebnisse popularisiert und sie für seine Thesen über Gesellschaft, Kultur und die Rolle des Menschen verwendet.
Welche Kritik äußert Grode an Eibl-Eibesfeldts Ansatz?
Grode kritisiert, dass Eibl-Eibesfeldt gesellschaftliche Probleme auf oberflächlicher Ebene betrachtet und Parallelen zu zoologischen Forschungen zieht, die er dann unzulässig auf das menschliche Zusammenleben überträgt. Dies birgt die Gefahr, ideologisches Gedankengut zu verbreiten.
Was ist Eibl-Eibesfeldts Position zur Geburtenrate und Einwanderung?
Eibl-Eibesfeldt beklagt die sinkende Geburtenrate in Deutschland und sieht in der Einwanderungspolitik eine Gefahr für das "eigene biologische Erbe". Er argumentiert, dass verschiedene Reproduktionsstrategien existieren und dass die hohe Geburtenrate von Einwanderern zu einer Verdrängung führen könne.
Welche Rolle spielt das Bedürfnis nach Abgrenzung in Eibl-Eibesfeldts Weltbild?
Eibl-Eibesfeldt glaubt, dass Menschen, da sie an Kleingesellschaften angepasst sind, ihre Probleme am besten lösen, wenn sie unter sich bleiben – in der eigenen Gruppe, dem eigenen Volk, der eigenen Kultur. Er sieht die Abgeschlossenheit von Kulturen als Garant gegen Fremdenfeindlichkeit und Aggressivität.
Welche Schlussfolgerung zieht Grode über Eibl-Eibesfeldts Werk?
Grode sieht Eibl-Eibesfeldts Werk als eine bewusste Provokation jeglicher Humanität. Er befürchtet, dass es im Alltagsbewusstsein den Eindruck erwecken könnte, die Ausgrenzung des Fremden sei ein einfacher Weg, Identität und Autonomie zu sichern.
Worin liegt laut Grode die Gefährlichkeit von Eibl-Eibesfeldts Thesen?
Die Gefährlichkeit liegt darin, dass Eibl-Eibesfeldt nicht den Versuch unternimmt, die Überlegenheit bestimmter Gruppen oder Völker zu beweisen, sondern allgemeine Bedingungen propagiert, die für die gedeihliche Entwicklung aller Populationen, einschließlich der menschlichen Gesellschaften, grundlegend sein sollen. Dazu gehört für ihn das Bedürfnis nach Abgrenzung.
Was versteht Eibl-Eibesfeldt unter "der Erfindung der Brutpflege"?
Laut Eibl-Eibesfeldt sind Empfindungen wie Freundlichkeit und persönliche Bindung nicht Ausdruck spezifischer Humanität, sondern eine Folge der "Erfindung der Brutpflege". Dies deutet darauf hin, dass er zwischenmenschliche Beziehungen eher als biologisch bedingt und weniger als Ausdruck von menschlicher Einzigartigkeit betrachtet.
- Arbeit zitieren
- Dr. phil. Walter Grode (Autor:in), 1991, Eine Erfindung der Brutpflege. Das Weltbild eines Verhaltensforschers, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109263