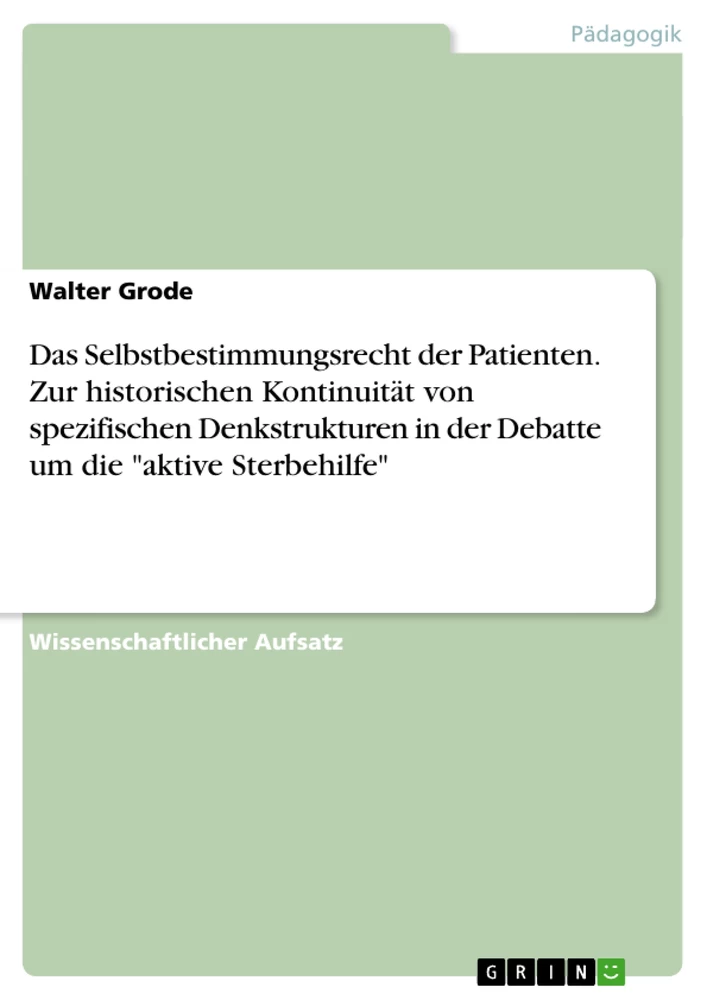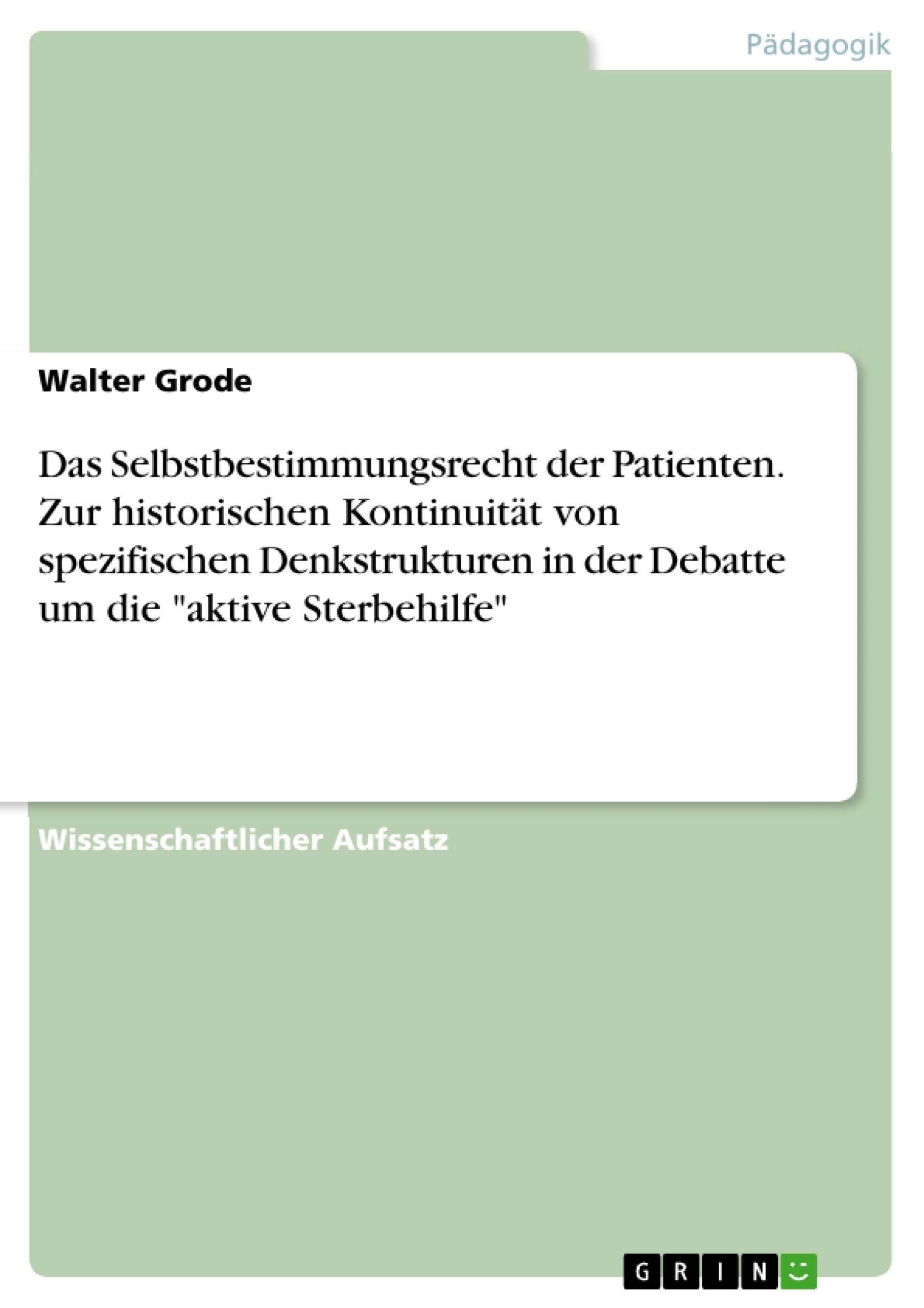1. Zum politisch/ideologischen Umfeld der Diskussion um die "aktive Sterbehilfe"
1.1. Versuche der Umdefinition von Geschichte
Wohl augenfälligstes Beispiel für die oben angerissene Entwicklung ist der sog. "Historikerstreit". Ein zentrales Element dieser Auseinandersetzung ist dabei die Infragestellung der "Singularität" der nationalsozialistischen Gewaltverbrechen:
"Es ist ein auffallender Mangel der Literatur über den Nationalsozialismus, daß sie nicht weiß oder nicht wahrhaben will in welchem Ausmaß all dasjenige, was die Nationalsozialisten später taten, mit alleiniger Ausnahme des technischen Vorgangs der Vergasung, in einer umfangreichen Literatur der frühen zwanziger Jahre bereits beschrieben war. ... Vollbrachten die Nationalsozialisten, vollbrachte Hitler eine >asiatische< Tat vielleicht nur deshalb, weil sich und ihresgleichen als potentielle oder wirkliche Opfer einer >asiatischen< Tat betrachteten? War nicht der >Archipel GULag< ursprünglicher als Auschwitz? War nicht der >Klassenmord< der Bolschewiki das logische und faktische Prius des >Rassenmords< der Nationalsozialisten?".
Bei dieser Auseinandersetzung handelt es weniger um eine fachwissenschaftliche Kontroverse, sondern vielmehr um die Umdefinition von Geschichte in politischer Absicht:
"Orientierungsverlust und Identitätssuche sind Geschwister. Wer aber meint, daß alle dies auf Politik und Zukunft keine Wirkung habe, der ignoriert, daß in geschichtslosem Land die Zukunft gewinnt, wer die Erinnerung füllt, die Begriffe prägt und die Vergangenheit deutet."
Es geht also im Kern um die Neudefinition von bundesrepublikanischer historischer Kontinuität, die unbelastet ist von der "Moral der Geschichte".
Inhaltsübersicht:
1. Zum politisch/ideologischen Umfeld der Diskussion um die "aktive Sterbehilfe" 2
1.1. Versuche der Umdefinition von Geschichte
1.2. Der aktuelle Kontext
2. Die verdrängten historischen Argumentationsstrukturen
2.1. Die "straffreie Erlösungstat"
2.2. "Defektmenschen und nutzlose Esser"
2.3. Gesetzliche Regelungsversuche
3. Zur aktuellen Debatte um die "Sterbehilfe"
3.1. Zum Umgang mit der Vorgeschichte
3.2. Die aktuelle Auseinandersezung
4. Fragwürdige Perspektiven
ANMERKUNGEN
LITERATURVERZEICHNIS
Walter Grode
DAS SELBSTBESTIMMUNGSRECHT DER PATIENTEN
Zur historischen Kontinuität von spezifischen Denkstrukturen
in der Debatte um die "aktive Sterbehilfe"
(Erstmalig erschienen in: >Behindertenpädagogik< Vierteljahresschrift für Behindertenpädagogik und Integration Behinderter, 27. Jg., Heft 3/1988, S. 286-295)
In den vergangenen Jahren läßt sich in der publizistischen Öffentlichkeit verstärkt eine Entwicklung beobachten, die man als den Versuch der ideologische Zersetzung eines zentralen gesellschaftlichen Konsensbereichs der Bundesrepublik charakterisieren könnte: die Nichtinfragestellung des Ausnahmecharakters der NS-Verbrechen. Es ist dies der Versuch, "die Hypotheken einer glücklich entmoralisierten Vergangenheit abzuschütteln."1
1. Zum politisch/ideologischen Umfeld der Diskussion um die "aktive Sterbehilfe"
1.1. Versuche der Umdefinition von Geschichte
Wohl augenfälligstes Beispiel für die oben angerissene Entwicklung ist der sog. "Historikerstreit".2 Ein zentrales Element dieser Auseinandersetzung ist dabei die Infragestellung der "Singularität" der nationalsozialistischen Gewaltverbrechen:
"Es ist ein auffallender Mangel der Literatur über den Nationalsozialismus, daß sie nicht weiß oder nicht wahrhaben will in welchem Ausmaß all dasjenige, was die Nationalsozialisten später taten, mit alleiniger Ausnahme des technischen Vorgangs der Vergasung, in einer umfangreichen Literatur der frühen zwanziger Jahre bereits beschrieben war. ... Vollbrachten die Nationalsozialisten, vollbrachte Hitler eine >asiatische< Tat vielleicht nur deshalb, weil sich und ihresgleichen als potentielle oder wirkliche Opfer einer >asiatischen< Tat betrachteten? War nicht der >Archipel GULag< ursprünglicher als Auschwitz? War nicht der >Klassenmord< der Bolschewiki das logische und faktische Prius des >Rassenmords< der Nationalsozialisten?".3
Bei dieser Auseinandersetzung handelt es weniger um eine fachwissenschaftliche Kontroverse, sondern vielmehr um die Umdefinition von Geschichte in politischer Absicht:
"Orientierungsverlust und Identitätssuche sind Geschwister. Wer aber meint, daß alle dies auf Politik und Zukunft keine Wirkung habe, der ignoriert, daß in geschichtslosem Land die Zukunft gewinnt, wer die Erinnerung füllt, die Begriffe prägt und die Vergangenheit deutet."4
Es geht also im Kern um die Neudefinition von bundesrepublikanischer historischer Kontinuität, die unbelastet ist von der "Moral der Geschichte".5
1.2. Der aktuelle Kontext
In die gleiche Richtung zielt auf ideologischer Ebene auch die Auseinandersetzung um die sog. "aktive Sterbehilfe". Auch sie richtet sich direkt auf den moralischen Kern bundesdeutscher Geschichte, das Tabu der Nichtinfragestellung der NS-Verbrechen.
Welchen Druck diese Kontroverse inzwischen ausübt und welche Dämme hier ins Wanken geraten können zeigt nicht zuletzt das selbstgewählte und rhetorische, vor dem Hintergrund der Sterbehilfediskussion jedoch aufgezwungen wirkende Motto der Podiumsdiskussion der "5. Internationalen Fachausstellung für Rehabiltationshilfen" vom 23.-26.März 1988 in Karlsruhe: >Bedeutet die aktive Sterbehilfe das Ende der Rehabilitation?<
Die von den Befürwortern der aktiven Sterbehilfe um die "Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben" (DGHS) und den Medizinprofessor Julius Hackethal vorgebrachten Forderungen nach Einschränkung der Intensivmedzin, insbesondere für alte Menschen, werden nicht zuletzt deshalb in einer breiten Öffentlichkeit akzeptiert, weil sie anscheinend einen Bezug zum Selbstbestimmungsrecht der Patienten herstellen.
Da nicht zuletzt auch kritische Bevölkerungsgruppen diese Kritik teilen und von der Medienwirkung der DGHS und Hackethals nicht unberührt bleiben, scheint hier die entscheidende Bruchstelle zu liegen, auf die gesamte Auseinandersetzung zielt.
Im folgenden soll deshalb aufgezeigt werden, daß dieses Anknüpfen am Selbstbestimmungsrecht des einzelnen Patienten keineswegs ein von den gegenwärtigen Protagonisten der aktiven Sterbehilfe "entdeckt" worden ist, sondern daß es sich um die Reaktivierung von Denkstrukturen handelt, die historisch als ideologische Wegbereiter der Lebensvernichtung im Nationalsozialismus anzusehen sind.6
2. Die verdrängten historischen Argumentationsstrukturen
Bereits unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg erreichte die Diskussion um den Wert und das Lebensrecht des einzelnen Menschen einen ersten Höhepunkt, als der Neuropathologe Alfred Hoche und der renomierte Strafrechtler Karl Binding ihre vom Umfang her recht schmale Schrift "Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens - ihr Maß und ihre Form"7 veröffentlichten.
Vor dem Hintergrund der desolaten wirtschaftlichen Situation in Deutschland wurde nach 1918 die Geburtenfrage zur "Daseinsfrage" und zur "Schicksalsfrage des deutschen Volkes" erhoben.8 Auf der anderen Seite wurde Fragen nach dem Wert des einzelnen Menschen für die Volksgemeinschaft, nach dem Lebensrecht von kranken und behinderten Menschen, ein immer stärkeres Gewicht eingeräumt.9
Mit Blick auf die gegenwärtig neu entfachte Diskussion über die "aktive Sterbehilfe" ist es durchaus lohnend, diese kurze, aber von ihrer Argumentationsweise her äußerst einflußreiche und für die spätere Entwicklung grundlegende Publikation von Binding und Hoche genauer zu betrachten. Denn fast sämtliche Diskurse, die heute die Debatte so doppelbödig machen, sind hier bereits von den Autoren miterstaunlicher Prägnanz herausgearbeitet worden.
2.1. Die "straffreie Erlösungstat"
Der Strafrechtsprofessor Binding, über der Drucklegung der Veröffentlichung hochgeehrt verstorben, widmet sich zunächst der Frage, ob die Tötung eines unheilbar Kranken mit seiner Einwilligung einen Strafausschließungsgrund ermögliche. Er entwickelt am Beispiel des körperlich Schwerkranken, des Unfallpatienten, - heute würde er wahrscheinlich von einem Patienten der Intensivmedizin sprechen - die Denkfigur der "straffreien Erlösungstat".
Die "Erlösungstat", so schreibt Binding, müsse als "Erlösung mindestens für ihn [den Kranken, W.G.] empfunden werden, sonst verbiete sich ihre Freigabe von selbst."10
Im folgenden faßt dann der Autor drei Gruppen von Menschen zusammen, für die diese rechtlich unverbotene Tötung gelten soll:
1. "Die unrettbar Verlorenen", "die zufolge Krankheit oder Verwundung ... im vollen Verständnis ihrer Lage den dringenden Wunsch nach Erlösung besitzen und ihn in irgendeiner Weise zu erkennen gegeben haben."11
2. Eine Mittelgruppe aus "geistig gesunden Personlichkeiten, die durch irgendein Ereignis, etwa sehr schwere, zweifellos tödliche Verwundung, bewußtlos geworden sind, und die, wenn sie aus ihrer Bewußtlosigkeit noch einmal erwachen sollten, zu einem namenlosen Elend erwachen würden"12 und
3. "unheilbar Blödsinnige - einerlei ob sie so geboren oder etwa wie die Paralytiker im letzten Stadium ihres Leidens so geworden sind."13
Über diesen ersten Zwischenschritt kommt Binding sodann zu der Frage bei der sich juristisches Denken und Sozialdarwinismus untrennbar miteinander vermischen: "Gibt es Menschenleben, die so stark die Eigenschaft des Rechtsgutes eingebüßt haben, daß ihre Fortdauer für die Lebensträger wie für die Gesellschaft dauernd allen Wert verloren hat?"14
Die Qualität des einzelnen Lebens für den Lebensträger und für die Gemeinschaft sei, so der Vorschlag des Rechtswissenschaftlers Binding, auf allgemeiner Grundlage abzuschätzen. Mit der Einführung dieses Maßstabs beginnt sich sein Thema, daß ursprünglich unter der euphemistischen Vokabel "Erlösungstat" stand, grundlegend zu wandeln. Ausschlaggebend wird jetzt der Wert des einzelnen Menschen für die Gemeinschaft. Die Leistung der Gemeinschaft in der Form von Pflegearbeit oder Pflegekosten wird nun dem Lebensbeitrag des einzelnen Kranken oder behinderten Menschen gegenübergestellt.
Durch dieses Argumentationsmuster gelangt K. Binding bei der Bewertung der Frage, ob die Tötung von Geisteskranken eine erlaubte straffreie Erlösungstat sei, nach ausführlicher Abwägung schließlich zu dem Urteil, daß die Tötung der "Blöden" weniger Unrecht sei als ihr Weiterlebenlassen.15
Damit konstituiert Binding einen neuen fundamentalen Gedankengang, der für die späteren Diskussionen von grundsätzlicher Bedeutung sein wird: Die Wendung vom "Erlösungstod" der wenigen leidenden Kriegsverletzten oder Unfallpatienten hin zur bevölkerungspolitischen Frage der Vernichtung "lebensunwerten Lebens".
Es muß allerdings einschränkend festgehalten werden, daß Binding in der Tradition des rechtswissenschaftlichen Denkens eine Reihe von Abwägungen und Entscheidungsschwellen in sein Konzept eingebaute. Diese Schranken beziehen sich allerdings immer auf Menschen, die körperlich aussichtslos krank sind und selbst den Tod herbeisehnen. Hier setzt er einen noch vorhandenen Lebenswillen als höherwertig an als die Entscheidung durch Dritte. Von vornherein spricht er demgegenüber den geistig Behinderten und psychisch Kranken die Einwilligungsfähigkeit und den Lebenswillen ab. Binding legte "damit den Grundstein für die späteren systematischen Tötungen derjenigen, die als lebensunwert bewertet werden."16
2.2. "Defektmenschen und nutzlose Esser"
Im zweiten Teil des Buches, den "Ärztlichen Bemerkungen von Professor Dr. A. Hoche"17 treten diese Gedanken der Nützlichkeit eines Menschenlebens und seines Wertes für die Volksgemeinschaft noch deutlicher und in sprachlich weniger verhüllter Form hervor. Nur noch am Rande berührt Hoche die Problematik Tötung auf Verlangen, um sich um so ausführlicher auf die Tötung "nutzloser Esser" und "unheilbar Blödsinniger" zu konzentrieren. Von Alfred E. Hoche stammen die Begriffe, die später die Debatte bestimmt haben: "Ballastexistenzen", "Defektmenschen", "leere Menschenhülsen". Er ist es auch, der erstmals die eingängigen Rechnungen aufstellte, die im Nationalsozialismus in die Mathematik-Bücher der Schulen eingingen.18
Es sei, so Hoche, eine "peinliche Vorstellung, daß ganze Generationen von Pflegern neben diesen leeren Menschenhülsen dahinaltern, von denen nicht wenige 70 Jahre und älter werden."19
Daraufhin kommt Hoche zur Kennzeichnung derjenigen Menschengruppen, die eine "wirtschaftliche und moralische Belastung" für die Volksgemeinschaft darstellen. Kriterien für die Tötung sollen sein: "Fremdkörpercharakter ... im Gefüge der menschlichen Gesellschaft", "Fehlen irgendwelcher produktiven Leistungen", "Zustand völliger Hilflosigkeit und der Notwendigkeit der Versorgung durch Dritte", "Fehlen des Selbstbewußtseins", "intellektuelles Niveau, das wir erst tief unten in der Tierreihe wiederfinden". 20
Die beiden Autoren unterscheiden mit kaum mehr zu überbietendem Antihumanismus zwischen der Tötung unheilbar Kranker und der Vernichtung "lebensunwerten Lebens", eines ihrer Meinung nach so minderwertigen Lebens, daß es nicht tötungsfähig war, sondern nur vernichtet werden konnte.
Die eigentliche Brisanz der Ausführungen von Binding und Hoche liegt jedoch in der vollzogenen gedanklichen Verknüpfung dieser antihumanistischen Elemente und ihrer Blickrichtung auf die Wertbestimmung durch ihren Nutzen für die "Volksgemeinschaft" mit ihrer Denkfigur der "Mitleidstat". Auf diese Weise legen Bindig und Hoche die ideologische Grundlage dafür, daß die Nationalsozialisten ihre Vernichtungsaktionen an psychisch Kranken und Behinderten später mit den euphemistischen Begriffen "Gnadentod" und "Euthanasie" [griech.: >Schöner Tod<] ummänteln konnten.
Diese zunächst nur verbale Herabsetzung der für das Volksganze angeblich nicht tragbaren Menschen und die Berechnung ihres "Wertes" war gewissermaßen die ideologisch notwendige Vorstufe für die Durchsetzung einer Rassenpolitik, in deren Rahmen nach Scheitern der rassenhygienischen Maßnahmen im engeren Sinne bruchlos zur Vernichtung dieser Menschen übergegangen werden konnte.
Mindestens mit der Veröffentlichung von Binding und Hoche, also lange vor der NS-Zeit, begann somit die "semantische Verzerrung"21 des Begriffs der "Euthanasie" und die untrennbare Vermischung der Tötung auf Verlangen des einzelnen Schwerkranken mit der Vernichtung von Menschen auf Verlangen der Gesellschaft, die das Leben dieser Menschen nicht mehr für lebenswert hält.
Hier zeigt sich die historische Kontinuität, in der die nunmehr von Hackethal wieder aktualisierte Denkfigur der "Erlösungstat" bzw. der "Mitleidstötung", die schon lange vor den NS-Vernichtungsaktionen gegen "lebensunwertes Leben" vorgedacht und artikuliert worden war, steht.
2.3. Gesetzliche Regelungsversuche
Gleichfalls nicht neu sind die Absichten die "Euthanasie" zu legalisieren, ihr also die Aura der Rechtsstaatlichkeit zu verleihen, sie dadurch zur "Normalität" zu erklären und vor allem auch die Straffreiheit für die "Erlösungstat" rechtlich abzusichern.
Bereits 1940 hatte das Drängen vieler Mittäter der "Aktion T4", wie die "Euthanasie"-Aktion im NS-internen Sprachgebrauch genannt wurde, auf Offenlegung der gesetzlichen Grundlagen in der "Kanzlei des Führers", der Privatkanzlei Adolf Hitlers, der die Maßnahmen zur Vernichtung "lebensunwerten Lebens" mit Kriegsbeginn als "Sonderaufgabe" übertragen worden waren22, zu hektischen Aktivitäten geführt. Ergebnis war ein Entwurf, für ein "Gesetz über die Sterbehilfe bei unheilbar Kranken".23
Dieser Gesetzentwurf hatte folgenden Wortlaut:
"§1 - Wer an einer unheilbaren, sich oder andere stark belästigenden oder sicher zum Tode führenden Krankheit leidet, kann auf sein ausdrückliches Verlangen mit Genehmigung eines besonderen ermächtigten Arztes Sterbehilfe durch einen Arzt erhalten.
§2 - Das Leben eines Kranken, der infolge unheilbarer Geisteskrankheit sonst lebenslänglicher Verwahrung bedürfen würde, kann durch ärztliche Maßnahmen, unmerklich für ihn, beendet werden." 24
Unverkennbar ist hier die schon bei Binding und Hoche formulierte Gedankenverknüpfung der Tötung auf Verlangen des einzelnen schwer Kranken und auf Verlangen der Gesellschaft, fein säuberlich, bürokratisch in §1 und §2 formuliert.
Hitler lehnte jedoch Ende 1940 eine gesetzliche Regelung der "Euthanasie" ab. Der Grund der Ablehnung ist vermutlich in der Dynamik und dem Planziel der "Euthanasie"-Aktion selbst zu sehen.
Ein "Gesetz über die Sterbehilfe" hätte vermutlich die Auswirkung gehabt, daß die Vernichtung der erwachsenen Anstaltsinsassen mit der gleichen Langsamkeit wie die Kinder-Euthanasie vorangekommen wäre. "Aus der 'Euthanasie' wäre ein 'Jahrhundertwerk' geworden, das die sozial-rassistische Ungeduld der nazistischen Gesellschaftssanierer über Gebühr strapaziert hätte".25
In den Jahren 1940 und 1941 sind 70.000 geistig Behinderte und psychisch Kranke Opfer der "Euthanasie"-Aktionen geworden. Da waren ca. 1 Promille der Bevölkerung, eine Zielvorstellung, die bereits im Oktober 1939 als erstes Planziel der T4-Aktion festgelegt worden war.26
Um die aufkommende Unruhe in der Bevölkerung und den Widerstand der Kirchen zu beschwichtigen, wurde die 'Aktion T4' im August 1941 daraufhin offiziell abgestoppt. Das Vernichtungsprogramm jedoch lief weiter: Als 'Aktion 14f13' in den Konzentrationslagern, wo es nicht nur psychisch kranke, sondern zunehmend auch rassisch und politisch unerwünschte Häftlinge waren, die Opfer der 'T4'-Ärzte wurden27 und "wilde Euthanasie" mit Hilfe von Todesspritzen und Hungerhäusern28. Mehr und mehr wurden darüber hinaus immer weitere Gruppen von Menschen in den "Euthanasie"-Prozeß einbezogen, vor allem auch Alte und Gebrechliche, sowie körperlich Kranke und insbesondere Ostarbeiter.29
Durch ein "Gesetz über die Sterbehilfe" wäre die Fortsetzung dieses "inneren Krieges"30 gegen die unproduktiven Teile der eigenen Bevölkerung, deren "soziale Vernichtung"31 demgegenüber nur behindert worden.
Bei den führenden Psychiatern war mit der Ablehnung Hitlers die Idee eines Sterbehilfegesetztes jedoch keineswegs zu den Akten gelegt. So erhoben 1943 die Professoren Rüdin, De Crinis, C. Schneider, Heinze und Nitsche in einer reformerischen "Psychiatrie-Denkschrift" die Forderung, daß in einer modernisierten Psychiatrie nach dem "Endsieg", in der alle Anstrengungen zur Heilung unternommen werden, auch die Euthanasie aus Mitleid bei nicht mehr Heilbaren ihren Platz zur Normalisierung des Anstaltsalltagsbetriebs haben müsse.32
3. Zur aktuellen Debatte um die "Sterbehilfe"
3.1. Zum Umgang mit der Vorgeschichte
In der Nachkriegszeit ist die Auseinandersetzung mit der "Euthanasie" fast ausschließlich der Justiz überlassen worden. Stellte jedoch bereits der Umstand, "daß die Gerichte gehalten (waren) gesellschaftlich bedingtes und zudem arbeitsteilig organisiertes Massenverbrechen mit denselben Normen des geltenden Individualstrafrechts zu bewerten wie ein Wirtschaftsvergehen oder irgendein anderes beliebiges Vergehen"33 ein kaum zu bewältigendes materiell-rechtliches Problem dar, so waren sie mit der Aufgabe eine historische und politische Aufarbeitung dieses Teils der Geschichte zu leisten von vornherein überfordert.
Eine breitere Aufarbeitung der Geschichte der "Euthanasie" erfolgt daher im wesentlichen erst seit dem Ende der 70er Jahre. Unter dem Motto "Geschichtsschreibung vor Ort" begann zu dieser Zeit eine Bewegung aus den psychiatrischen Krankenhäusern und Anstalten heraus sich mit dem nationalsozialistischen "Krieg gegen die psychisch Kranken" auseinandersetzen.34
Eines der erstaunlichsten Ergebnisse der Forschungsarbeiten "vor Ort" und an den Universitäten war in diesem Zusammenhang, daß die gedanklichen Grundlagen, wie sie bei Binding und Hoche formuliert worden sind, während der NS-Zeit für ganz alltäglich und "normal" gehalten wurden, für modern, notwendig und zweckmäßig. Heilen und Vernichten war lediglich eine Seite der gleichen Medaille. Dies erklärt auch das Phänomen, daß die Täter der Euthanasie zumeist von optimistischen Heilserwartungen und von Befreiung von Leid beseelt waren, sich also durchaus subjektiv als gut und richtig handelnde Menschen verstanden.35
3.2. Die aktuelle Auseinandersetzung
Die bundesdeutsche Auseinandersetzung über die aktive Sterbehilfe wird immer wieder durch das spektakuläre Herausstellen dramatischer Einzelfälle geprägt. In den Propagandafeldzügen der "Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben" sind es im wesentlichen die folgenden drei Fälle, die vor allem in der (Boulevard)-presse nach allen erdenklichen Seiten hin ausgeschlachtet worden sind:
"- so der Fall einer gesichtskrebskranken Frau (Hermi E.), die um ihren Tod bat und der Hackethal mit der Geste des barmherzigen Arztes Cyankali gab,
- der Fall eines jungen Mannes (Heinz N.), der nach einem Unfall halsquerschnittgelähmt war36, und öffentlich um den "Erlösungstod" bat, und
- der Fall einer alterdepressiven Frau, die von ihrem Hausarzt aufgesucht wurde, kurz nachdem sie eineÜberdosis Schlaftabletten genommen hatte, mit einem Zettel "bitte lassen sie mich sterben" (Fall Dr. Wittig/Charlotte Uhrmacher).
Der Hausarzt unterließ in diesem Fall die Hilfeleistung und ließ die Frau sterben. Die Empörung der DGHS und anderer galt hier dem Gericht, das diesen Arzt schuldig sprach, übrigens bis zum Bundesgerichtshof, wohl aber von einer Bestrafung absah."37
"Das Fatale an der breiten Publikation dieser drei Einzelfälle ist, daß sie zur Vermischung der Fragen, ob in dem jeweiligen Einzelfall richtig gehandelt wurde oder nicht und welche allgemeinen Schlußfolgerungen daraus zu ziehen sind, geführt haben und wohl auch führen sollten."38
Die Darstellung dieser Fälle wird von der DGHS und auch von J. Hackethal immer wieder mit einer sehr populären Kritik an der Intensivmedizin und einem Bezug auf das Selbstbestimmungsrecht der Patienten verbunden: "Unsere Verstorbenen klagen an" heißt eine der Broschüren der DGHS, in der das Horrorbild einer hochtechnisierten Medizin gezeichnet wird, also Teile der qualitativen Kritik am herrschenden Medizinbetrieb, durchaus aufgegriffen werden. Angeklagt wird weiter, daß der Patientenwille in dieser Medizin, die den einzelnen nicht losläßt und nicht in Ruhe sterben läßt, mißachtet wird, weshalb der Wille des Patienten, sich nicht in intensivmedizinische Behandlung zu begeben, in einem "Patiententestament" oder einer "Patientenverfügung" rechtsverbindlich deklariert werden soll. Als juristische Grundlage dieser Willenserklärung wird die Legalisierung der Tötung auf Verlangen, also der aktiven Sterbehilfe gefordert.39
4. Fragwürdige Perspektiven
Wie in der Debatte nach dem Ersten Weltkrieg besteht die Gefahr, daß die von der DGHS und Hackethal vorgeführten dramatischen Einzelfälle, mit denen schnell eine emotionale Solidarisierung in der Öffentlichkeit erreichbar ist, dazu dienen, eine ganz andere und gesellschaftspolitisch viel weitergehende Perspektive populär und letztlich zustimmungsfähig zu machen.
Zusätzliche Brisanz gewinnt eine solche Entwicklung durch den Umstand, daß bereits seit Ende der siebziger Jahre politische Bemühungen erkennbar sind das bundesdeutsche Gesundheitswesen nach bisher ungenutzten Rationalisierungsreserven zu durchforsten. Forderungen, die Intensivmedizin für alte Menschen einzuschränken, ja sogar generell zur Disposition zu stellen, stehen keineswegs im grundsätzlichen Widerspruch zu diesen Bemühungen. Es besteht die Gefahr, daß auf diese Weise genau die alten Menschen und chronisch Kranken ins Blickfeld der Gesundheitsökonomie geraten, deren Zustand schnell als hoffnungslos herbeiprognostiziert ist.40
Es bleibt darüber hinaus die Frage, wem diese öffentlich bekundete Barmherzigkeit, der "aktiven Sterbehilfe" ein Trost sein soll. Besteht nicht vielmehr das Risiko, daß der Unwert eines Lebens unter negativ medizinischer Prognose herbeigeredet wird? Liegt nicht die schlimme Wirkung solcher Sätze gerade in der Entmutigung der Menschen, die individuell in fast mutloser Verfassung sind und sich gegen solch menschenverachtendes Gerede nicht zur Wehr setzen können und dann von ihrem "Selbstbestimmungsrecht" Gebrauch machen? Zu hoffen ist deshalb, daß es gelingt, in einer sich sicherlich zuspitzenden Debatte zu verdeutlichen, daß mit der Infragestellung des Prinzips der Einzigartigkeit jedes individuellen Lebens zu jedem Zeitpunkt der allgemeine Verlust von Grund- und Menschenrechten verbunden ist.
Auf der Ebene der Praxis bedeutet dies vor allem, den erreichten Standard der Rehabilitations- und Pflegebemühungen für chronisch Kranke und Behinderte zu verteidigen, ihn nicht vordringlich auf Kosten-Nutzen Kalküle reduzieren zu lassen und parallel hierzu alternative Modelle zu "Sterbebegleitung und Lebensbeistand" durchzusetzen.
Dieses gilt insbesondere auch deshalb, weil die Preisgabe des erreichten materiellen und bewußtseinsmäßigen Standards zugunsten des von der DGHS propagierten Konzepts von "aktiver Sterbehilfe" nicht allein eine Herabwürdigung des Lebens von chronisch Kranken und Behinderten zur Folge haben würde, sondern letztendlich auch die Entwertung der Arbeit aller im Rehabilitations- und Pflegebereich Tätigen.
ANMERKUNGEN
LITERATURVERZEICHNIS
BINDING, Karl / HOCHE, Alfred E.: Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens - ihr Maß und ihre Form, Leipzig 1922, (Erstausgabe: 1920).
BOCK, Gisela: Nationalsozialistische und rassenhygienische Bewegung 1924-1933, in: dies. Zwangssterilisation im Nationalsozialismus. Studien zur Rassenpolitik und Frauenpolitik, Opladen 1986.
BOSUM, Uwe: Psychiatrie und Faschismus in Deutschland. Ein Literaturbericht aus politikwissenschaftlicher Sicht, Univ. Hannover 1983.
BROKMEIER, Peter: Die Vorstufe der Endlösung. Zum Frankfurter Euthanasieprozeß 1967/68, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 21 (1970), S. 28-37.
"DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR HUMANES STERBEN": Das ist sinnloses Vegetieren an Apparaten, in: Frankfurter Rundschau vom 17.5.1985.
DÖRNER, Klaus : Nationalsozialismus und Lebensvernichtung, in: Der Krieg gegen die Psychisch Kranken. Nach >Holocaust<: Erkennen - Trauern - Begegnen. Herausgegeben von K. Dörner u.a., Rehburg-Loccum 1980, S. 74-111.
DÖRNER, Klaus: >Ein Heer der Vergessenen. Die sozial Verfolgten des Dritten Reiches. Immer noch Opfer zweiter Klasse<, in: Die Zeit, 23. August 1985.
FLEISCHER, Helmut: Moral der Geschichte. Zum Disput über die Vergangenheit, die nicht vergehen will, in: Nürnberger Zeitung, vom 20. September 1986.
GRODE, Walter, Die >Sonderbehandlung 14f13< in den Konzentrationslagern des Dritten Reiches. Ein Beitrag zur Dynamik faschistischer Vernichtungspolitik, Frankfurt/ Bern/ New York 1987.
HABERMAS, Jürgen: Eine Art Schadensabwicklung. Die apologetischen Tendenzen in der deutschen Zeitgeschichtsschreibung, in: Die Zeit, 11. Juli 1986.
>HISTORIKERSTREIT<. Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung". Hrsg: R. Piper-Verlag, München, Zürich 1987.
KAUL, Friedrich Karl: Die Psychiatrie im Strudel der >Euthanasie<. Ein Bericht über die erste industriemäßig durchgeführte Mordaktion des Naziregimes, Frankfurt/M. 1979.
KLEE, Ernst: >Euthanasie< im NS-Staat. Die >Vernichtung lebensunwerten Lebens<, Frankfurt/M. 1983.
KÜHNL, Reinhard (Hrsg.): "Vergangenheit, die nicht vergeht. Die >Historiker-Debatte<. Dokumentation, Darstellung und Kritk, Köln 1987.
MAPPES, Norbert: "Früher Tod ist kostendämpfend", in: demokratisches gesundheitswesen, Heft 6/85, S. 10-14.
MÜLLER-HILL, Benno: Tödliche Wissenschaft. Die Ausrottung von Juden, Zigeunern und Geisteskranken 1933-1945, Reinbek 1984.
NOLTE, Ernst: Vergangenheit, die nicht vergehen will. Eine Rede, die geschrieben, aber nicht gehalten werden konnte, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), 6.Juni 1986.
NOWAK, Kurt:."Euthanasie" und Sterilisierung im "Dritten Reich". Die Konfrontation der evangelischen und der katholischen Kirche mit dem "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" und der "Euthanasie"-Aktion, Göttingen 1980.
ROTH, Karl-Heinz/ ALY, Götz: Das Gesetz über die Sterbehilfe bei unheilbar Kranken, in: Erfassung zur Vernichtung, Hrsg. Karl-Heinz Roth, Berlin 1984, S.101-179.
SCHMIDT, Gerhard: Selektion in der Heilanstalt 1939-1945. Frankfurt/M. 1983.
STÜRMER, Michael: Geschichte in geschichtslosem Land, in: FAZ, vom 25.April 1986.
WUNDER, Michael: Sterbehilfe - Tötung auf wessen Verlangen? In: demokratisches gesundheitswesen, Heft 9/87, S. 19-22 und in: Dr. med. Mabuse Nr. 52, S. 46-55.
WUTTKE-GRONEBERG, Walter: Medizin im Nationalsozialismus. Ein Arbeitsbuch, Tübingen 19822.
[...]
1 Jürgen Habermas, Eine Art Schadensabwicklung. Die apologetischen Tendenzen in der deutschen Zeitgeschichtsschreibung, in: Die Zeit, 11. Juli 1986.
2 Vorläufige Zusammenfassungen dieser in ihren Auswirkungen noch längst nicht abgeschlossenen Kontroverse liefern mit unterschiedlicher politischer Akzentuierung der vom Piper-Verlag herausgegebene Band ">Historikersteit<. Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit der national-sozialistischen Judenvernichtung", München, Zürich 19872 und der von Reinhard Kühnl editierte Band "Vergangenheit, die nicht vergeht. Die >Historiker-Debatte<. Dokumentation, Darstellung und Kritik, Köln 1987.
3 vgl. Ernst Nolte, Vergangenheit, die nicht vergehen will. Eine Rede, die geschrieben, aber nicht gehalten werden konnte, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), 6.Juni 1986.
4 Michael Stürmer, Geschichte in geschichtslosem Land, in: FAZ, vom 25.April 1986.
5 Helmut Fleischer, Moral der Geschichte. Zum Disput über die Vergangenheit, die nicht verhehlen will, in: Nürnberger Zeitung, vom 20. September 1986.
6 vgl. auch Michael Wunder, dessen Argumentationslinien in den folgenden Abschnitten in zentralen Punkten nachgezeichnet werden: Sterbehilfe - Tötung auf wessen Verlangen? In:: demokratisches gesundheitswesen, Heft 9/87, S. 19-22 und in: Dr. med. Mabuse Nr. 52, S. 46-55.
7 Karl Binding / Alfred E.Hoche, Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens - ihr Maß und ihre Form, Leipzig 1922, (Erstausgabe: 1920).
8 vgl. Gisela Bock, Nationalsozialistische und rassenhygienische Bewegung 1924-1933, in: dies.: Zwangssterilisation im Nationalsozialismus. Studien zur Rassenpolitik und Frauenpolitik, Opladen 1986, S. 23-28.
9 vgl. Wunder, in: Mabuse, a.a.O., S. 47.
10 Binding/ Hoche, a.a.O., S.28.
11 ebd., S.29.
12 ebd., S.33.
13 ebd., S.31.
14 ebd., S.27.
15 ebd., S. 31/32.
16 Wunder, in: Mabuse a.a.O., S.47.
17 Binding/Hoche, a.a.O., S. 43 ff.
18 vgl. Walter Wuttke-Groneberg, Medizin im Nationalsozialismus. Ein Arbeitsbuch, Tübingen 19822, S.283-319.
19 Binding/ Hoche, a.a.O., S. 55.
20 ebd., S. 57 f.
21 Einschätzung der "Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben" im Rahmen der Bundestagsanhörung zum Thema Sterbehilfe am 15.5.1985, zit. nach: Wunder, in: Mabuse, a.a.O. S. 46.
22 zur Geschichte der Vernichtungsaktionen vgl. die grundlegenden Untersuchungen von Ernst Klee, >Euthanasie< im NS-Staat. Die >Vernichtung lebensunwerten Lebens<, Frankfurt/M. 1983 und Kurt Nowak, "Euthanasie" und Sterilisierung im "Dritten Reich". Die Konfrontation der evangelischen und der katholischen Kirche mit dem "Gesetz zur Verhütung erb-kranken Nachwuchses" und der "Euthanasie"-Aktion, Göttingen 1980.
23 vgl. Karl-Heinz Roth,/ Götz Aly, Das Gesetz über die Sterbehilfe bei unheilbar Kranken, S. 112 ff. in: Erfassung zur Vernichtung, Hrsg. Karl-Heinz Roth, Berlin 1984, S.101-179.
24 ebd. S. 176.
25 ebd. S. 116.
26 vgl. Friedrich Karl Kaul, Die Psychiatrie im Strudel der >Euthanasie<.Ein Bericht über die erste industriemäßig durchgeführte Mordaktion des Naziregimes, Frankfurt/M. 1979, S. 63/64.
27 vgl. die Untersuchung des Verf.: Die >Sonderbehandlung 14f13< in den Konzentrationslagern des Dritten Reiches. Ein Beitrag zur Dynamik faschistischer Vernichtungspolitik, Frankfurt/ Bern/ New York 1987.
28 vgl. Klee, a.a.O., S. 417 ff; Gerhard Schmidt, Selektion in der Heilanstalt 1939-1945. Frankfurt/M. 1983, S. 132 ff.
29 vgl. Roth/ Aly, a.a.O., S.102.
30 Klaus Dörner, Nationalsozialismus und Lebensvernichtung, S. 101, in: Der Krieg gegen die Psychisch Kranken. Nach >Holocaust<: Erkennen - Trauern - Begegnen. Herausgegeben von K. Dörner u.a., Rehburg-Loccum 1980.
31 Klaus Dörner, >Ein Heer der Vergessenen. Die sozial Verfolgten des Dritten Reiches. Immer noch Opfer zweiter Klasse<, in: Die Zeit, 23.August 1985.
32 vgl. das Memorandum aus dem Jahre 1943 "Gedanken und Anregungen betr. die künftige Entwicklung der Psychiatrie", dokumentiert bei Uwe Bosum, Psychiatrie und Faschismus in Deutschland. Ein Literaturbericht aus politikwissenschaftlicher Sicht, Univ. Hannover 1983, S. 84-91.
33 Peter Brokmeier, Die Vorstufe der Endlösung. Zum Frankfurter Euthanasieprozeß 1967/68, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 21 (1970), S. 36.
34 den Beginn dieser Aufarbeitung markiert der bereits erwähnte gleichnamige Band von Klaus Dörner u.a. a.a.O.
35 vgl. Benno Müller-Hill, Tödliche Wissenschaft. Die Ausrottung von Juden, Zigeunern und Geisteskranken 1933-1945, Reinbek 1984.
36 an dieser Stelle sei ausdrücklich noch einmal auf das eingangs zitierte Motto der Podiumsdiskussion verwiesen.
37 Wunder, in: Mabuse, a.a.O., S. 50.
38 ebd.
39 vgl. "Das ist sinnloses Vegetieren an Apparaten", Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben, in: Frankfurter Rundschau, 17.5.1985.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptfokus des Textes "DAS SELBSTBESTIMMUNGSRECHT DER PATIENTEN"?
Der Text analysiert die historische Kontinuität spezifischer Denkstrukturen in der Debatte um die "aktive Sterbehilfe". Er untersucht, wie Argumente, die das Selbstbestimmungsrecht des Patienten betonen, historisch mit ideologischen Wegbereitern der Lebensvernichtung im Nationalsozialismus in Verbindung stehen.
Welche historischen Argumentationsstrukturen werden im Text untersucht?
Der Text untersucht die Argumentationsstrukturen, die in der Schrift "Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens" von Karl Binding und Alfred Hoche dargelegt wurden. Diese beinhalten Konzepte wie die "straffreie Erlösungstat", die Unterscheidung zwischen "Defektmenschen" und "nutzlosen Essern" und die Frage nach dem Wert des Lebens für die Gesellschaft.
Wie werden Binding und Hoche im Zusammenhang mit der Debatte um die "aktive Sterbehilfe" dargestellt?
Binding und Hoche werden als frühe Vertreter von Denkstrukturen dargestellt, die später von den Nationalsozialisten zur Rechtfertigung der "Euthanasie" verwendet wurden. Ihre Ideen zur Bewertung des Lebens nach Nützlichkeit und die Unterscheidung zwischen "lebenswertem" und "lebensunwertem" Leben werden kritisch hinterfragt.
Welche Rolle spielt das Thema "Selbstbestimmungsrecht der Patienten" in der Analyse?
Das "Selbstbestimmungsrecht der Patienten" wird als ein Argumentationsmuster identifiziert, das von Befürwortern der "aktiven Sterbehilfe" verwendet wird. Der Text argumentiert jedoch, dass dieses Muster nicht neu ist, sondern eine Reaktivierung von Denkstrukturen darstellt, die historisch problematisch sind.
Welche Beispiele aktueller Fälle werden im Text genannt?
Der Text nennt die Fälle einer gesichtskrebskranken Frau (Hermi E.), eines halsquerschnittgelähmten jungen Mannes (Heinz N.) und einer alterdepressiven Frau (Fall Dr. Wittig/Charlotte Uhrmacher) als Beispiele, die von der "Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben" (DGHS) zur Unterstützung ihrer Position zur "aktiven Sterbehilfe" herangezogen werden.
Welche Kritik wird an der "Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben" (DGHS) geübt?
Die DGHS wird dafür kritisiert, dramatische Einzelfälle zu instrumentalisieren, um eine weitergehende gesellschaftspolitische Perspektive zu befördern. Es wird die Gefahr gesehen, dass durch die Betonung des Selbstbestimmungsrechts eine Abwertung des Lebens von chronisch Kranken und Behinderten stattfindet.
Welche Rolle spielt die Geschichte der "Euthanasie" im Nationalsozialismus in der Analyse?
Die Geschichte der "Euthanasie" im Nationalsozialismus wird als Mahnung angeführt, die Gefahren einer Abwertung des menschlichen Lebens und einer Instrumentalisierung des "Mitleids" zu erkennen. Der Text betont die Notwendigkeit, die historischen Kontinuitäten zu verstehen, um eine Wiederholung ähnlicher Entwicklungen zu verhindern.
Welche Schlussfolgerungen zieht der Autor hinsichtlich der aktuellen Debatte um die "Sterbehilfe"?
Der Autor warnt vor der Infragestellung des Prinzips der Einzigartigkeit jedes individuellen Lebens und betont, dass dies mit dem Verlust von Grund- und Menschenrechten verbunden ist. Er plädiert für die Verteidigung des erreichten Standards der Rehabilitations- und Pflegebemühungen und für die Entwicklung alternativer Modelle zur "Sterbebegleitung und Lebensbeistand".
Was ist die "Aktion T4"?
Die "Aktion T4" war die im Nationalsozialismus intern verwendete Bezeichnung für die "Euthanasie"-Aktion, also die systematische Ermordung von psychisch Kranken und Behinderten.
Was ist die "Sonderbehandlung 14f13"?
Die "Sonderbehandlung 14f13" war ein Vernichtungsprogramm, das in den Konzentrationslagern des Dritten Reiches durchgeführt wurde. Im Rahmen dieser Aktion wurden nicht nur psychisch kranke, sondern zunehmend auch rassisch und politisch unerwünschte Häftlinge Opfer der 'T4'-Ärzte.
- Arbeit zitieren
- Dr. phil. Walter Grode (Autor:in), 1988, Das Selbstbestimmungsrecht der Patienten. Zur historischen Kontinuität von spezifischen Denkstrukturen in der Debatte um die "aktive Sterbehilfe", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109265