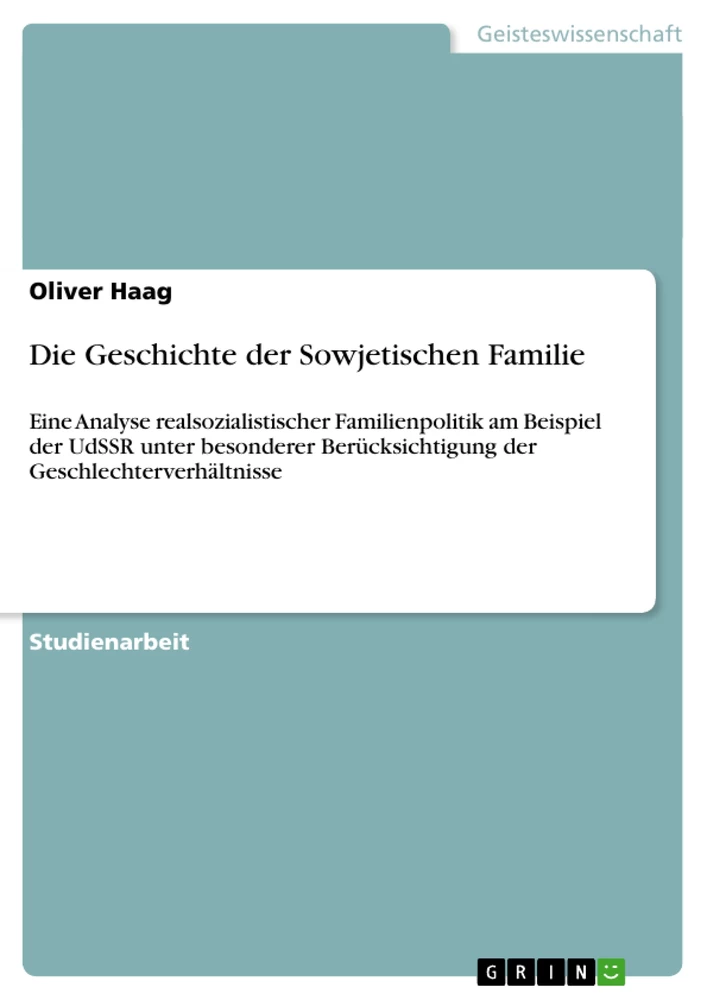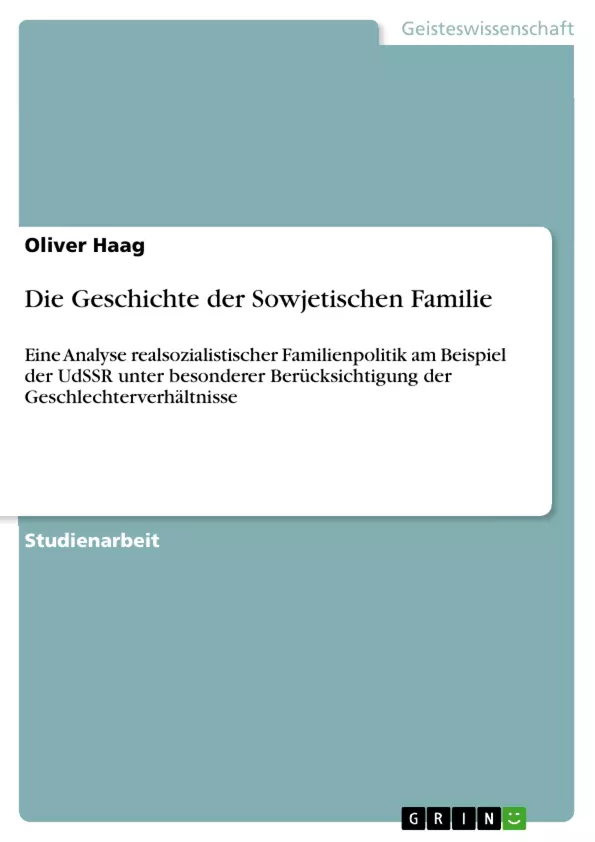"Die Geschichte der Sowjetischen Familie" gibt einen Überblick über Familienmodelle und Familienpolitik in der UdSSR von 1917 bis Ende der 1980er. Die Auswirkungen sowjetischer Familienpolitik auf die Geschlechterverhältnisse werden dabei einer näheren Diskussion unterzogen: was war die Rolle der Väter? Welche Auswirkungen hatte die staatliche Lenkung der Familie auf das Bild der sozialistischen Frau? Wo sind Kontinuitäten und Brüche in der Familienpolitik der Sowjetunion zu erkennen? Neben diesen Fragen wird auch der Einfluss der russischen Frauenbewegung auf die frühe Phase sowjetischer Familienpolitiken hervorgehoben.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1917 und die 20er Jahre
Die Ära Stalin
Entstalinisierung und Stagnation
1985-1989.
Literatur
Vorwort
Die Sowjetunion bietet ein anschauliches Musterbeispiel für die Beschäftigung mit dem Thema realsozialistischer Familienpolitik, da deren Umsetzung zum einen an die drei Generationen erfasste und zum anderen als Vorgabe für die nachfolgenden Satellitenstaaten diente. Von daher können anhand der UdSSR in vielerlei Hinsicht ähnliche Grundmerkmale von realsozialistischen Familienpolitiken ausgemacht werden, auch wenn dabei regionale genauso wie länderspezifische Unterschiede stets streng zur Diskussion gestellt werden müssen – seien es nun die Differenzen zwischen russischen, kaukasischen oder muslimischen Familien[1] innerhalb der UdSSR oder etwa diejenigen zur jugoslawischen zadruga und anderen mehr. Darüber hinaus haben Familienkonzepte im Zeitraum von 1917 bis 1989 etliche Veränderungen erfahren und werden von mir zwecks besserer Orientierung in vier Phasen aufgesplittet, um trotz der Kontinuitäten auch zeitliche Brüche sichtbar zu machen. Aufgrund des Umfangs werden die letzten beiden Jahre der Sowjetunion in diese Darstellung nicht miteinbezogen. In diesem Sinne möchte ich nun die Auswirkungen von Familienpolitik auf die Geschlechterverhältnisse am Beispiel der russischen Familie thematisieren.
1917 und die 20er Jahre
Kann 1917 in vielerlei Hinsicht als Bruch mit der Vergangenheit des zaristischen Russland gesehen werden, so stellte gerade die Familie als Trägerin der Tradition ein großes Potential zur Veränderung dar.[2] Von daher war die Familie zahlreichen politischen Reformen ausgesetzt, die sich zum einen aus der Geschichte der russischen Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts, zum anderen aus den politischen Ideen des Marxismus erklären lassen. Familien im vorrevolutionären Russland waren primär ökonomische Gemeinschaften, also Großfamilien mit in der Regel fünf bis zehn Kindern[3] pro Haushalt und ebenso patriarchal[4] begründet. Zwar wurden Frauen bestimmte Rechte in der Ehe, wie das Recht auf eigenen Besitz, zugestanden, doch änderte dies nicht wirklich viel an der die Frauen benachteiligenden Kluft zwischen Rechtsnorm und Rechtswirklichkeit: Eheverträge und kirchliche Trauungen, die vom Staat und besonders seitens der orthodoxen Kirche als gesellschaftliche Stabilisierungsfaktoren angesehen wurden, waren praktisch nicht zu lösen.[5] Aus dieser Sicht betrachtet, darf es nicht Wunder nehmen, weshalb die Familie als Zündstoff für bevorstehende Veränderungen fungierte.
Einflussreich für die sowjetische Familienpolitik und deren Vorstellungen von Frauen in Beruf und Familie sollte Friedrich Engels Schrift 'Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats' aus dem Jahr 1884 werden. Für diese Überblicksdarstellung erscheint weniger Engels historische Familienanalyse als seine Beschreibung der Probleme kapitalistischer Familien und deren Lösungen durch den Kommunismus von Interesse zu sein. Dies nicht zuletzt deshalb, weil diese Lösungsansätze von der Parteipolitik rezipiert oder zumindest dem Anschein nach zu rezipieren versucht wurden:
Die Vorherrschaft des Mannes in der Ehe ist einfache Folge seiner ökonomischen Vorherrschaft und fällt mit dieser von selbst. […] Mit dem Übergang der Produktionsmittel in Gemeineigentum hört die Einzelfamilie auf, wirtschaftliche Einheit der Gesellschaft zu sein. Die Privathaushaltung verwandelt sich in eine gesellschaftliche Industrie. […] Die Befreiung der Frau wird erst möglich sein, sobald diese auf großem, gesellschaftlichem Maßstab an der Produktion sich beteiligen kann, und die häusliche Arbeit sie nur noch in unbedeutendem Maß in Anspruch nimmt. [6]
Die wohl folgenreichste Lesart und Textinterpretation stellte jene dar, nach der die Gleichberechtigung von Frauen und Männern automatisch nach Aufhebung aller Klassenordnungen, sprich nach der erfolgten Revolution erreicht sei und dass Frauen einfach nur in den kommunalen Arbeitsprozess integriert werden müssten, um von der sie benachteiligenden Stellung innerhalb der Familie loszukommen.
Ebenso setzten sich Vertreterinnen der russischen Frauenbewegung seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts für eine Liberalisierung von Eherechten und für einen Schritt hinaus aus der 'privaten' Sphäre von Familie hin in die 'öffentliche' von Arbeitswelt und Bildungswesen ein.[7] Eine zentrale Figur der sozialistischen Frauenbewegung sollte gerade auch Alexandra Kollontai (1872-1952) werden, die zunächst ab 1917 als Volkskommissarin für staatliche Fürsorge und ab 1919 als Leiterin des Ženotdel, der Frauenabteilung des Zentralkomitees, massiven Einfluss auf die erste Phase sowjetischer Familienpolitik ausübte.[8] Die erste Phase der Familiengesetzeserzeugung ähnelte noch sehr den Vorstellungen Friedrich Engels, wonach die Bedeutung der Familie als Ort der Kindererziehung zugunsten der des Staates deutlich geschwächt wurde. So wurden nicht nur neue Betreuungseinrichtungen geplant, sondern auch das Ausmaß staatlicher Erziehung innerparteilich kontroversiell diskutiert, was zuweilen bis zur Überlegung der Abschaffung von Familie[9] reichte. Dennoch konnte in den 20er Jahren nicht zuletzt aufgrund mangelnder infrastruktureller Einrichtungen keinerlei Rede von einer völligen staatlichen Übernahme der Kindererziehung sein, sodass zumindest die Errichtung von Tagesheimstätten der Grundidee von der Schaffung des 'neuen sozialistischen Menschen' gerecht werden musste.[10] Die neuen Ehegesetze wiederum hatten einerseits die Gleichstellung von Frau und Mann, andererseits die Schwächung der Kirche in Gesellschaftsfragen zum Ziel. Was folgte, war eine Säkularisierung der Ehe: die Scheidung wurde erleichtert, Frauen durften ihren Familiennamen nach der Eheschließung beibehalten, Eheleute mussten nicht räumlich zusammenleben und nichteheliche Kinder wurden mit ehelichen gleichgestellt; ferner wurde europaweit erstmalig Abort straffrei gestellt, wohingegen Aufklärung und Verhütung vernachlässigt wurden[11] – gesamt gesehen, bekam Russland zu dieser Zeit das liberalste Familienrecht Europas.
Die Ära Stalin
Familienpolitik unter Stalin war einerseits paradox, als Familienverbände gewaltsam aufgelöst wurden und der Staat gleichzeitig eine konservative und protektionistische Familienpolitik verfolgte. Andererseits sollte für weite Teile dieser Periode anstelle von verharmlosend klingender Familienpolitik eher von Massenmord und Terror gesprochen werden. Als einer der ersten Angriffe auf die bäuerlichen Familien sind die Zwangskollektivierungen von bäuerlichem Privatgut und Privatbesitz anzusehen, sodass Großfamilien weitgehend zerstört wurden. Selbst wenn mit dem Kolchosgesetz von 1935 ein Ausgleich mit den bäuerlichen Familien gesucht wurde, durch das jeder Familie wieder ein kleines Stück Land und ein wenig Vieh als Privatbesitz zugestanden wurde, so blieb der Typus der Kernfamilie nun auch am Land weiter bestehen, was sich sogar zum Trend hin entwickeln sollte – um 1970 bestanden lediglich 16 Prozent der sowjetischen Familien aus drei Generationen.[12] Wie der Ausgleich von 1935 bereits anklingen lässt, so kann Familienpolitik dieser Periode nur vor dem Hintergrund der Industrialisierung nachvollzogen werden. Und dafür bedurfte es stabiler Familienverhältnisse und vor allem zahlreicher Kinder, die künftig die Nation aufbauen sollten. Von daher und ebenso aufgrund der nach wie vor rückläufigen Geburtenzahlen, wurden 1936 restriktive Familiengesetze erlassen, wodurch die Abtreibung erneut pönalisiert und die Ehescheidung durch Erhöhung der Gebühren und durch vermehrte Bürokratie für die Antragstellenden erschwert wurde.[13]
Im 'Großen Vaterländischen Krieg' wurde die Familie für den Dienst an der Nation propagandistisch in Szene gesetzt. Zum einen wurden die Familiengesetze 1944 erneut verschärft, indem eine 'Ledigensteuer' eingeführt und die Scheidung durch Mehrkosten und vermehrte Bürokratie verschärft wurde.[14] Zum anderen wurden pronatalistische Maßnahmen wie die Verleihung von Mutterschaftsabzeichen an Mütter mit mehr als fünf Kindern beschlossen - die höchste Auszeichnung war diejenige der 'Mutter Heldin' für Frauen mit zehn und mehr Kindern.[15] Mit den millionenfachen Verlusten an Männern zeigte sich vor allem nach dem Krieg ein bezeichnendes Phänomen, das die Familie in vielen Fällen auf die Mutter als Alleinerzieherin reduzierte. Sergej Schwedow weist in diesem Zusammenhang anhand von Familiendarstellungen in Schulfibeln nach, dass die Väter in den Abbildungen durch den 'einen' Vater, nämlich Stalin, ersetzt wurden, dessen Pose nach 1953 Lenin 'übernahm'.[16]
Im Prinzip wird er [der Vater; O.H.] nicht besonders gebraucht, denn die Hauptfigur ist, wie könnte es anders sein, die Mutter. […] Die Familie ohne Vater war keine Ausnahme. War der Vater vorhanden, so spielte er eine eher unwichtige, zuweilen nur symbolische Rolle. […] 'Der weise Blick Stalins ist voller väterlicher Zärtlichkeit, und das Mutterherz schöpft Hoffnung.'[17]
Entstalinisierung und Stagnation (1953-1985)
Zwar wurde unter Cruščev (1953-1964) weiterhin eine die Familie stärkende Politik betrieben, die aber deutlich sozialeren Charakter hatte als unter Stalin. So wurden Häuser- und Wohnungsbauprogramme realisiert, ein Mindestlohnniveau und Mindestpensionen gesetzlich garantiert und die Abtreibung wurde 1955 wieder legalisiert.[18] Der Widerspruch zu einer solch pronatalistischen Familienpolitik kam allerdings mit der weiterhin forcierten Inklusion von Frauen in den Arbeitsmarkt immer mehr zum Vorschein, zumal es an öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen, die ohnehin meist von schlechtem Ruf[19] waren, mangelte. Immerhin machten Frauen bereits 1970 einundfünfzig Prozent der Arbeitskräfte in der UdSSR aus und zum Vergleich lag dieser Prozentsatz im Jahr 1922 bei fünfundzwanzig.[20] Unschwer sind die fatalen Konsequenzen der oftmaligen Verquickung von Frauen- und Familienpolitik und der daraus resultierenden weiblichen Doppelbelastung und Fixierung von Geschlechterrollenklischees zu erkennen, die von der Partei nicht mehr in den Griff bekommen wurden: So wurde die 'Babuška' (Großmutter) in Haushalt und in der Kindererziehung zu einer immer wichtigeren sozialen Institution und zu einem Muttersubstitut, wohingegen viele Männer auch nach ihrer Pensionierung noch freiwillig weiterarbeiteten, da sich viele Väter nie richtig in die Familie integrieren konnten.[21] Diese Situation änderte sich auch in der Ära Brešnev (1964-1982) nicht wesentlich, selbst wenn in den 70ern Kindergeld ausbezahlt wurde und neue Tagesstätten für Kinder eingerichtet wurden, die zwar qualitativ um einiges besser als im Westen waren, aber bei weitem nicht ausreichten.[22]
Zentrale Probleme früherer Familienpolitiken blieben aufrecht und verschärften sich sogar: Die Geburtenrate sank weiterhin, gleichzeitig schnellte die Abtreibungsquote in die Höhe und erreichte in den 70er und 80er Jahren den Weltrekord, als auf 100 Geburten 200 Schwangerschaftsunterbrechungen kamen.[23]
1985-1989
In den späten Jahren der UdSSR sollte die langjährig praktizierte Politik der möglichst tief greifenden staatlichen Bestimmung des Privatlebens ihre Wirkung auf die Perzeptionen von Familie zeigen. Familie wurde häufig nicht als 'Zelle', als Mikrokosmos des sozialistischen Staates verstanden, sondern als Rückzugsort für die einzelnen vor dem Staat.[24] In der Familie konnte letztlich leichter, wenngleich auch nicht gefahrlos, gegen Staat und Öffentlichkeit politisiert werden. Es wäre sogar nicht verfehlt von einem Antagonismus zwischen Staat und Familie zu sprechen. Genau das Gegenteil dessen war eingetroffen, was durch Familienpolitik an sich hätte vermieden werden sollen: So erzeugte die Glorifizierung des Kollektivs am Ende ihr Gegenteil: den Rückzug in die Familie und eine Aufwertung des Zuhauses.[25]
Als eine solche Rückbesinnung lässt sich auch Michail Gorbačevs Buch Perestroika lesen, in welchem der Autor einen Abschnitt der Familie und den Frauen widmet, womit die sowjetische Identifizierung von Familien- mit Frauenpolitik auf ein Neues vor Augen geführt wird. Dennoch bestätigte und antizipierte Gorbačev mit seinen Aussagen einen öffentlichen Diskurs über Familie und Idealisierung weiblicher Rollenbilder:
Wir haben erkannt, daß viele unserer Probleme – im Verhalten vieler Kinder und Jugendlicher, in unserer Moral, der Kultur und der Produktion – zum Teil durch die Lockerung der familiären Bindungen und die Vernachlässigung der familiären Verantwortung verursacht werden. Dies ist ein paradoxes Ergebnis unseres ernsthaften und politisch gerechtfertigten Wunsches, die Frau dem Mann in allen Bereichen gleichzustellen.[26]
Gesamt gesehen zeigt sich, dass sowjetische Familienpolitik nicht als einheitlich zu fassen ist und trotz der hier beschriebenen Nachteile für das Geschlechterverhältnis dem Individuum oftmals Vorteile bot, womit der Westen über weite Teile hinweg nicht mithalten konnte.
Literatur
ENGELS, Friedrich (1983; [1884]), Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des
Staats, in: Verlag Progress Moskau/ Globus Verlag Wien, Hg. (1983), K. Marx und F.
Engels. Ausgewählte Werke. Progress, Globus: Moskau, Wien, 473-609
GORBATSCHOW, Michail (1989), Perestroika. Die zweite russische Revolution. Eine neue
Politik für Europa und die Welt. Droemer (Knaur): München [1987]
HARWIN, Judith (1996), Children of the Russian State: 1917-95. Avebury: Aldershot,
Brookfield, Hong Kong, Singapore, Sydney
HEINDL, Waltraud/ HÖSLINGER-FINCK, Annette/ LIEBHART, Karin (2001), Editorial, in:
Österreichische Osthefte. Zeitschrift für Mittel-, Ost- und Südosteuropaforschung.
43:4 (2001), 497-501
KAPPELER, Andreas (2003), Frauen in Russland 1860-1930, in: Wakounig, Marija, Hrsg.
(2003), Die gläserne Decke. Frauen in Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa im 20.
Jahrhundert. Studien-Verlag (Querschnitte 11): Innsbruck, Wien, München, Bozen 12-
32
KERBLAY, Basile (1998), Sozialistische Familien, in: Burguière, André/ Klapisch-Zuber,
Christiane/ Segalen, Martine/ Zonabend, Françoise, Hg. (1998), Geschichte der Familie.
Bd. 4. 20. Jahrhundert. Campus: Frankfurt/New York
MOON, David (1997), Women in rural Russia from the tenth to the twentieth centuries, in:
Continuity and Change. A Journal of Social Structure, Law and Demography in Past
Societies. 12 (1997), 129-138
PIETROW-ENNKER, Bianka (1999), Rußlands 'neue Menschen'. Die Entwicklung der
Frauenbewegung von den Anfängen bis zur Oktoberrevolution. Campus:
Frankfurt/New York
RAETHER, Gabriele (1986), Alexandra Kollontai zur Einführung. Junius: Hamburg
SCHWARCZ, Iskra (2003), Die Frauen in der Sowjetunion und in der GUS (1936-2002), in:
Wakounig, Marija, Hrsg. (2003), Die gläserne Decke. Frauen in Ost-, Ostmittel- und
Südosteuropa im 20. Jahrhundert. Studienverlag (Querschnitte 11): Innsbruck, Wien,
München, Bozen, 33-57
SCHWEDOW, Sergej (1993), Fibelstunden, in: Margolina, Sonja, Hg. (1993), Die Fesseln
Der Vergangenheit. Russisches Denken nach der Perestroika. Fischer: Frankfurt/ Main,
31-43
TORKE, Hans-Joachim, Hg. (1993), Historisches Lexikon der Sowjetunion. 1917/22 bis 1991.
C.H.Beck: München
TURIN, S.P. (1944), The U.S.S.R. An Economic and Social Survey. Methuen&Co: London
WAGNER, William (1994), Marriage, Property, and Law in Late Imperial Russia. Clarendon
Press: Oxford
WESTEN, Klaus (1966), Rechtsreformen nach dem Tode Stalins, in: Boettcher, Erik/ Lieber,
Hans-Joachim/ Meissner, Boris, Hg. (1966), Bilanz der Ära Chruschtow. Kohlhammer:
Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz, 189-209
[...]
[1] Mit dieser Scheidung folge ich KERBLAY (1998)
[2] Vgl. KERBLAY (1998), 93
[3] Vgl. TURIN (1944), 17
[4] Vgl. WAGNER (1994), 62
[5] Vgl. KAPPELER (2003), 16f.
[6] ENGELS (1983), 533, 528, 596
[7] Vgl. PIETROW-ENNKER (1999), 339f.; 352f.
[8] Vgl. RAETHER (1986), 19ff.; 131; KERBLAY (1998), 96
[9] Vgl. KAPPELER (2003), 28; HARWIN (1996), 5; MOON (1997), 134
[10] Vgl. HARWIN (1996), 6
[11] Vgl. KAPPELER (2003), 28; KERBLAY (1998), 96; Schröder, Hans-Henning in: TORKE, Historisches Lexikon der Sowjetunion (1993) s.v. Familie, 84
[12] Vgl. KERBLAY (1998), 98f., 101, 113
[13] Vgl. SCHWARCZ (2003), 38; HARWIN (1996), 17f.
[14] Vgl. Schröder, Hans-Henning, in: TORKE (1993), Historisches Lexikon der Sowjetunion (1993) s.v. Familie, 85
[15] Vgl. MOON (1997), 135; HARWIN (1996), 20
[16] Vgl. SCHWEDOW (1993), 32f., 36f.
[17] SCHWEDOW (1993), 36, 37
[18] Vgl. WESTEN (1966), 190; HARWIN (1996), 25; SCHWARCZ (2003), 41
[19] Vgl. HARWIN (1996), 29
[20] Vgl. Schröder, Hans-Hennings, in: TORKE (1993), Historisches Lesikon der Sowjetunion (1993) s.v. Familie, 85; HARWIN (1996), 34
[21] Vgl. SCHWARCZ (2003), 42
[22] Vgl. HARWIN (1996), 40f.; KERBLAY (1998), 127
[23] Vgl. SCHWARCZ (2003), 44; HARWIN (1996), 35
[24] Vgl. HEINDL/HÖSLINGER-FINCK/LIEBHART (2002), 498
[25] KERBLAY (1998), 130
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text über Familienpolitik in der Sowjetunion?
Dieser Text bietet einen Überblick über die Entwicklung der Familienpolitik in der Sowjetunion von 1917 bis 1989. Er beleuchtet die verschiedenen Phasen, von der Revolution und den 20er Jahren über die Stalin-Ära bis hin zur Entstalinisierung und den späten Jahren der UdSSR. Dabei werden die Auswirkungen der Politik auf die Geschlechterverhältnisse, die Rolle der Familie und die demografische Entwicklung untersucht.
Welche Rolle spielte die Familie in der sowjetischen Ideologie der 1920er Jahre?
In den 1920er Jahren wurde die Familie als potenzielles Hindernis für den Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft betrachtet. Reformen zielten darauf ab, die traditionelle Familie zu schwächen und die staatliche Kindererziehung zu fördern, inspiriert von den Ideen von Friedrich Engels und der russischen Frauenbewegung. Die Ehe wurde säkularisiert und Scheidungen erleichtert.
Wie veränderte sich die Familienpolitik unter Stalin?
Unter Stalin erlebte die Familienpolitik eine Wendung hin zu einem konservativeren Ansatz. Während Kollektivierungen bäuerliche Familien zerstörten, wurde gleichzeitig die Bedeutung der Familie als stabile Einheit und Quelle für zukünftige Generationen betont. Abtreibung wurde erneut kriminalisiert, und pronatalistische Maßnahmen wurden eingeführt.
Welche Probleme prägten die Familienpolitik nach Stalin?
Nach Stalins Tod wurden einige restriktive Gesetze gelockert, und soziale Programme wurden ausgebaut. Allerdings entstand ein Widerspruch zwischen der geförderten Berufstätigkeit von Frauen und dem Mangel an Kinderbetreuungseinrichtungen, was zu einer Doppelbelastung führte. Die Geburtenrate sank, und die Abtreibungsquote erreichte Höchststände.
Welche Rolle spielte die Familie in den späten Jahren der UdSSR?
In den späten Jahren der UdSSR wurde die Familie oft als Rückzugsort vor dem Staat wahrgenommen. Die Glorifizierung des Kollektivs führte zu einem verstärkten Fokus auf das Private und die Aufwertung des Zuhauses. Michail Gorbatschow erkannte die Probleme der familiären Bindungen und die Vernachlässigung der familiären Verantwortung an.
Wer waren wichtige Persönlichkeiten im Bereich der Familienpolitik in der Sowjetunion?
Zu den wichtigen Persönlichkeiten gehören Friedrich Engels, dessen Werk die frühe sowjetische Familienpolitik beeinflusste, und Alexandra Kollontai, die als Volkskommissarin für staatliche Fürsorge und Leiterin des Ženotdel eine zentrale Rolle spielte.
Welche Auswirkungen hatte die Politik auf die Geschlechterverhältnisse?
Die sowjetische Familienpolitik hatte widersprüchliche Auswirkungen auf die Geschlechterverhältnisse. Einerseits wurden Frauen formell gleichgestellt und in den Arbeitsmarkt integriert, andererseits blieben traditionelle Rollenbilder bestehen, und Frauen waren oft doppelter Belastung ausgesetzt. Die "Babuška" (Großmutter) spielte eine wichtige Rolle in der Kindererziehung.
Was waren die Hauptziele der sowjetischen Familienpolitik?
Die Hauptziele waren je nach Phase unterschiedlich. In den frühen Jahren lag der Fokus auf der Schwächung der traditionellen Familie und der Förderung staatlicher Erziehung. Unter Stalin wurde die Bedeutung stabiler Familienverhältnisse und einer hohen Geburtenrate betont. Später wurden soziale Programme ausgebaut und versucht, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern.
Wie unterschied sich die sowjetische Familienpolitik von der im Westen?
Die sowjetische Familienpolitik war durch einen stärkeren staatlichen Einfluss auf das Privatleben geprägt. Während der Westen eher auf individuelle Freiheit und Selbstbestimmung setzte, versuchte die Sowjetunion, die Familie in den Dienst des sozialistischen Staates zu stellen.
- Citar trabajo
- Oliver Haag (Autor), 2004, Die Geschichte der Sowjetischen Familie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109282