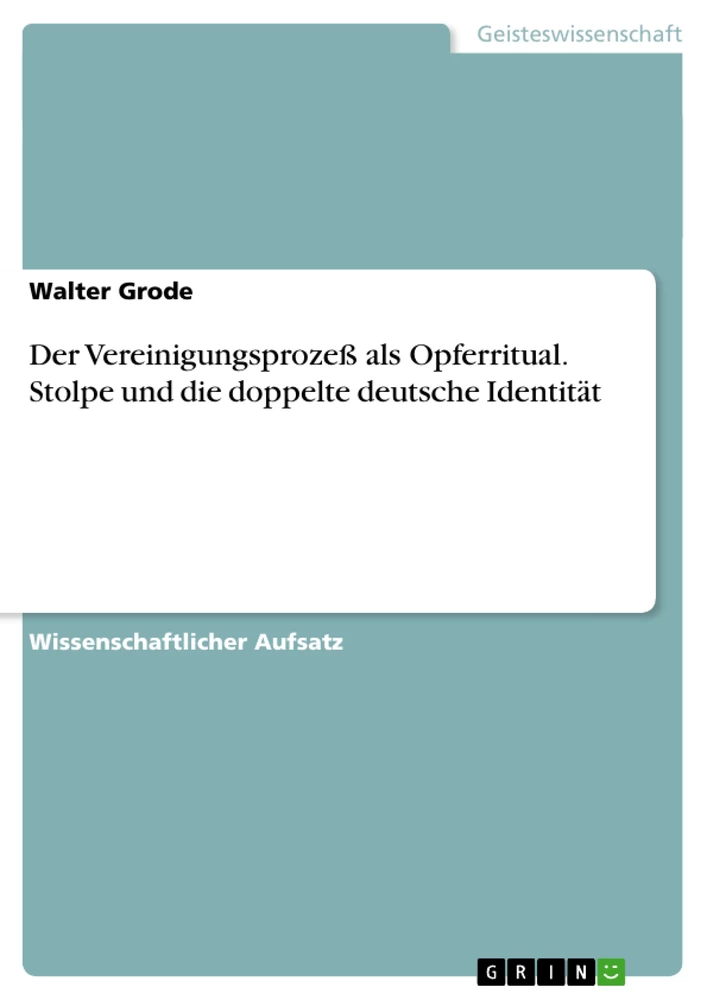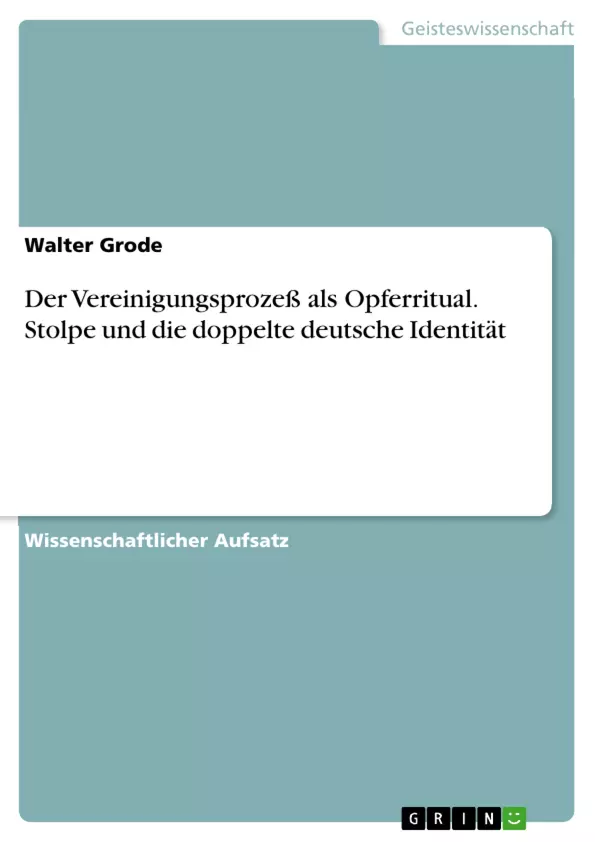DER VEREINIGUNGSPROZESS ALS OPFERRITUAL
Stolpe und die doppelte deutsche Identität
(Erschienen in: >Lutherische Monatshefte<, Heft 6: Juni 1992)
Die Aufarbeitung der >doppelten deutschen Vergangenheit< - wie sie der Stuttgarter Historiker Eberhard Jäckel nennt - ist vorerst nur aus einer doppelten Perspektive möglich. Dennoch hat Wolfgang Thierse recht: Die Art und Weise, wie sich die Ostdeutschen ihrer Geschichte stellen, wird darüber entscheiden, ob auch die Westdeutschen einen Schritt weiterkommen >in der eigenen Geschichtsverarbeitung<. Deshalb und wegen der Art und Weise in der sich der >Prozeß der deutschen Vereinigung< vollzieht, ist es notwendig, daß der >Fall Stolpe< nicht dem Wahrheitsmonopol von Stasi-Akten-Exegeten und >publizistischen Moraltrompeten< (Lothar Baier) überlassen bleibt.
Kämen die Vorwürfe gegen den Brandenburgischen Ministerpräsidenten nur von denjenigen, die sich 1989 als Nicht-Christen unter das schützende Dach der Evangelischen Kirche begeben hatten, die ohne den Schutz der Kirche überhaupt nicht handlungsfähig gewesen wären, so ließe sich dieses Bubenstück relativ leicht mit dem Hinweis auf das anscheinend tiefsitzende Bedürfnis nach dem politischen Vatermord beiseite schieben. Angesichts einer ökonomisch wie sozial-psychologisch prekären Situation soll jedoch offenbar am >Fall Stolpe< entschieden werden, ob eine schattenlose persönliche Vergangenheit als unverzichtbare Voraussetzung für eine einflußreiche Position in Ostdeutschland gilt. Ein Maßstab, der für die westdeutschen Politiker niemals galt – und realistischerweise wohl auch gar nicht gelten konnte, der jedoch an die ostdeutschen schamlos angelegt wird.
Falls Manfred Stolpe mit Hilfe der Stasi-Akten politisch >zur Strecke gebracht< würde, so wäre dies sicherlich dem politischen Elitenwechsel dienlich; ob damit auch der politischen Gerechtigkeit gedient wäre, muß bezweifelt werden. Ganz sicher aber wäre ein Erfolg dieser politischen >Treibjagd< ein Bärendienst für die Verwirklichung der >inneren Einheit<.[...]
DER VEREINIGUNGSPROZESS ALS OPFERRITUAL
Stolpe und die doppelte deutsche Identität
(Erschienen in: >Lutherische Monatshefte<, Heft 6: Juni 1992)
Die Aufarbeitung der >doppelten deutschen Vergangenheit< - wie sie der Stuttgarter Historiker Eberhard Jäckel nennt - ist vorerst nur aus einer doppelten Perspektive möglich. Dennoch hat Wolfgang Thierse recht: Die Art und Weise, wie sich die Ostdeutschen ihrer Geschichte stellen, wird darüber entscheiden, ob auch die Westdeutschen einen Schritt weiterkommen >in der eigenen Geschichtsverarbeitung<. Deshalb und wegen der Art und Weise in der sich der >Prozeß der deutschen Vereinigung< vollzieht, ist es notwendig, daß der >Fall Stolpe< nicht dem Wahrheitsmonopol von Stasi-Akten-Exegeten und >publizistischen Moraltrompeten< (Lothar Baier) überlassen bleibt.
Kämen die Vorwürfe gegen den Brandenburgischen Ministerpräsidenten nur von denjenigen, die sich 1989 als Nicht-Christen unter das schützende Dach der Evangelischen Kirche begeben hatten, die ohne den Schutz der Kirche überhaupt nicht handlungsfähig gewesen wären, so ließe sich dieses Bubenstück relativ leicht mit dem Hinweis auf das anscheinend tiefsitzende Bedürfnis nach dem politischen Vatermord beiseite schieben. Angesichts einer ökonomisch wie sozial-psychologisch prekären Situation soll jedoch offenbar am >Fall Stolpe< entschieden werden, ob eine schattenlose persönliche Vergangenheit als unverzichtbare Voraussetzung für eine einflußreiche Position in Ostdeutschland gilt. Ein Maßstab, der für die westdeutschen Politiker niemals galt - und realistischerweise wohl auch gar nicht gelten konnte, der jedoch an die ostdeutschen schamlos angelegt wird.
Falls Manfred Stolpe mit Hilfe der Stasi-Akten politisch >zur Strecke gebracht< würde, so wäre dies sicherlich dem politischen Elitenwechsel dienlich; ob damit auch der politischen Gerechtigkeit gedient wäre, muß bezweifelt werden. Ganz sicher aber wäre ein Erfolg dieser politischen >Treibjagd< ein Bärendienst für die Verwirklichung der >inneren Einheit<. Mehr noch: Im Sinne dieser >inneren Einheit< sollte bedacht werden, ob Fragen der politischen Gerechtigkeit nicht hinter die ethisch-politische Grundfrage nach den prägenden Dispositionen und Überlieferungen einer Seite unserer spezifisch deutschen Lebensform zurückzutreten haben. Unter diesem Aspekt wird eher die gemeinsame Pathologie zum Thema als die unter dem Gesichtspunkt politischer Gerechtigkeit notwendige Differenzierung zwischen Opfern und Tätern. Dieser Impuls wird in Fragen deutlich, die Rainer Eppelmann von der Enquetekommission des Bundestages und Friedrich Schorlemmer im Leipziger >Forum für Aufarbeitung und Erneuerung< geklärt sehen möchten: "Warum haben eigentlich hunderttausende von DDR-Bürgern (nicht allein) bei den sog. >Kampfdemonstationen< denen zugejubelt, die sie dreißig Jahre lang eingesperrt gehalten haben? Warum waren 98 Prozent der Schulanfänger bei den jungen Pionieren, dem Verband der Staatspimpfe? Warum waren 85 oder 90 Prozent der Arbeitnehmer im FDGB, obwohl fast alle gewußt haben, mit Gewerkschaft hat der Verein nicht viel zu tun? Bloß deswegen, weil sie hofften, alle zwei Jahre eine verbilligte Reise machen zu können?"
Solche Fragen fallen um so schwerer ins Gewicht, als das SED-Regime in der Bevölkerung sehr viel weniger spontane Unterstützung genossen hat als das NS-Regime. Der Alltag im Nationalsozialismus, der in dieser Hinsicht noch viel größere Rätsel aufgibt als der DDR-Alltag, ist in den >geheimen Lageberichten des Sicherheitsdienstes der SS< präzise festgehalten worden. Zusammengefaßt und in 17 Bänden vom Koblenzer Bundesarchiv anonymisiert veröffentlicht, ist er in jeder Stadtbibliothek der alten Bundesrepublik (auch ohne Antrag auf Akten-Einsicht bei der Gauck-Behörde) frei zugänglich.
Ein konkreter Ausgangspunkt für die anstehende Diskussion zur gesamtdeutschen Vergangenheitsaufarbeitung wäre beispielsweise die Überlegung, die kürzlich Gerd Heidenreich, der Präsident des westdeutschen PEN-Zentrums, in einem Interview äußerte: "Die Grundfrage lautet doch eigentlich, was waren die Bedingungen, die Anlässe und die Gründe dafür, daß sich die Blockwart-Mentalität der Nazis bruchlos fortgesetzt hat in einem Teil Deutschlands. Und wenn wir ehrlich sind müssen wir voraussetzten, daß sie sich auch hier, im Westen, fortgesetzt hätte, wenn sie denn ermuntert, mit Vorteilen versehen worden wäre. Die Stasi-Abrechnung entbindet ja nicht von der Frage: Was sind die gemeinsamen Grundlagen der deutschen Staaten, die historischen Voraussetzungen für einen Staat, der keine Widersprüche in sich duldet."
Im Gegensatz zur Zustimmung zum NS-Regime blieben die oben zitierten >Zustimmungsrituale< der überwiegenden Mehrheit der ostdeutschen Bevölkerung eher äußerliche. Dies zeigt eine jüngst erschienene umfangreiche Studie des Bochumer Historikers Lutz Niethammer zur DDR-Alltagsgeschichte. Ihre Identität bestand weder aus der Identifizierung mit dem SED-Staat, noch aus der Erfahrung des Widerstands. Die Mehrheit war so, wie die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg allesamt gern gewesen wären: gefangen in einem weitgehend un- und halbpolitischer Alltag. Und zu dieser Normalität des Alltäglichen gehörten (verursacht durch tapferes Wegsehen) auch unvermeidliche moralisch-schuldhafte Verstrickungen. Denn diese Mehrheit zog, wie dies der junge Friedrich Hölderlin (mit einem tiefen Blick in >die deutsche Seele<) schon vor zweihundert Jahren resigniert anerkennen mußte, die ruhige Knechtschaft der gefahrvollen Freiheit vor.
Der ehemalige Konsistorialpräsident Stolpe war in diesem Sinne mit Sicherheit weit weniger in die DDR-Geschichte verstrickt, als die Mehrzahl der Ostdeutschen. Je mehr >dunkle Punkte< also in Zukunft aus den Stasi-Akten hervorgezerrt werden mögen, desto eher könnte seine Biographie exemplarisches Beispiel sein, wie im >vormundschaftlichen Staat< (Rolf Henrich) dennoch gehandelt werden konnte. Ließe man Stolpe - mit allen seinen Verstrickungen - nun stellvertretend und gemeinsam mit allen ehemaligen DDR-Bürger die Chance der eigenen Vergangenheitsaufarbeitung und womöglich sogar die des Aufbaus eines eigenständigen politischen uns sozialen Projekts in Brandenburg, so gewönnen die ostdeutschen Bundesbürger - neben ihren zutiefst widersprüchlichen DDR-Erfahrungen - unter Umständen neue, eigene Erfahrungen, die es vielleicht an die Westdeutschen weiterzugeben lohnt.
Auch wenn dies von den >Vollstreckern der Einheit< gerade nicht beabsichtigt war und ist und - um kurzfristiger Vorteile willen - offenbar unter allen Umständen verhindert werden soll, so ist dies doch der einzige Weg, um das Verhältnis zwischen West und Ost zu einem gleichwertigen - auf Geben und Nehmen beruhenden - werden zu lassen. Konkret heißt das: Für die Millardenbeträge die Jahr für Jahr - wahrscheinlich noch für mehr als eine Generation - in den Osten transferiert werden müssen, muß >etwas zurückgegeben< werden und zwar nicht nur den westdeutschen Eliten, die ohnehin zu den >eigentlichen Gewinnern< der Einheit geworden sind, sondern vor allem jenen, die tatsächlich die Lasten der Einheit zu tragen haben.
Zu einem - wie auch immer gearteten - Austausch kommt es natürlich bereits jetzt. Nur verläuft er nicht gleichwertig und ist damit immanent >unfreundlich<. Denn bisher verlief der deutsche Vereinigungsprozeß eher in der Form eines (Selbst-)Opferrituals:
Für die Dreingabe der ohnehin kaum entwickelten eigenen Identität erhoffte sich >das gestürzte Volk< der Ostdeutschen (Hans-Joachim Maaz) die Aufnahme in den gesamtdeut-schen Konsumhimmel. Dieser Hoffnung ist inzwischen eine heilsame >Ent-Täuschung< gefolgt: Die westdeutschen Götter entpuppten sich als Geschäftemacher, Geizkragen und Habenichtse. Doch nun stehen die Ostdeutschen mit leeren Händen da. Der >Austausch< aber geht weiter, auch wenn er kein Band knüpfen und festigen wird, da er nicht - wie wir bereits aus der vergleichenden Verhaltensforschung lernen können - auf Reziprozität, auf einem gerechten Geben und Nehmen beruht.
Dabei haben die Ostdeutschen durchaus Erfahrungen gemacht, die einen positiven Austausch in Gang setzen könnten:
- So z.B. die basisdemokratischen Erfahrungen des Herbstes 1989, die sich jetzt (zumindest in Teilen) in der neuen brandenburgischen Verfassung wiederfinden.
- So der Versuch der Verwirklichung eines sozialen >Modells Brandenburg<, das beispielhaft sein könnte, für eine Re-Formierung des Sozialstaats unter den Bedingungen der Marktdominanz.
- So die aus der Not geborenen solidarischen Verhaltensweisen, die im Westen längst dem Individalisierungsschub der Moderne zum Opfer gefallen sind.
- Und nicht zuletzt die Art und Weise, wie es ihnen ermöglicht wird sich zu ihrer Geschichte zu stellen. Sie könnte uns allen helfen, einen gemeinsamen Blick auf die tiefe Widersprüchlichkeit des >deutschen Wesens< zu wagen, das in Situationen, in denen es sich in den eigenen Ambitionen und der eigenen Sekurität bedroht fühlt, noch allemal katastrophisch reagiert.
Zu befürchten ist jedoch, daß sich der >negative< Austausch, in dem sich derzeit (nicht allein) der deutsche Vereinigungsprozeß vollzieht, fortsetzen wird: Der Westen wird auch weiterhin Ziel der ostdeutschen Binnenwanderung sein, mit allen ihren sozialen und politischen Begleiterscheinungen. Und der Osten wird (nicht nur in Schönberg) auch zukünftig das Ziel westlicher Mülltransporte bleiben.
Häufig gestellte Fragen zu "DER VEREINIGUNGSPROZESS ALS OPFERRITUAL"
Worum geht es in dem Text?
Der Text "DER VEREINIGUNGSPROZESS ALS OPFERRITUAL" analysiert den deutschen Vereinigungsprozess nach 1990, insbesondere im Hinblick auf die Rolle Ostdeutschlands und die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit. Er argumentiert, dass der Vereinigungsprozess eher einem (Selbst-)Opferritual gleicht, bei dem Ostdeutsche ihre Identität aufgeben, um in den "gesamtdeutschen Konsumhimmel" aufgenommen zu werden, was jedoch zu Enttäuschung führt.
Was ist der "Fall Stolpe" und warum ist er wichtig?
Der "Fall Stolpe" bezieht sich auf die Vorwürfe gegen den brandenburgischen Ministerpräsidenten Manfred Stolpe, die auf Stasi-Akten basieren. Der Autor argumentiert, dass die Art und Weise, wie mit Stolpes Vergangenheit umgegangen wird, entscheidend dafür ist, ob Ostdeutschen eine faire Chance zur Aufarbeitung ihrer Geschichte gegeben wird und ob eine "innere Einheit" Deutschlands erreicht werden kann. Er befürchtet, dass eine Verurteilung Stolpes aufgrund von Stasi-Akten eine schattenlose Vergangenheit als Voraussetzung für politische Positionen in Ostdeutschland festlegen würde, was für westdeutsche Politiker nie galt.
Welche Rolle spielt die Vergangenheitsaufarbeitung der DDR?
Die Vergangenheitsaufarbeitung der DDR ist zentral für den Text. Der Autor betont, dass es wichtig ist, nicht nur Täter zu identifizieren, sondern auch die Gründe für die breite Zustimmung oder zumindest die passive Teilnahme der Bevölkerung am DDR-System zu verstehen. Er zitiert Fragen von Rainer Eppelmann und Friedrich Schorlemmer, die sich damit beschäftigen, warum so viele DDR-Bürger an staatlichen Ritualen teilgenommen haben.
Welche Kritik wird am Vereinigungsprozess geübt?
Der Text kritisiert, dass der Vereinigungsprozess nicht auf Gegenseitigkeit und gerechtem Geben und Nehmen beruht. Der Autor argumentiert, dass Westdeutschland zwar Milliarden in den Osten transferiert, aber die ostdeutschen Erfahrungen und Perspektiven nicht ausreichend wertschätzt. Er befürchtet, dass Ostdeutschland zu einem deutschen "Mezzogiorno" wird, einem abgehängten Gebiet, von dem man sich distanzieren möchte.
Welche positiven Erfahrungen könnten aus der DDR-Vergangenheit gezogen werden?
Der Text nennt einige positive Erfahrungen aus der DDR-Vergangenheit, die für den gesamtdeutschen Diskurs relevant sein könnten: basisdemokratische Erfahrungen vom Herbst 1989, der Versuch eines sozialen "Modells Brandenburg", solidarische Verhaltensweisen und die Art und Weise, wie Ostdeutsche sich ihrer Geschichte stellen. Diese Erfahrungen könnten dazu beitragen, ein tieferes Verständnis des "deutschen Wesens" zu entwickeln.
Was bedeutet die "Blockwart-Mentalität" und wie hängt sie mit der DDR-Vergangenheit zusammen?
Der Autor bezieht sich auf die "Blockwart-Mentalität" der Nazis und argumentiert, dass sich diese in Teilen Deutschlands bruchlos fortgesetzt hat. Er zitiert Gerd Heidenreich, der fragt, welche Bedingungen und Gründe dazu geführt haben, dass sich diese Mentalität in der DDR erhalten konnte. Er betont, dass die Stasi-Abrechnung nicht von der Frage entbindet, welche gemeinsamen Grundlagen die deutschen Staaten haben, die zu einem Staat führen, der keine Widersprüche duldet.
Welche Rolle spielt die evangelische Kirche im "Fall Stolpe"?
Die evangelische Kirche spielte im "Fall Stolpe" eine wichtige Rolle, da Stolpe Konsistorialpräsident war. Der Text erwähnt, dass sich 1989 viele Nicht-Christen unter den Schutz der Kirche begeben hatten. Die Kirche wird somit als ein Raum dargestellt, in dem auch Kritik am System möglich war.
- Quote paper
- Dr. phil. Walter Grode (Author), 1992, Der Vereinigungsprozeß als Opferritual. Stolpe und die doppelte deutsche Identität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109300