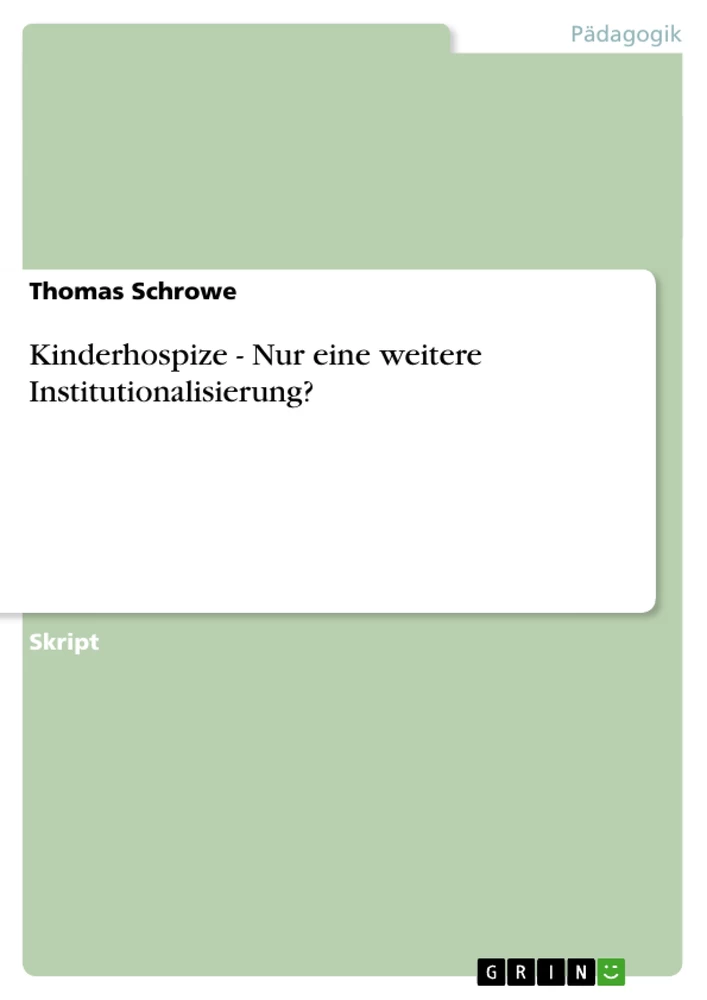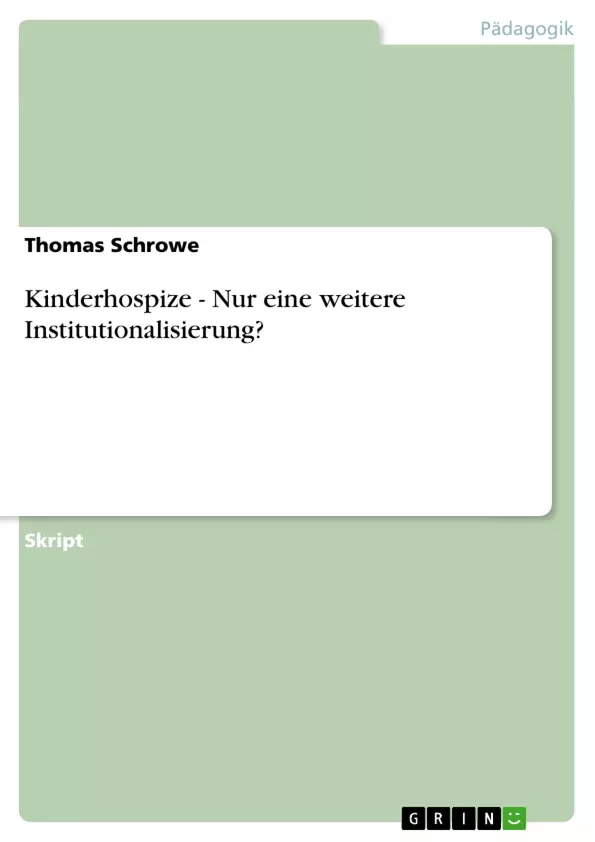0. Gliederung
1. Einführung – Tod und Sterben in unserer Gesellschaft
2. Krankheit, Sterben und Sterbebegleitung
- Ausgangslage – progredient oder todsterbenskranke Kinder
- Hospitalismus und seine Folgen
- Alternativen – angstfreies und würdevolles Ableben
- Der Pädagoge als Sterbebegleiter
3. Die Hospizidee
4. Kinderhospize
- Innovative Ansätze der Sterbebegleitung von Kindern
- Grundlegende Leistungsanforderungen
- Allgemeine Grundsätze der Begleitung von Kindern mit verkürzter Lebenserwartung
- Anforderungen an die materielle Ausstattung
- Anforderungen an die personelle Ausstattung
- Kooperation und Vernetzung
- Der häusliche Kinderhospizdienst
5. Schlussbemerkungen
1. Einleitung – Tod und Sterben in unserer Gesellschaft
- Zum Leben gehört auch der Tod – er ist etwas Verlässliches wie nichts anderes
- Gerade wegen dieser Sicherheit wird dieses Thema aus dem Bewusstsein des Menschen und im gesellschaftlichen Leben ausgesondert
➔ Institutionalisierung des Sterbens
- Todesfälle werden durch unsere Medien täglich direkt in die Wohnzimmer serviert
- Der Kontakt mit den Toten bleibt jedoch indirekt
- Es entsteht Abwehr, Gleichgültigkeit und Abstumpfung von Tod und Sterben
- Es gibt in der heutigen Gesellschaft kaum unmittelbare Konfrontation mit dem Tod
➔ Begegnet man Tod und Sterben im Freundeskreis oder Familie fühlen sich viele ohnmächtig, unsicher und handlungsunfähig
- Tod stellt häufig ein Tabu dar
- Es besteht ein Kommunikationshemmnis
- Es besteht relativ große Diskrepanz zwischen Informationsbedarf und Informiertheit
2. Krankheit, Sterben und Sterbebegleitung
2.1. Ausgangslage – progredient oder todsterbenskranke Kinder
- Nicht selten haben wir in der Sonder- und Integrationsschule progredient kranken Kindern
- Wenn diese die Endgültigkeit des Todes realisieren, sind sie traurig, verbittert, ziehen sich zurück und schweigen
- Progredient kranke Kinder wehren sich gegen ihre „rückläufige“ Entwicklung, da sie darin die Lebensbedrohung erkennen
- Sie reagieren sehr ängstlich auf Krankenhausaufenthalte
- Das Bedürfnis nach sozialen Kontakten dieser Kinder muss befriedigt werden
- Damit werden die Identifikationsmöglichkeiten nicht zu sehr eingeschränkt
2.2. Hospitalismus und seine Folgen
- Aus medizinisch-therapeutischen Gründen müssen diese Kinder oft ins Krankenhaus
- Das Krankenhaus ist auch zum größten Teil der Ort des Sterbens geworden
- Das Krankenhaus besitzt wesentliche Merkmale einer „totalen Institution“
- Regelung und Kontrolle der Aktionen und Abschirmung der Anvertrauten
- Es wird versucht Krankenhäuser kindgerechter zu gestalten
- Zumeist finden sich jedoch nur Verzierungen und die Hospitalatmosphäre bleibt
- Eine mögliche Maßnahme ist die Mit-Aufnahme der Mutter ins Krankenhaus
- Es kommt zur Trennung vom Freundeskreis und zum Verlust der Gruppenidentität
- Ein verändertes Selbstgefühl kann die Folge sein
- Möglich sind Stigmatisierungsgefühle und gestörte Identifikation mit Gesunden
- Kinderhospize sollen Kindern und ihren Familien aus diesen Teufelskreisen heraushelfen.
Alternativen – angstfreies und würdevolles Ableben
- Hospize als Raststätten auf dem Wege für Menschen im Endstadium ihrer Krankheit
- Sie sind eine Institution oder ein mobiles Betreuungsteam zur Versorgung Sterbender
- Das Hospiz versteht sich als ideelles Konzept
- Ziel ist, dem Leben auch in der Endphase einen Sinn zu geben
- Das Zuhause ist für lebensbedrohlich erkrankte Kinder eine wichtige Alternative
- Die gewohnte Atmosphäre wirkt angstmindernd
- Der Abschied kann individuell gestaltet werden
- Dem Hospizgedanken geht es deshalb nicht nur um „neue Häuser“ (Institutionen)
- Es sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die den Betroffenen erlauben, ihre Krankheit und Lebenssituation anzunehmen und auszuhalten
- Dazu gehört auch die notwendige Pflege und Palliativbehandlung
- Beim Zuhören werden die Betroffenen signalisieren, was noch wichtig für sie ist
- Sterbende wollen in möglichst normal weiterleben und brauchen einen Rahmen dazu
- Betroffene dürfen nicht den sozialen Tod sterben, bevor sie wirklich gestorben sind, nur weil sich alle aus Angst oder Unsicherheit zurückziehen
- Es werden Hilfen zur emotionalen Verarbeitung der letzten Lebensphase gebraucht
Der Pädagoge als Sterbebegleiter
- Der Lehrer hat große Bedeutung in der Begleitung lebensbedrohlich erkrankter Schüler
- Er hat engeren persönlichen Kontakt zum Schüler als der Rest des Betreuungsteams
- Andererseits ist er dem Kind nicht so nahe wie andere Bezugspersonen
- Auch das außerschulische Umfeld muss mit in die Arbeit einbezogen werden
- Die Schulzeit ist für Betroffene meist keine Übergangs-, sondern eine Erfüllungsphase
- Der Unterricht symbolisiert für sie ein stückweit Normalität
- Ihnen ist wichtig, Leistung zu erbringen, um das Gefühl zu haben, etwas wert zu sein
- In der Endphase machen diese Kinder gerne Geschenke, um nicht vergessen zu werden
- Kleiner persönliche Geschenke können im Unterricht hergestellt werden
- Dabei wird das Könnensbewusstsein und die Funktionslust des Kindes bestärkt
3. Die Hospizidee
- Das Wort Hospiz leitet sich aus dem Lateinischen ab und heißt übersetzt Herberge
- Die modernen Hospize sind Einrichtungen mit dem Grundsatz, unheilbar kranken Menschen ein würdiges Sterben in Gemeinschaft und in gewohnter Umgebung zu ermöglichen
- Die meisten assoziieren mit dem Namen Kinderhospiz sofort Tod und Trauern und meiden diese – dass aber auch Leben und Lachen dahinein gehört übersehen sie
- Die Aufgabe von Hospizen liegt nicht nur in der Betreuung von Sterbenden
- Sie müssen hinauswirken in die Öffentlichkeit
- Ziel ist Verleugnungshaltung in eine mitmenschliche Anteilnahme zu verändern
- Das Hospiz ist weniger an ein Haus gebunden, es ist vielmehr ein Konzept der medizinischen, pflegerischen und spirituellen Fürsorge
- Es ist ganzheitliche ausgerichtet unter Einbeziehung und Mitbetreuung der Angehörigen
- Zentral ist, das der Sterbende bis zum Tod so bewusst wie möglich am Leben teilnimmt
- Grundsätzlich können vier Organisationsformen unterschieden werden:
1. Die unabhängige stationäre und ambulante Einheit
2. Die abhängige ambulante Einheit (in einer Klinik)
3. Das rein ambulant arbeitendes Team
4. Betreuungsteams, zur beratenden Unterstützung von Institutionen und Helfern
4. Kinderhospize
4.1. Innovative Ansätze der Sterbebegleitung von Kindern
- Ein Kinderhospiz soll einmal ein zweites Zuhause für die betroffenen Kinder werden
- Weiter soll die ganzen Familie entlastet und die häusliche Pflege ergänzt werden
- Es soll geholfen werden, die verbleibende Zeit gemeinsam erfüllt und positiv zu gestalten
- Kinderhospizarbeit ergänzt die bestehenden Versorgungsstrukturen, ohne dabei zu diesen in Konkurrenz zu treten und schließt eine bestehende Versorgungslücke
Grundlegende Leistungsanforderungen
- Pflege und Betreuung der erkrankten Kinder
- Körperbezogene Pflegemaßnahmen
- Gezielte Ressourcenförderung
- Unterstützung bei der psychischen Bewältigung von Krankheit und Sterben
- Unterstützung der Eltern
- Entlastung
- Ganze oder partielle Übernahme der Versorgungspflichten für gewisse Zeit
- Einzel- oder Gruppengespräche um Ängste, Sorgen o.ä. zu thematisieren
- Pflegerische Anleitung
- Information und Beratung
- Psychosoziale Unterstützung und Trauerbegleitung
- Unterstützung der Geschwisterkinder
- Geschwisterkinder benötigen ebenso Unterstützung bei der Deutung des Geschehens
- Dazu bedarf es Hilfen beim Umgang mit Stigmatisierungstendenzen im Freundeskreis
- Auch die Trauerbegleitung der Geschwisterkinder hat einen besonderen Stellenwert
Allgemeine Grundsätze der Begleitung von Kinder mit verkürzter Lebenserwartung
- Das Leben und die Lebensfreude stehen im Mittelpunkt.
- Die häusliche Umgebung ist Zentrum der Versorgung
- Ziel ist, Voraussetzungen für häusliche Pflege zu verbessern und zu stabilisieren
- Der Versorgungsalltag orientiert sich an Bedürfnissen und Gewohnheiten der Familie
- Die Unterstützung richtet sich an das gesamte Familiensystem
- Außerdem erfährt die Familie eine qualifizierte Sterbebegleitung in vertrauter Umgebung.
Anforderungen an die materielle Ausstattung
- Anklänge an Pflegeheime und Krankenhäuser sind zu vermeiden
- Häuslicher Charakter der Räumlichkeiten ist zu gewährleisten
- Unterkunftsmöglichkeiten für Angehörige sind zu schaffen
- Unterbringung der Kinder in Einzelzimmern mit Spielraum für eigene Ausgestaltung
- Abschiedsraum ohne religiöse und weltanschauliche Festlegungen
Anforderungen an die personelle Ausstattung
- Mitarbeiter mit medizinischer, pflegerischer und pädagogischer Ausbildung
- Möglichkeiten der Supervision und Weiterbildung sollten ausgeschöpft werden
- Ehrenamtliche Mitarbeiter sollen voll einbezogen, aber ständig angeleitet werden
- Vermittelte ehrenamtliche Helfer übernehmen für eine Familie eine Patenschaft, d.h.:
- durch regelmäßige Besuche den Kontakt halten,
- durch Beaufsichtigen der (Geschwister-) Kinder die Familie entlasten und
- bei Bedarf Fachdienste vermitteln
Kooperation und Vernetzung
- Kooperation zu Ärzten, Therapeuten und Seelsorgern
- Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen und Instanzen der Versorgung und Unterstützung
4.2. Der häusliche Kinderhospizdienst – Ambulant vor stationär
- Kinderhospize sind Station sowohl auf dem Lebensweg als auch am Lebensende
- Die Familien benötigen pädagogische, psychologische und sozialarbeiterische Begleitung
- Es gibt pädagogische Angebote für die kranken Kinder, die Geschwister und die Eltern.
- Das Kinderhospiz verschafft den Familien eine Atempause, die sie zu Hause kaum haben.
- Eltern können sich verstärkt den gesunden Geschwistern widmen
- Sie können einmal nur schöne und angenehme Dinge mit ihrem kranken Kind erleben
- Sie werden (im Vermögen) gestärkt, ihr schwerstkrankes Kind zu Hause zu versorgen.
- Sie haben hier verlässliche Partner, die mit ihr gemeinsam ein Stück des Weges gehen
- Ein "zweites Zuhause", in das man gehen kann, wenn im "ersten" nichts mehr geht
- Die kranken Kinder können mit anderen kranken Kindern in Kontakt treten
- Für Geschwister ist es wichtig, andere Geschwister in der gleichen Situation zu treffen, denen man nichts erklären muss
- Ambulante Begleitung ist kein Trend, sondern ein wichtiger Grundsatz der Hospizarbeit
- Betroffenen Familien wollen den privaten Lebensalltag weitest möglich aufrecht erhalten
- Daher werden betroffene Familien direkt in der Bewältigung des Alltags unterstützt
- Ziel der häuslichen Kinderhospize ist es,
- die große Hilflosigkeit abzubauen,
- das Umfeld der Kinder und Familien zu stärken,
- das sterbende Kind zu begleiten,
- die Angehörigen zu entlasten und zu unterstützen
- Paten kommen dazu in die Klinik und in die Familie und bringen vor allem Zeit mit
- Die Paten sehen sich als Partner der betroffenen Kinder, möchten deren Eltern entlasten und kümmern sich auch um die Geschwisterkinder
- Sie wollen Freiräume für möglichst hohe Lebensqualität und Selbstbestimmung schaffen
5. Schlussbemerkungen
- Über den Sinn von Kinderhospizen:
- Zum einen geht es darum, die Familien zu entlasten.
- Durch die von Fachkräften geleiteten Kurzzeitpflege im Kinderhospiz soll den betroffenen Kindern und Eltern eine Atempause verschafft werden.
- Diese ist wichtig, um sich z.B. stärker auf Geschwisterkinder zu konzentrieren
- Wenn der Tod nahe ist, kommt dem Kinderhospiz besondere Verantwortung zu
- Es ist ein würdiger Tod daheim im Kreis der Familie und Freunde anzustreben.
- Da dies aus persönlichen oder medizinischen Gründe nicht immer möglich ist, soll im Kinderhospiz eine qualifizierte Sterbebegleitung angeboten werden
- Die Eltern können so von der Pflege im Endstadium entweder entlastet oder aber im Rahmen ihrer persönlichen Möglichkeiten mit eingebunden werden.
- Eine optimale medizinische Versorgung ist sichergestellt, was den Einsatz der Schmerztherapie angeht.
- Eltern, die ihre sterbenden Kinder bis zum Tod zu Hause pflegen möchten, will das Kinderhospiz eine ambulante Betreuung anbieten.
6. Literatur
/1./ Bürgin, Dieter:
Das Kind, die lebensbedrohende Krankheit und der Tod. 1. Nachdruck; Verlag Hans Huber Bern; Stuttgart, Wien; 1981 [Seite 274 – 300]
/2./ Deutscher Kinderhospizverein e.V.:
Ambulant vor stationär - niedergelassene Kinderärzte sind wichtige Ansprechpartner für die Familien.
Online: URL: http://www.deutscher-kinderhospizverein.de/fachartikel_einzel.php?id=3 [15.04.2005]
/3./ Deutscher Kinderhospizverein e.V.:
"Begleitung von sterbenden Kindern durch ambulante Hospizdienste" – Bericht über einen Projekttag von ALPHA in der Zeitschrift Hospizdialog.
Online: URL: http://www.deutscher-kinderhospizverein.de/fachartikel_einzel.php?id=1 [15.04.2005]
/4./ Deutscher Kinderhospizverein e.V.:
Konzept des ambulanten Kinderhospizdienstes Kreis Unna und Hamm.
Online: URL: http://www.deutscher-kinderhospizverein.de/fachartikel_einzel.php?id=6 [15.04.2005]
/5./ Fuchs, Michael:
Sterben und Sterbebegleitung: Ein interdisziplinäres Gespräch.
Band 122 – Schriftenreihe des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugen.
Verlag W. Kohlhammer; Stuttgart, Berlin, Köln; 1996 [Seite 64 – 68, 99 – 112]
/6./ Glaser, Barney G. und Strauss, Anselm L.:
Betreuung von Sterbenden – Eine Orientierung für Ärzte, Pflegepersonal, Seelsorger und Angehörige. 2. Auflage; Vandenhoeck & Ruprecht; Göttingen – Zürich; 1965 [Seite 114 – 177]
/7./ Häcker, Birgit:
Hospiz und Sterbebegleitung.
Online: URL: http://www.hausarbeiten.de/faecher/hausarbeit/pfl/17657.html [Stand: 15.04.2005]
/8./ Kasteel, Ludwig:
Der „verfrühte“ Tod: Das krebskranke Kind – Betreuung und Begleitung.
Carl Marhold Verlagsbuchhandlung; Berlin; 1986
/9./ Kinderhospizverein Cuxhaven e.V.:
Hilfe, wo sie benötigt wird.
Online: URL: http://www.kinderhospiz-cuxhaven.de/html/ambulant.html [Stand: 15.04.2005]
/10./ Kinderhospizverein Cuxhaven e.V.:
Unsere Aufgaben und Ziele.
Online: URL: http://www.kinderhospiz-cuxhaven.de/html/aufgaben.html [Stand: 15.04.2005]
/11./ Kinderhospiz Regenbogenland:
Was ist ein Kinderhospiz?
Online: URL: http://www.kinderhospiz-regenbogenland.de/wasist.htm [Stand: 15.04.2005]
/12./ Leyendecker, Christoph und Lammers, Alexandra:
„Lass mich einen Schritt alleine tun“ – Lebensbeistand und Sterbebegleitung lebensbedrohlich erkrankter Kinder.
Verlag W. Kohlhammer; Stuttgart, Berlin, Köln; 2001 [Seite 9 – 11, 42 – 45, 51 – 65, 132 – 147]
/13./ Mörchen, Annette:
Die Hospizidee braucht keine Mauern – Auf dem Weg zu einem integrativen Hospizverständnis: Fachtagung am 25./26. April 1994 in Bonn.
Band 118 – Schriftenreihe des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugen.
Verlag W. Kohlhammer; Stuttgart, Berlin, Köln; 1996 [Seite 15 – 24, 55 – 69]
/14./ Thielecke, Anna Kathrin:
Hospizbewegung – Eine Alternative zur Sterbehilfe.
Online: URL: http://www.hausarbeiten.de/faecher/hausarbeit/thg/20296.html [Stand: 15.04.2005]
/15./ Wingenfeld, Klaus und Mikula, Marion:
Innovative Ansätze der Sterbebegleitung von Kindern: Das Kinderhospiz Balthasar. Forschungsbericht.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptthemen des Textes?
Der Text behandelt die Themen Tod und Sterben in der Gesellschaft, Krankheit, Sterbebegleitung, die Hospizidee, Kinderhospize und innovative Ansätze der Sterbebegleitung von Kindern.
Was wird über Tod und Sterben in der Gesellschaft gesagt?
Der Text kritisiert die Institutionalisierung des Sterbens und die daraus resultierende Abwehr, Gleichgültigkeit und Abstumpfung gegenüber Tod und Sterben. Viele Menschen fühlen sich ohnmächtig und unsicher, wenn sie mit Tod und Sterben im Freundeskreis oder in der Familie konfrontiert werden. Es besteht oft ein Kommunikationshemmnis und eine Diskrepanz zwischen Informationsbedarf und Informiertheit.
Was sind die Herausforderungen bei der Betreuung von progredient kranken Kindern?
Progredient kranke Kinder realisieren die Endgültigkeit des Todes, was zu Trauer, Verbitterung, Rückzug und Schweigen führen kann. Sie wehren sich gegen ihre "rückläufige" Entwicklung und reagieren ängstlich auf Krankenhausaufenthalte. Es ist wichtig, ihre sozialen Kontakte aufrechtzuerhalten.
Was ist Hospitalismus und welche Folgen hat er?
Hospitalismus bezieht sich auf die negativen Auswirkungen von langen Krankenhausaufenthalten, insbesondere bei Kindern. Dazu gehören Regelung und Kontrolle der Aktionen, Abschirmung, Trennung vom Freundeskreis, Verlust der Gruppenidentität, verändertes Selbstgefühl, Stigmatisierungsgefühle und gestörte Identifikation mit Gesunden.
Welche Alternativen gibt es zu einem angstvollen und unwürdigen Ableben?
Hospize bieten eine Alternative als Raststätten für Menschen im Endstadium ihrer Krankheit. Sie sind Institutionen oder mobile Betreuungsteams, die Sterbende versorgen. Das Hospiz versteht sich als ideelles Konzept, das dem Leben auch in der Endphase einen Sinn geben soll. Das Zuhause ist eine wichtige Alternative für lebensbedrohlich erkrankte Kinder, da die gewohnte Atmosphäre Ängste mindert und einen individuellen Abschied ermöglicht.
Welche Rolle spielt der Pädagoge in der Sterbebegleitung?
Der Lehrer hat eine große Bedeutung in der Begleitung lebensbedrohlich erkrankter Schüler. Er hat engeren persönlichen Kontakt zum Schüler als der Rest des Betreuungsteams, ist ihm aber nicht so nahe wie andere Bezugspersonen. Die Schulzeit symbolisiert für die Kinder Normalität. In der Endphase machen diese Kinder gerne Geschenke, um nicht vergessen zu werden.
Was ist die Hospizidee?
Die Hospizidee basiert auf dem Grundsatz, unheilbar kranken Menschen ein würdevolles Sterben in Gemeinschaft und in gewohnter Umgebung zu ermöglichen. Die Aufgabe von Hospizen liegt nicht nur in der Betreuung von Sterbenden, sondern auch darin, in die Öffentlichkeit zu wirken und die Verleugnungshaltung in eine mitmenschliche Anteilnahme zu verändern. Das Hospiz ist weniger an ein Haus gebunden, es ist vielmehr ein Konzept der medizinischen, pflegerischen und spirituellen Fürsorge, ganzheitlich ausgerichtet unter Einbeziehung und Mitbetreuung der Angehörigen.
Was sind Kinderhospize?
Ein Kinderhospiz soll ein zweites Zuhause für die betroffenen Kinder werden, die ganze Familie entlasten und die häusliche Pflege ergänzen. Es soll geholfen werden, die verbleibende Zeit gemeinsam erfüllt und positiv zu gestalten. Kinderhospizarbeit ergänzt die bestehenden Versorgungsstrukturen und schließt eine bestehende Versorgungslücke.
Welche Leistungen bieten Kinderhospize an?
Zu den grundlegenden Leistungsanforderungen gehören die Pflege und Betreuung der erkrankten Kinder, die Unterstützung der Eltern (Entlastung, Gespräche, pflegerische Anleitung, Information und Beratung), die psychosoziale Unterstützung und Trauerbegleitung sowie die Unterstützung der Geschwisterkinder.
Was sind die allgemeinen Grundsätze der Begleitung von Kindern mit verkürzter Lebenserwartung?
Das Leben und die Lebensfreude stehen im Mittelpunkt. Die häusliche Umgebung ist Zentrum der Versorgung. Die Unterstützung richtet sich an das gesamte Familiensystem. Die Familie erfährt eine qualifizierte Sterbebegleitung in vertrauter Umgebung.
Welche Anforderungen gibt es an die materielle und personelle Ausstattung von Kinderhospizen?
Anklänge an Pflegeheime und Krankenhäuser sind zu vermeiden. Es soll ein häuslicher Charakter der Räumlichkeiten gewährleistet werden. Es sind Unterkunftsmöglichkeiten für Angehörige zu schaffen. Die Kinder sollen in Einzelzimmern mit Spielraum für eigene Ausgestaltung untergebracht werden. Es wird ein Abschiedsraum ohne religiöse und weltanschauliche Festlegungen benötigt. Das Personal soll eine medizinische, pflegerische und pädagogische Ausbildung haben. Es sollen Möglichkeiten der Supervision und Weiterbildung ausgeschöpft werden. Ehrenamtliche Mitarbeiter sollen voll einbezogen, aber ständig angeleitet werden.
Was ist der häusliche Kinderhospizdienst?
Kinderhospize sind Station sowohl auf dem Lebensweg als auch am Lebensende. Die Familien benötigen pädagogische, psychologische und sozialarbeiterische Begleitung. Das Kinderhospiz verschafft den Familien eine Atempause, die sie zu Hause kaum haben. Es ist ein "zweites Zuhause", in das man gehen kann, wenn im "ersten" nichts mehr geht. Die kranken Kinder können mit anderen kranken Kindern in Kontakt treten. Für Geschwister ist es wichtig, andere Geschwister in der gleichen Situation zu treffen. Ziel der häuslichen Kinderhospize ist es, die große Hilflosigkeit abzubauen, das Umfeld der Kinder und Familien zu stärken, das sterbende Kind zu begleiten, die Angehörigen zu entlasten und zu unterstützen.
- Quote paper
- Thomas Schrowe (Author), 2005, Kinderhospize - Nur eine weitere Institutionalisierung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109322