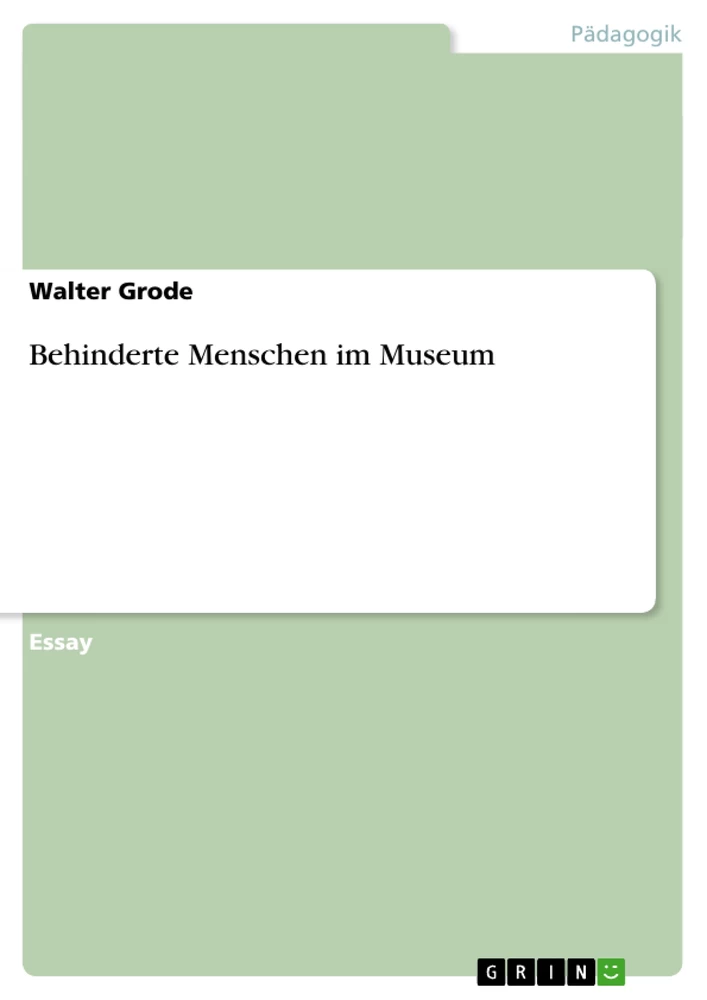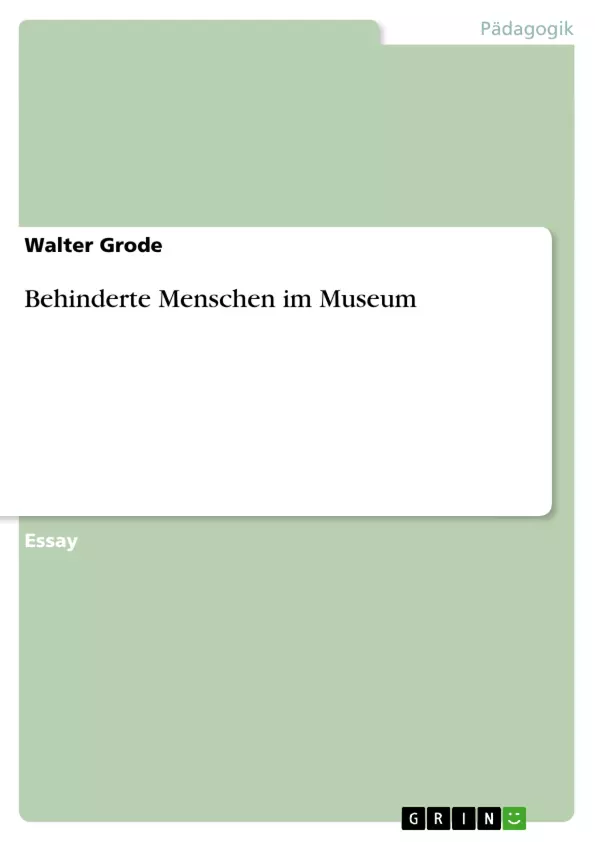Walter Grode
BEHINDERTE MENSCHEN IM MUSEUM
Erschienen (ohne Lit.) am 17.09.02 in den >kobinet-nachrichten<
Kürzlich las ich einen Aufsatz des Hallenser Behindertenpädagogen Andreas Hinmit dem Titel >Behinderte Menschen im Museum - (k)eine Selbstverständlichkeit< (Hinz 2002). Der Autor befaßt sich darin u.a. mit der Frage, welche Aspekte für eine Erhöhung der Integrationsfähigkeit von Museen wichtig wären, die er in drei Punkten zusammenfasst: 1. Barrieren überwinden - allgemeine Zugänglichkeit schaffen; 2. Wahrnehmungsmöglichkeiten bieten - individuelle Zugangsmöglichkeiten schaffen, 3. Darstellung von Menschen - unbedingte Zugehörigkeit schaffen
An diesen drei Maßstäben misst er sodann, die in den Medien so hoch gepriesene letztjährige Ausstellung: Der (im)perfekte Mensch im Hygienemuseum Dresden. Wobei Andreas Hinz allenfalls mit der (allgemeinen) Zugänglichkeit zufrieden war. Denn der unterschwellig mitvermittelte, von ihm so genannte heimliche Lehrplan der Ausstellung, war das genaue Gegenteil seines angestrebten dritten Hauptziels: Die Ausstellung sabotierte geradezu das Ziel der unbedingten Zugehörigkeit, wenn es um die Darstellung behinderter Menschen geht. Ein Eindruck, den übrigens auch fast alle Betroffenen hatten, mit denen ich im vergangenen Jahr über den Dresdner Event sprach (Grode 2001).
Andreas Hinz´ sympatische Konsequenz ist, dass er im Schlussteil seiner Studie scheinbar völlig unwissenschaftlich seinen Traum von einem Puppenmuseum entwirft, in dem nicht etwa behinderte Sonderpuppen ausgestellt werden, sondern in dem einfach nur viele und vielfältige Puppen zu sehen sind, auch anzufassen, zu bespielen.
Andreas Hinz´ träumerische Gedanken scheinen nicht unbedingt für Menschen aus dem autonomen Umfeld von >Selbstbestimmt Leben< geeignet. Und sie sind auch gar nicht für sie konzipiert. Leicht aber läßt sich aus diesem Traum eine übergeordnete Frage herauslesen, auch wenn sie nicht ausdrücklich ausgesprochen wird. Und die heisst: «Wie schaffe ich menschliche Nähe?»
Und speziell hier sollten meiner Meinung nach für Museen andere Maßstäbe gelten als sonst im öffentlichen Raum. Während beispielsweise Arbeitsplätze oder Supermärkte in jedem Fall barrierefrei zu sein haben, damit im Stress des Alltags ein Minimum an Gleichheit hergestellt wird - gilt dies für den Museumssektor, so absolut betrachtet nicht. Forderungen nach Barrierefreiheit lassen sich natürlich berechtigterweise auch an einen Museumsbesuch stellen. Wie unangenehm ist es doch bei der Eröffnung einer Ausstellung jemanden, der ganz offensichtlich nur gekommen ist, um gesehen zu werden, darum zu bitten, sein Sektglas beiseite zu stellen, um mir zwei Stufen hinaufzuhelfen. Und noch schlimmer ist es, wenn ich endlich als Gleicher unter Gleichen in ein überfülltes Ausstellungs-Event eintauchen möchte, das mit jedem Rockkonzert konkurrieren könnte. Barrierefreiheit ist aber auch gefordert, wenn es im umgekehrten Fall darum geht, Besinnung und Alleinsein zu finden. Unter diesem Aspekt sollten wir auch die problematische Forderung nach der totaler Barrierefreiheit für das Berliner Holocaust-Mahnmal betrachten.
Zwischen Event- und Gedenkstättenkultur aber liegt noch eine weite, und ich möchte sagen, die eigentliche Museumslandschaft, die von der Kunsthalle bis zum Museumsdorf reicht. Bei allen Museumsbesuchen aber, stellt sich die Frage: möchte ich bei mir oder möchte ich lieber außer mir sein. Eine Frage, die jeder für sich selbst entscheiden muß und kann und die keinesegs etwas mit der vermeintlichen Höhe der Kultur zu tun hat. Wenn überhaupt, so ist der äußere oder innere Erlebniswert, meiner Erfahrung nach, (überraschenderweise) weniger eine Frage der Institution, die man besucht, sondernvielmehr eine Frage des Zeitpunkts. Es ist nämlich durchaus möglich, die gleiche Ausstellung, völlig unterschiedlich wahrzunehmen, je nachdem, ob Nähe oder Distanz möglich oder erwünscht war.
Wenn aber im Museum mehr als nur räumliche Nähe zugelassen werden soll. So sollten wir bedenken, dass totale, wohlgemerkt totale Barrierefreiheit zwar alles Trennende beseitigt, aber längst noch keine menschliche Nähe schafft. Wären, sagen wir einmal fünf Prozent aller Exponate für Behinderte nur mit fremder Hilfe zugänglich, so böten diese Barrieren einen ersten Kommunikationsanlaß, der sonst nicht bestünde und auch nicht so leicht zu schaffen wäre. Ich betone: einen ersten Anlaß - einen Türöffner sozusagen Denn der zwischenmenschliche Kontakt stellt sich ohne Frage schneller über die konkret vorhandenen Stufen (und die spontane Hilfe) als über den abstrakten Diskurs z.B. über die Konzeption des Künstlers oder des Austellungsleiters her.
Und so wie die Höflichkeit der Platzhalter für wirkliche Tugenden, wie Toleranz und Freundlichkeit ist (Compte-Sponville 1996), so könnte eine begrenzte und gezielt belassene (und ggf. umfahrbare) Zahl von Stufen, im Museum der emotionale Türöffner für wirkliche Nähe sein. Und so entstünde aus einem Lächeln oder einem hilfesuchenden Grinsen, eine flüchtige Begegnung, aus der, vor allem auch für die (scheinbaren) Helfer die Möglichkeit erwächst, von ihren eigenen Ängsten, Wünschen und Hoffnungen zu sprechen.
LITERATUR
Compte-Sponville, Andre (1996): Ermutigung zum unzeitgemäßen Leben. Ein kleines Bevier der Tugenden und Werte, Hamburg
Hinz, Andreas (2002): Behinderte Menschen im Museum - (k)eine Selbstverständlichkeit. In: >Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft<, Heft 2-3
Häufig gestellte Fragen zu "Behinderte Menschen im Museum"
Worum geht es in dem Artikel "Behinderte Menschen im Museum"?
Der Artikel, geschrieben von Walter Grode, diskutiert die Integration behinderter Menschen in Museen. Er bezieht sich auf einen Aufsatz von Andreas Hinz und kritisiert die Ausstellung "Der (im)perfekte Mensch" im Hygienemuseum Dresden, indem er argumentiert, dass diese Ausstellung nicht zur unbedingten Zugehörigkeit behinderter Menschen beiträgt.
Welche drei Aspekte sind laut Andreas Hinz für die Integration in Museen wichtig?
Laut Andreas Hinz sind folgende Aspekte wichtig: 1. Barrieren überwinden - allgemeine Zugänglichkeit schaffen; 2. Wahrnehmungsmöglichkeiten bieten - individuelle Zugangsmöglichkeiten schaffen; 3. Darstellung von Menschen - unbedingte Zugehörigkeit schaffen.
Was kritisiert der Autor an der Ausstellung "Der (im)perfekte Mensch"?
Der Autor kritisiert, dass die Ausstellung, trotz allgemeiner Zugänglichkeit, durch ihren "heimlichen Lehrplan" das Ziel der unbedingten Zugehörigkeit behinderter Menschen untergräbt.
Welchen Traum entwirft Andreas Hinz am Ende seiner Studie?
Andreas Hinz entwirft den Traum von einem Puppenmuseum, in dem vielfältige Puppen ausgestellt sind, die auch angefasst und bespielt werden können, ohne dass behinderte Sonderpuppen im Mittelpunkt stehen.
Welche übergeordnete Frage leitet sich aus Hinz' Traum ab?
Die übergeordnete Frage ist: "Wie schaffe ich menschliche Nähe?"
Welche Maßstäbe sollten laut dem Autor für Museen gelten im Vergleich zum öffentlichen Raum?
Der Autor argumentiert, dass für Museen andere Maßstäbe gelten sollten als im öffentlichen Raum. Während im Alltag Barrierefreiheit ein Minimum an Gleichheit herstellen soll, ist dies im Museumsbereich nicht absolut notwendig. Er schlägt vor, dass bewusst belassene, begrenzte Barrieren Kommunikationsanlässe schaffen können.
Warum könnte eine begrenzte Anzahl von Stufen im Museum als Türöffner für Nähe dienen?
Der Autor argumentiert, dass diese Barrieren eine Gelegenheit für zwischenmenschlichen Kontakt und spontane Hilfe bieten, die schneller zu Nähe führen können als abstrakte Diskurse.
Welche Literatur wird im Artikel erwähnt?
Im Artikel werden folgende Werke erwähnt: Compte-Sponville, Andre (1996): Ermutigung zum unzeitgemäßen Leben. Ein kleines Bevier der Tugenden und Werte, Hamburg; Hinz, Andreas (2002): Behinderte Menschen im Museum - (k)eine Selbstverständlichkeit. In: >Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft<, Heft 2-3; Grode, Walter (2001): >Der Club der Vollkommenen<. Genetische Makellosigkeit könnte ein Privileg der Reichen und Mächtigen werden, in >zeitzeichen<, Heft 6.
- Arbeit zitieren
- Dr. phil. Walter Grode (Autor:in), 2002, Behinderte Menschen im Museum, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109375