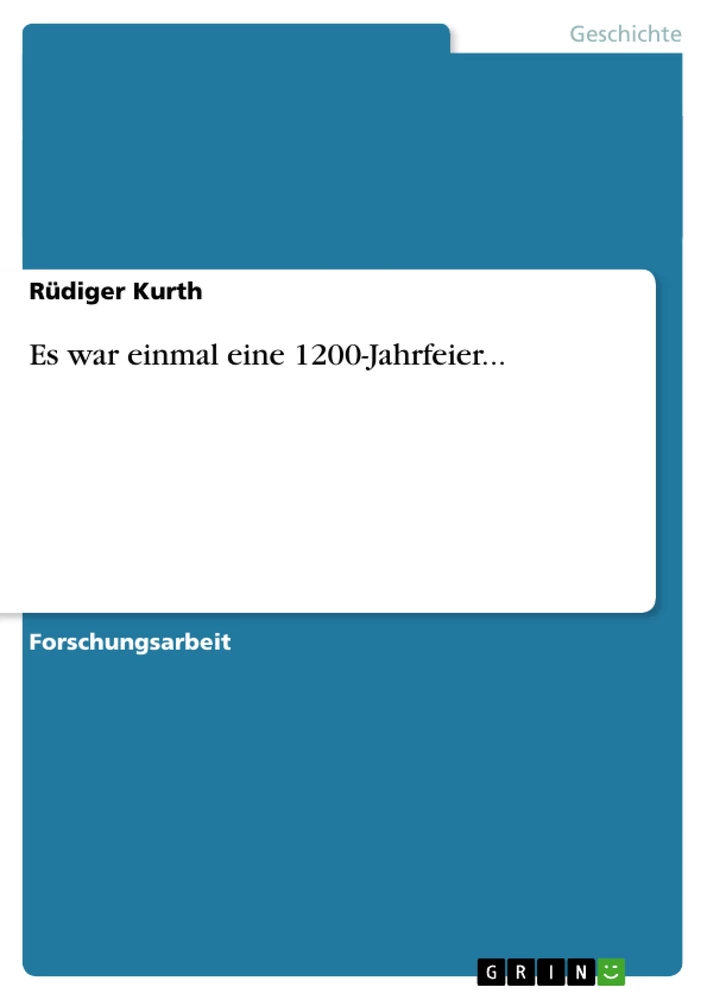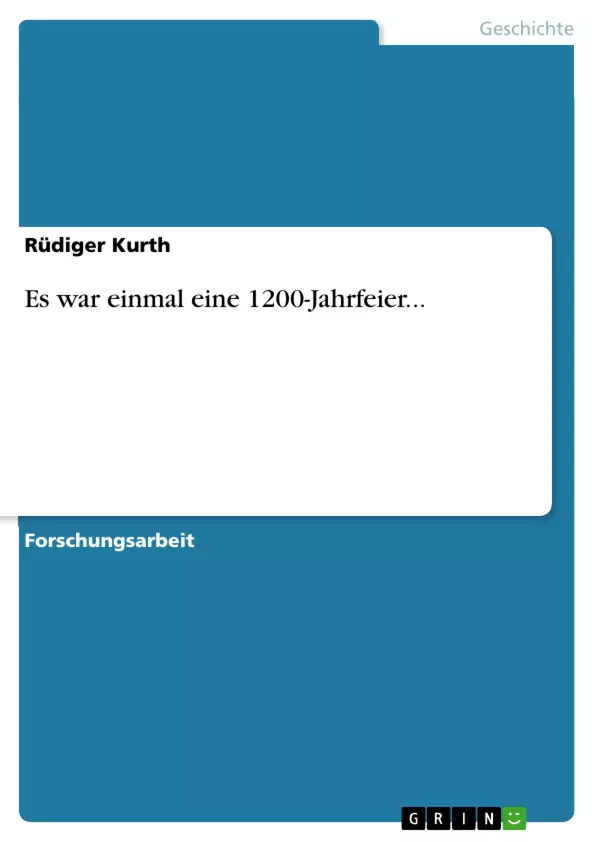Die Arbeit befasst sich kritisch mit den Quellen, auf Grund von deren Angaben die Stadt Bad Homburg 1982 das 1200. Jubiläum ihrer Ersterwähnung feierte. Sie führt auch einige weitere Fakten an, die gegen die traditionelle Überlieferung sprechen. Im Endeffekt führten diese Argumente dazu, dass die Stadt eine archäologische Grabung durchführen ließ, die diese Zweifel bestätigten und vermuten lassen, dass Bad Homburg nur etwa 800 Jahre alt ist.
Es war einmal eine 1200-Jahrfeier...
Bad Homburgs traditionelle Geschichtsschreibung beginnt mit einem historischen Irrtum: nämlich mit der Annahme, dass das "Bachuferdorf"[1] Dietigheim im Tal unterhalb des Bad Homburger Schlosses die "villa Tidenheim" des Lorscher Codex sein müsse. Diese irrtümliche Ansicht war die Grundlage für die 1200-Jahrfeier der Stadt im Jahre 1982, da "Dietigheim " als die Keimzelle von Bad Homburg angesehen wurde.
Was die Quellen im Lorscher Codex sagen - oder auch nicht
Bei dem Codex handelt es sich um Abschriften von knapp 4000 Urkunden, die im späten 12. Jahrhundert im Kloster Lorsch von Mönchen angefertigt wurden. In diesen Urkundenabschriften finden sich insgesamt vier Hinweise auf Dietigheim.
Als Ersterwähnung wird die Schenkung eines gewissen Scerphuin angesehen. Am 20. März 782 übergab er dem Kloster Lorsch in der "villa Tidenheim" 10 Morgen Land und ein Drittel der Kirche. Quellenkritisch sei hier gleich angemerkt, dass dieser Passus einen deutlichen Fehler enthält: Der in der Schenkung genannte Abt Gundeland war zum angegebenen Zeitpunkt bereits einige Jahre tot.
Auch die Schenkung der Hildegard vom 4.4.782 (also etwa 2 Wochen später) erwähnt einen Ort Ditincheim, aber der Wortlaut des Textes legt nahe, dass er sich bei Eschborn befunden hat.
In das Jahr 1013 ist eine Tauschurkunde des Königs Heinrich II. mit der Erwähnung einer "villa Tittingesheim" im "Nitigowe" datiert. Mit "Nitigowe" (der korrekter Weise eigentlich "Nitachgowe" geschrieben worden sein müsste) ist der Niddagau gemeint, auf den auch die Scerphuin- und die Hildegard-Quelle hinweisen. Die Tauschurkunde ist allerdings mehr als 200 Jahre jünger und daher bezüglich der Datierung wie auch der Lokalisierung des karolingischen Dietigheim von untergeordneter Bedeutung.
Undatiert, aber traditionell der Regierungszeit Karls des Großen (768-814) zugeordnet ist schließlich eine Hubenliste. Sie zählt Abgaben auf, die das Kloster Lorsch aus verschiedenen Orten im Niddagau erhielt, ist im Codex jedoch offensichtlich falsch eingeordnet, nämlich am Ende der Aufzeichnungen über den Wormsgau. Dietigheim erscheint hier im selben Schriftzug gleich zweimal in abweichender Schreibweise: einmal als Titincheim und einmal als Tintingheim. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso der Mönch, der die Abschrift erstellte, diese unterschiedlichen Ortsnamen festhielt, ob er also falsch abschrieb, zwei Orte zusammenfasste oder was auch immer.
Auch die Einordnung in die Zeit Karls des Großen ist eine Hypothese, denn Hubenlisten sind sozusagen nur eine Visitenkarte, auf der lediglich angegeben wurde, was das Kloster einstmals irgendwo irgendwie als Abgabe erhalten hatte. Die Festlegung, dass dem Kloster von dort ein Huhn und zwölf Eier zustanden, ist lediglich ein Hinweis darauf, dass sie vor der Umwandlung von dinglichen Abgaben in Geld stattgefunden hatte, also vor dem 12./13.Jahrhundert.
Schlampige Arbeit?
Kein Zweifel - die Mönche, die diese Urkundenabschriften anfertigten, haben nicht sonderlich sorgfältig gearbeitet. Sie verkürzten Urkunden, schrieben falsch ab, ordneten falsch zu und verwechselten Fakten, so dass "man oft berechtigte Zweifel daran haben kann, ob die klösterliche Kanzlei in allen Einzelheiten einen wirklich vollständigen Überblick über die tatsächlichen Verhältnisse haben konnte"[2].
Die Mönche schrieben nicht mit einem Auge darauf, was denn die Nachwelt mit ihren Aufzeichnungen anfangen würde. Sie schrieben mehr oder weniger sorgfältig das ab, was ihnen aufgetragen wurde; ihnen zu unterstellen, sie seien einer neutralen, objektiven Darstellung verpflichtet gewesen, ist abwegig. Ihr Ziel war nicht, gerichtsfeste Angaben zu machen, die auch in der Zukunft noch Bestand haben würden. Ob sie dabei bewusst oder unbewusst auch Fakten fälschten, wie es etwa der Mönch Eberhard in seinem ungefähr gleichzeitig geschriebenen Codex für das Kloster Fulda tat, lässt sich nicht nachweisen, da keine der Lorscher Urkunden im Original erhalten geblieben und das vollständige Archiv des Klosters verschwunden ist.
Diese Situation ist der Ausgangspunkt für eine Bewertung der im Codex gemachten Angaben: Da es bis heute keine umfassenderen Schriftzeugnisse gibt, muss das beste daraus gemacht werden. Das darf aber nicht bedeuten, dass die Abschriften des Lorscher Codex nach dem Prinzip "Im Zweifel für den Angeklagten" als Fakten angesehen werden. Historiker neigen ja auf Grund ihrer universitären Ausbildung oft genug dazu, Schriftstücke als überlieferte Wahrheiten aufzufassen, selbst wenn die schriftlichen Darstellungen Anlass zu Zweifeln geben. Es wäre jedoch angemessen, diese Zweifel auch als solche kenntlich zu machen und zu hoffen, dass sich in Zukunft eine Lösung ergeben wird.
Die Frage der Lokalisierung Dietigheims
Dido oder Dieter oder Tido sind im Mittelalter (und nicht nur damals) gängige Vornamen, die in Verbindung mit "-heim" im allgemeinen bäuerliche Siedlungen bezeichneten, ohne dass diese örtlich genauer zu bestimmen gewesen wären - es sei denn, sie würden sich durch besondere Charakteristika auszeichnen. Eine simple Namensgleichheit reicht jedenfalls nicht zu einer Lokalisierung des betreffenden Ortes aus. So kann aus der Tatsache, dass sich heute in der Rückschau nur ein "Dietigheim" im ehemaligen Niddagau nachweisen lässt - und zwar dasjenige mit dem Bezug zu Bad Homburg -, nicht gefolgert werden, dass es mit dem im Lorscher Codex genannten Ort identisch ist. Genau das ist ja der historische Irrtum, der zu der 1200-Jahrfeier der Stadt geführt hat!
Auch die Annahme, dass es sich bei dem im Lorscher Codex in verschiedenen Schreibweisen wiedergegebenen Dietigheim um jeweils den selben Ort handelt, bedarf der Belegung durch Tatsachen. Einige Forscher gehen ganz im Gegenteil davon aus, dass das karolingische Dietigheim eine "Wüstung bei Eschborn" sei[3], also dort nur eine vorübergehende Existenz gehabt habe. Das würde natürlich bedeuten, dass es auch nicht das wiederholt im Eppsteinschen Lehensverzeichnis - das aus der Mitte des 13.Jahrhunderts stammt - genannte Didenchheim ist.
Unabhängig von der schriftlichen Überlieferung haben die Ergebnisse der von Professor Henning von der Universität Frankfurt durchgeführten Grabung in der Altstadt Bad Homburgs gezeigt, dass es zwischen der Zeitenwende und dem 13./14. Jahrhundert nach Christus keinerlei Hinweise auf eine Ansiedlung im Tal unterhalb der Burg gibt, in diesem Bereich demnach ein karolingisches Dietigheim nicht nachgewiesen werden kann. Das ist das wichtigste Faktum für die Stadtgeschichte, denn damit entfällt endgültig die Grundlage für die 1200-Jahrfeier.
Zusammenfassend lässt sich also sagen: Einen konkreten Nachweis über ein eindeutig zuordnungsfähiges, historisch genau datierbares und lokalisierbares Dietigheim in der Karolingerzeit gibt es nicht. Im Gegenteil zerfasern die Angaben über den Ort immer mehr, je genauer man sie analysiert.
Der Lehensrevers von 1467
Unzweifelhaft ist aber, dass der Lehensrevers vom 20. Juli 1467 (der also etliche Jahrhunderte jünger ist als die Angaben im Lorscher Codex) genaue Aussagen zu einem Dietigheim bei Bad Homburg enthält. Die Urkunde erwähnt verschiedene, alle im heutigen Stadtbereich gelegene Güter, mit denen Jorge Brendel von Homburg und seine Brüder von Gottfried Herr von Eppenstein und Münzenberg belehnt werden. Die Belehnung wird mit der Urkunde vom Montag nach Alexius (d.h. am 20. Juli, wenn die zeitliche Übertragung zutreffend ist) im Jahre 1467 besiegelt. Die Güter werden dabei möglichst genau beschrieben, ganz offensichtlich um möglichen späteren Streit zu vermeiden, da das Lehensverhältnis ja auch für die Erben der Vertragspartner gelten soll.
Interessant ist dabei die Ortsangabe für das in der Vorburg gelegene Haus, "der Clemme" genannt. Es steht nämlich bei der Kirche, und damit ist klar, dass diese Kirche in der Vorburg nicht die Kirche sein kann, die Scerphuin 782 teilweise dem Kloster Lorsch schenkte, denn die lag ja in "villa Tidenheim". Diese "villa Tidenheim" wiederum, mit Dietigheim gleichgesetzt, erscheint aber ebenfalls in dem Lehensrevers, und zwar in der Schreibweise "Dydeckheim": "Der Hof zu Dydeckheim und der Graben mit seinem Begriff", d. h. der Hof und das, was durch den dazu gehörigen Graben umfangen und einbezogen ist. Eine Kirche wird hier allerdings nicht erwähnt, was als Hinweis, aber nicht als Beweis angesehen werden kann, dass Scerphuins Schenkung eben nicht auf dieses Dietigheim bezogen war - eine Kirche wäre ein viel zu wichtiges Bauwerk, als dass sie einfach unerwähnt bliebe.
Außerdem ist die Lage des Grabens bekannt: 1990 hat ihn Erhard Großblotekamp, Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes, bei Arbeiten am Untertor wieder entdeckt und vermessen. Er ist in Umrissen auch auf der im Auftrage des damaligen Landgrafen im Jahre 1787 hergestellten Karte von Bad Homburg - dem sogenannten Bruch'schen Plan - verzeichnet, und heute erinnert eine kleine Straße "Am Stadtgraben" in der Nähe des Untertors an ihn. Dieser Graben lief um die Talsiedlung herum und war in etwa der "Alten Mauergasse" und der Straße "Hinter den Rahmen" vorgelagert. Seine Erwähnung in der Urkunde zeigt, dass es sich nicht um irgendeinen Graben handelte, sondern um ein allgemein bekanntes, als Markierung nützliches lokales Merkmal.
Dietigheim und die Burgsiedlung
Es ist von offensichtlichem Interesse für die Stadtgeschichte, festzustellen, wie Dietigheim in das Tal unterhalb der Burg kam. Die Stadtmauer, die beide trennt, und vor allem die beiden Türme am Rande des Bergrückens - der Rathausturm und der Stumpfe Turm - zeigen, dass dort oben zu diesem Zeitpunkt bereits eine feste Burgsiedlung bestand. Die Verteidigungsanlagen wurden sicherlich errichtet, als das Schussfeld davor noch frei und unverbaut war und nicht erst, als das Tal bereits besiedelt war, denn welchen Sinn sollten sie machen, wenn von ihnen eher die eigenen Leute als der Feind bedroht wurden? Dies ist ein Indiz dafür, dass die Talsiedlung erst später entstanden ist als die Burgsiedlung; es sagt aber nichts darüber aus, wie alt die Stadt denn nun wirklich ist.
Und das Alter der Stadt?
Wenn Dietigheim nicht die Keimzelle der Stadt Bad Homburg ist, ja wenn das karolingische Dietigheim des Lorscher Codex nicht im Tal gelegen haben kann und vielleicht überhaupt nicht lokalisierbar ist, was bleibt dann, um wenigstens eine ungefähre Ahnung davon zu haben, wann die Stadt denn entstanden ist?
Zunächst wieder eine von Mönchen verfasste Auflistung der Güter eines Klosters, in diesem Fall der Abtei Eberbach, mit der Bezeichnung "Oculus memoriae", die vor 1211 zusammengestellt wurde. Darin findet sich die Abschrift einer undatierten Verzichtserklärung, die vor verschiedenen Zeugen stattfand. Einer dieser Zeugen ist ein gewisser Ortwin von Hohenberch, und dieser Name ist äußerst bedeutungsvoll für die Stadtgeschichte, denn bei ihm handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um den Erbauer der Burg. Dank des illustren Kreises der Zeugen, die historisch greifbar sind und zeitlich eingeordnet werden können, ist es möglich, dieses Schriftzeugnis in den Zeitraum um 1180 einzustufen. Zu diesem Zeitpunkt hat die Burg also bereits bestanden, wahrscheinlich auch schon vor 1171[4].
Ob diese Überlieferung zutreffend ist, bedarf der Nachprüfung durch archäologische Befunde im Bereich der Burgsiedlung; zu oft haben sich die schriftlichen Belege als unsicher erwiesen. Die Ausgrabungen werden (hoffentlich) den konkreten Beweis erbringen, ob - und wann - die Homburger Geschichte auf dem Bergrücken begann.
[...]
[1] Friedrich Lotz, Geschichte der Stadt Bad Homburg vor der Höhe, Band I, Frankfurt 1964, S.22
[2] Hemann Schefers, Das Gedächtnis der Abtei, in: Weltkulturerbe Kloster Lorsch: das Mittelalter erwacht / Staatliche Schlösser und Gärten Hessen, Regensburg 2003, S.38
[3] siehe Ernst Förstemann, Altdeutsches Namensbuch, Nachdruck 1967, Band 2, 1.Teil, Spalte 704. Er steht hier in der Tradition von C.D.Vogel (Beschreibung des Herzogthums Nassau, Wiesbaden 1843, S. 866f) und J. Kehrein (Nassauisches Namensbuch, Bonn 1872, Neudruck 1970, S.278)
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text "Es war einmal eine 1200-Jahrfeier..."?
Der Text kritisiert die traditionelle Geschichtsschreibung von Bad Homburg, die auf der irrtümlichen Annahme basiert, dass das Dorf Dietigheim die "villa Tidenheim" des Lorscher Codex ist. Diese Annahme diente als Grundlage für die 1200-Jahrfeier der Stadt im Jahr 1982.
Was sind die wichtigsten Kritikpunkte an der traditionellen Geschichtsschreibung?
Die Kritikpunkte umfassen Fehler in den Abschriften des Lorscher Codex, die ungenaue Datierung und Lokalisierung von Dietigheim, sowie die fehlende archäologische Bestätigung einer Siedlung im Tal unterhalb der Burg vor dem 13./14. Jahrhundert.
Was sagt der Lorscher Codex über Dietigheim?
Der Codex enthält vier Hinweise auf Dietigheim, einschließlich einer Schenkung im Jahr 782. Es gibt jedoch Zweifel an der Genauigkeit und Zuverlässigkeit dieser Angaben, da die Abschriften Fehler enthalten und die Lokalisierung des Ortes unklar ist.
Welche Rolle spielt der Lehensrevers von 1467?
Der Lehensrevers von 1467 enthält detaillierte Aussagen über ein Dietigheim bei Bad Homburg. Er erwähnt einen Hof und einen Graben, aber keine Kirche, was die Frage aufwirft, ob dies derselbe Ort wie der im Lorscher Codex genannte ist.
Wie alt ist die Stadt Bad Homburg wirklich?
Da Dietigheim nicht als Keimzelle der Stadt angesehen werden kann, muss das Alter der Stadt anders bestimmt werden. Ein Hinweis ist die Erwähnung eines Ortwin von Hohenberch um 1180, der wahrscheinlich der Erbauer der Burg war.
Was sagt die Archäologie über die Geschichte von Bad Homburg?
Ausgrabungen in der Altstadt haben bisher keine Hinweise auf eine Ansiedlung im Tal unterhalb der Burg vor dem 13./14. Jahrhundert ergeben. Dies untergräbt die Grundlage für die 1200-Jahrfeier.
Was ist die Bedeutung des "Bruch'schen Plans"?
Der Bruch'sche Plan, eine Karte von Bad Homburg aus dem Jahr 1787, verzeichnet den Graben um die Talsiedlung, der auch im Lehensrevers von 1467 erwähnt wird.
Was sind die Konsequenzen aus der Kritik an der traditionellen Geschichtsschreibung?
Die Konsequenzen sind, dass die Angaben über Dietigheim immer mehr zerfasern, je genauer man sie analysiert, und dass die Stadtgeschichte möglicherweise neu geschrieben werden muss.
- Quote paper
- Rüdiger Kurth (Author), 2004, Es war einmal eine 1200-Jahrfeier..., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109408