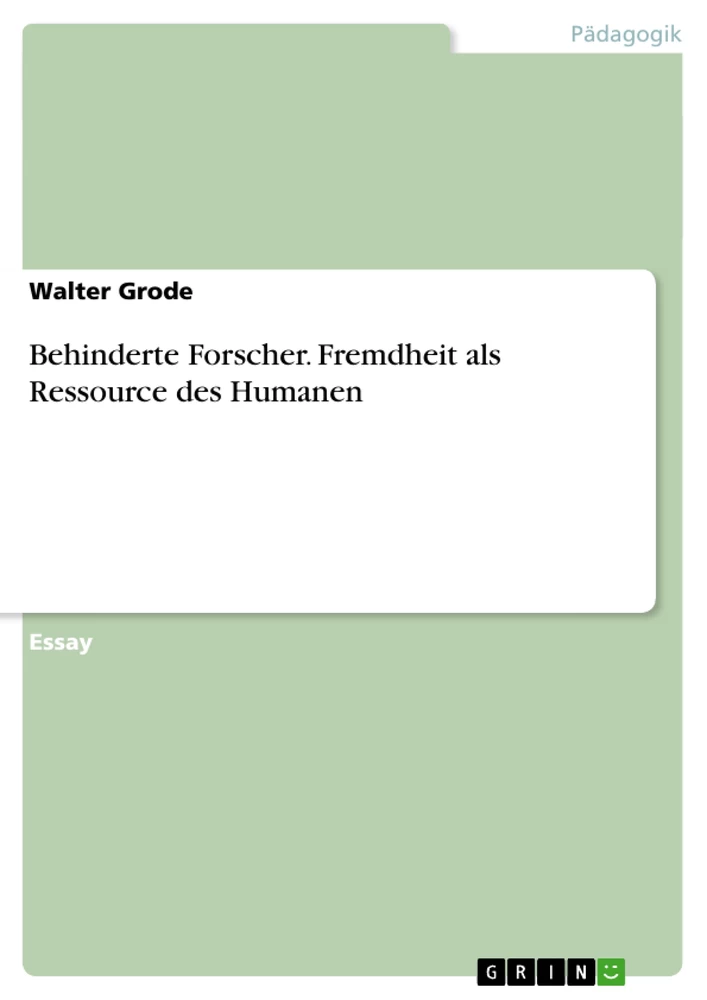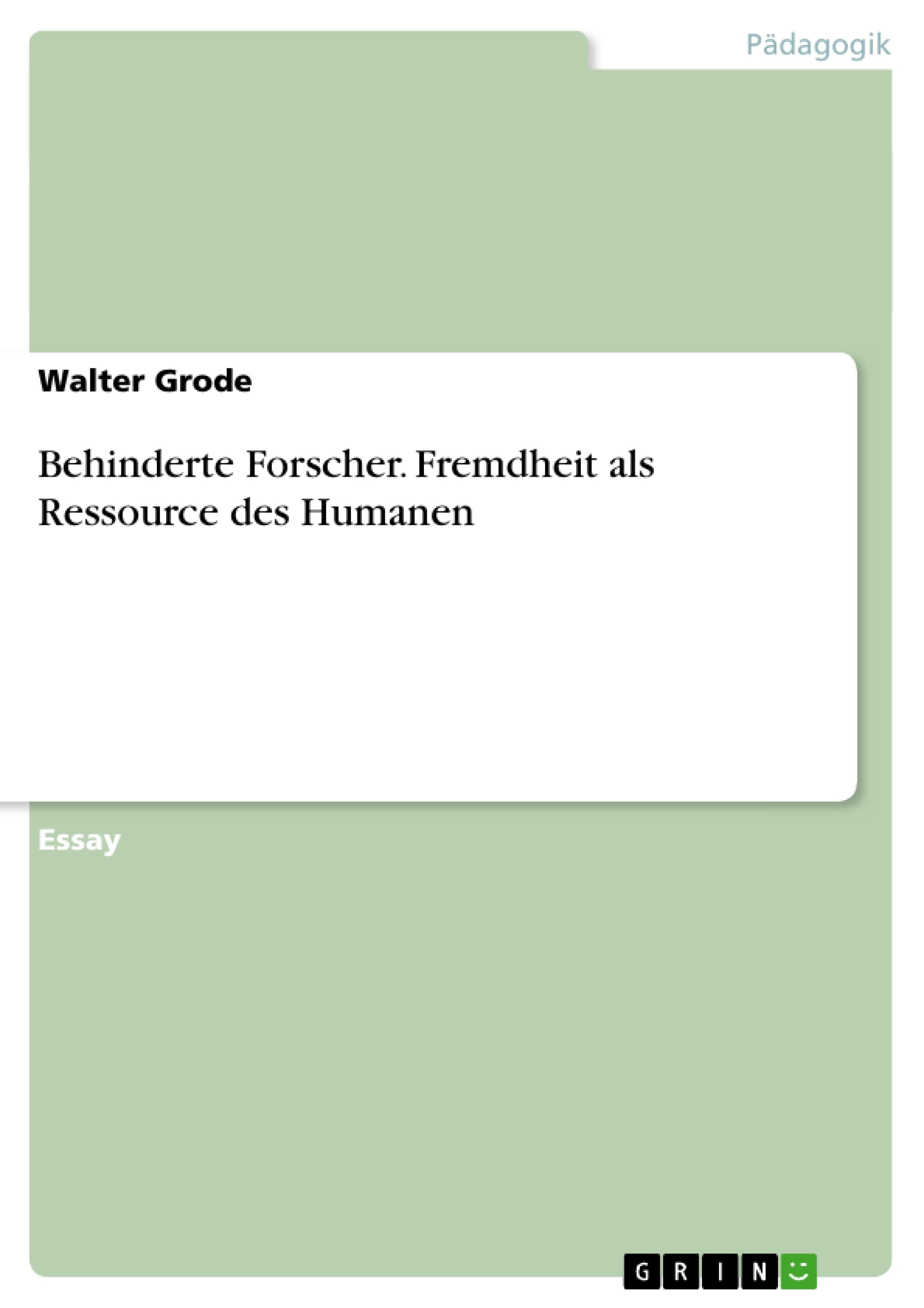Walter Grode
BEHINDERTE FORSCHER
Fremdheit als Ressource des Humanen
In: ders.: Aufsätze und Essays, Rezensionen und Kommentare, Hannover 2003
Die Erschwernisse denen sich behinderte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tagtäglich gegenübersehen, sind offensichtlich. Gleichfalls auch die Einpassungs- und Normalisierungspraxen deren sie sich selbst unterwerfen (müssen), um überhaupt Aufmerksamkeit, geschweige denn Anerkennung zu finden. Diese Restriktionen sind aber gesamtgesellschaftlich gesehen keineswegs außergewöhnlich. Auch wenn ich gern einräumen will, daß meine folgenden Erfahrungen im Umgang mit einem beschädigten Leben keineswegs repräsentativ sind
Im Vergleich zu allen Einpassungs- und Selbstnormalisierungspraxen vor Eintritt meiner Behinderung, erscheinen mir nämlich alle Erfahrungen, die ich als behinderter Wissenschaftler und Publizist im Rollstuhl machte, geradezu wie eine riesige Entwicklungschance.
Der sog. "Zweite Bildungsweg", der vor Eintritt der sozialdemokratischen Reformen Anfang der 70er Jahre (des vergangenen Jahrhunderts), noch ein rigides soziales Ausleseinstrument war, ermöglichte mir den Aufstieg aus kleinsten sozialen Verhältnissen zum Ingenieur und Offizier. (Grode 1998). All das schaffte ich in vorbildlich kürzer Zeit - also genau so, wie es auch heute wieder vom Zeitgeist, der ja bekanntlich >stets der Herren eigener Geist< ist, gefordert wird.
Im Vergleich zu dieser >Ochsentour< war bereits mein Berufspädagogik-Studium, das mitten in die Anfangsjahre der nunmehr institutionalisierten Bildungsreform fiel, geradezu ein Ausdruck von >akademischer Freiheit und Abenteuer<. Als ich dann Anfang der 80er Jahre im Rollstuhl nochmals ein weiteres Studium begann, waren die Illusionen über den Versuch via Hochschule und Pädagogik die Gesellschaft verändern zu können zwar bereits verflogen - ich traf (und treffe auch heute noch) aber immer wieder Menschen, die grundsätzlich an die Veränderbarkeit der Verhältnisse glauben, und deshalb ihr Leben an der Brechtschen Maxime auszurichten versuchen: >Der Mensch soll des anderen Helfer sein<
Ob dieser Maxime eine Chance gegeben wird, hängt nach meiner Überzeugung, nicht zuletzt auch von denjenigen ab, die der Hilfe bedürftig sind. Gesellschaftliche Fremdheit und Bedürftigkeit (z.B. die von alten Menschen und Behinderten), ist in Wirklichkeit ein Ferment, das etwas (ganz) anderes erst hervorbringt: im Schlechten, wie im Guten
Über all das Negative, das die Konfrontation mit dem Fremden individuell und gesellschaftlich hervorbringen kann, brauche ich an dieser Stelle kaum ein Wort zu verlieren: Nicht umsonst ist die Faschismusforschung mein Lebensthema geworden. (Grode 1994)
Kommen wir also gleich zur positiven Seite: Behinderung konfrontiert jeden Menschen mit seiner eigenen Fremdheit. Das geschieht nicht nur in den (Un-)Tiefen der eigenen Biographie und in den Ebenen des Alltags, sondern auch auf den Höhen der Wissenschaft und ihres Betriebs. Aber gerade dort bin ich immer wieder Menschen begegnet, die sich nicht nur ihrer eigenen Fremdheit bewußt waren, sondern gerade daraus ihre Stärke schöpften
Drei für mich prägende Beispiele möchte ich besonders hervorheben: Zum einen meine marxistische Studentengruppe während des Politikwissenschaftsstudiums an der Universität Hannover. (Grode 2002) Hier war ich ein >stinknormaler Exot< unter vielen anderen Fremdlingen jeder Art, die (vordergründig) nach einer politischen Heimat suchten. >Kommt in Massen!< stand deshalb auch auf meinem Flugblatt, >an alle Behinderten< zur Verbreiterung unserer politischen Basis, das im Mai 1981 zu einem Austausch über die Studiensituation, die katastrophalen technischen Voraussetzungen und "unsere Berufsperspektive" aufrief.
Doch bereits hier machte ich die Erfahrung, daß es sich beim Umgang mit Behinderung um keine quantitative, sondern um eine qualitative Frage handelt. Der einzige behinderte Mensch der damals auf diesen Aufruf reagierte, war vierzehn Tage später ein Biologe, der heute - so darf ich bekennen - mein bester (TischFußball)Freund ist. Und auch die besagte politische Studentengruppe vom Anfang der 80er Jahre, in der einst, vielleicht gerade wegen ihrer dogmatischen Enge, ein Klima des Wohlwollens und der Anerkennung herrschte, bildet noch heute einen wichtigen Kern meines Freundeskreises. .
Das zweite Beispiel ist mein 1937 im französischen Exil geborener Doktorvater Peter Brokmeier. Ich erlebte ihn erstmalig bei einem Vortrag über den Aufstand und die Vernichtung des Warschauer Ghettos. Er hatte, wie sich später herausstellte, 1967/68 als Assistent den Frankfurter-Euthanasie-Prozeß mitstenographiert, war aber durch persönliche Umstände und den tragischen Tod seines Mentors gezwungen worden, sein eigenes Projekt fallenzulassen. 1983 stellte Prof. Brokmeier mir sein Archiv zur Verfügung. Und meine Dissertation über die Euthanasie in den NS-Konzentrationslagern wiederum wurde für ihn zur Basis einer Veröffentlichung über die Vernichtung von Geschichte. (Brokmeier 1986)
Und drittens schließlich: meine publizistische Heimat die >Lutherischen Monatshefte<, die sich in ihrem Untertitel dem kirchlichen Dialog mir Kultur, Wissenschaft und Politik verschrieben hatten. Auch hier ließ ich mich instrumentalisieren: als exotischer linker Kontrapunkt nämlich. Dafür aber hatte ich im Gegenzug die Möglichkeit, das >schwarze Loch< in meiner Biographie schreibend zu umkreisen, das in der Erkenntnis besteht, daß ich während des Nationalsozialismus mit (zumindest) der gleichen Wahrscheinlichkeit nicht nur Opfer (der Euthanasie), sondern auch Täter (der Wehrmachtsverbrechen) geworden wäre.
Bis Mitte der 90er Jahre störte übrigens kein einziges Photo den Fluß der Gedanken in den >Lutherischen Monatsheften<. Und auch heute noch sind ihre Nachfolgerinnen absolute Fremdlinge im Meer der Publizistik. Ihre Maxime lautet: "Nicht viel lesen, sondern Gutes lesen, macht klug und gelassen"
Um innere Ruhe zu finden und >glücklich alt zu werden< (Grode 2003) ist die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und seinen Täter-Opfer-Verstrickungen (selbst für Nachgeborene) nicht nur förderlich. (Grode 2002). Auf die realen Opfer aber, scheint das >schwarze Loch< (das ja nicht nur der Nationalsozialismus darstellt) eine geradezu magische Anziehungskraft auszuüben - und mehr noch einen unwiderstehlichen Sog. Zumal, wenn ihre >Fremdheit in der Welt< keine >Ressource des Humanen< aktivieren kann. Erinnert sei hier exemplarisch an das Schicksal des fast vergessenen Autodidakten und ehemaligen Auschwitz-Häftlings Josef Wulf. Und zwar deshalb, weil er derjenige war, für den 1967/68 mein Doktorvater Peter Brokmeier den >Frankfurter Euthanasie-Prozeß< mitstenographiert hatte.
Josef Wulf veröffentlichte zwischen 1955 und 1960 (gemeinsam mit Leon Poliakov) vier große Dokumentationen (Das Dritte Reich und die Juden; Das Dritte Reich und seine Diener; Das Dritte Reich und seine Denker; Das Dritte Reich und seine Vollstrecker), die den Mord an den Juden in den Mittelpunkt rückten und das Verhalten der Deutschen eingehend beleuchteten. Mit der vorweggenommenen Golhagen-These, daß Hitler viele willige Helfer gefunden habe (Grode 1996), widersprach er der vorherrschenden Meinung in der akademischen Zunft. Auch Martin Broszat (Jg. 1927), von 1972 bis zu seinem Tod 1989, der Direktor des renommierten Instituts für Zeitgeschichte, dem heute von einem jungen Historiker (Berg 2003) sein hartnäckiges Schweigen über seine (späte) NSDAP-Mitgliedschaft (Eintrittsdatum: 20. April 1944!) vorgeworfen wird, lehnte die Arbeiten Wulfs als polemisch und "unwissenschaftlich" ab. Er vertrat die Auffassung, daß das Thema der Judenvernichtung nicht Holocaust-Überlebenden überlassen werden dürfe, weil sie nicht objektiv urteilen könnten.
Angesichts des Widerstandes, auf den seine Forschungen stießen, begann Wulf zu resignieren. "Ich habe 18 Bücher über das Dritte Reich veröffentlicht, und alles hatte keine Wirkung. Du kannst Dich bei den Deutschen totdokumentieren, es kann in Bonn die demokratische Regierung sein - und die Massenmörder gehen frei herum, haben ihr Häuschen und züchten Blumen", klagte er im August 1974 einem Freund,. Wenige Wochen später, am 10. Oktober 1974, stürzte sich aus dem 4. Stock seiner Berliner Wohnung in den Tod. (Ullrich 2003)
Literatur
Berg, Nicolas (2003): >Der Holocaust und die westdeutschen Historiker<. Erforschung und Erinnerung, Berlin
Brokmeier, Peter (1986): >Geschichte vernichten<. Reflexionen über den organisierten Massenmord im deutschen Faschismus, in >Düsseldorfer Debatte<, Heft 10
Grode, Walter (1994): >Nationalsozialistische Moderne<. Rassenideologische Modernisierung durch Abtrennung und Zerstörung gesellschaftlicher Peripherien, Frankfurt a.M. www.wissen24.de/vorschau/17424html
Grode, Walter(1996): >Ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust<, in: >Lutherische Monatshefte<, Heft 12 - demnächst bei www.wissen24.de
Grode, Walter (1998): >Mehrwert und Humboldt vertauscht<. Erinnerungen an >1968<, in: >Die Zeichen der Zeit / Lutherische Monatshefte<, Heft 8 - demnächst bei: www.wissen24.de
Grode, Walter (2002) >Ein Verzicht auf die Ausschöpfung der Potentiale der Gentechnologie bedeutet die Akzeptanz von Behinderung, Alter und Schwäche<. Eine biographisch-politische Skizze, in. >Gemeinsam leben<, Heft 2 - demnächst bei www.wissen24.de
Grode , Walter (2003): >Glücklich Altwerden<. Altern zwischen Defekt und Weisheit, in: ders. Aufsätze und Essays, Rezensionen und Kommentare, Hannover www.wissen24.de/vorschau/18617html
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Walter Grodes "Behinderte Forscher"?
In diesem Aufsatz reflektiert Walter Grode über die Erfahrungen behinderter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Er betont, dass die Erschwernisse und Anpassungszwänge, denen sich behinderte Menschen im Wissenschaftsbetrieb ausgesetzt sehen, zwar offensichtlich sind, dass er aber seine eigenen Erfahrungen als behinderter Wissenschaftler und Publizist im Rollstuhl als eine riesige Entwicklungschance erlebt hat. Grode beschreibt seinen eigenen Werdegang, von seinen Anfängen in einfachen sozialen Verhältnissen bis hin zu seinem Studium, und wie er trotz der Illusionen über die Veränderbarkeit der Gesellschaft durch Bildung immer wieder Menschen trifft, die an diese Möglichkeit glauben.
Welche Rolle spielt Fremdheit in Grodes Analyse?
Grode argumentiert, dass gesellschaftliche Fremdheit und Bedürftigkeit, wie sie beispielsweise von alten Menschen und Behinderten erfahren wird, ein Ferment sein kann, das etwas Neues hervorbringt. Behinderung konfrontiert jeden Menschen mit seiner eigenen Fremdheit, sowohl im privaten als auch im wissenschaftlichen Bereich. Er hebt hervor, dass er immer wieder Menschen begegnet ist, die sich ihrer eigenen Fremdheit bewusst waren und daraus ihre Stärke schöpften.
Welche Beispiele nennt Grode zur Veranschaulichung seiner These?
Grode nennt drei prägende Beispiele: seine marxistische Studentengruppe an der Universität Hannover, seinen Doktorvater Peter Brokmeier, und seine publizistische Heimat, die "Lutherischen Monatshefte". In der Studentengruppe erlebte er eine Atmosphäre des Wohlwollens und der Anerkennung. Prof. Brokmeier stellte ihm sein Archiv zur Verfügung, was Grodes Dissertation über die Euthanasie in den NS-Konzentrationslagern ermöglichte. In den "Lutherischen Monatsheften" konnte er sich mit dem Thema Nationalsozialismus und seinen Täter-Opfer-Verstrickungen auseinandersetzen.
Welchen Bezug hat Grode zum Nationalsozialismus?
Grode betont die Bedeutung der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und seinen Täter-Opfer-Verstrickungen, auch für Nachgeborene. Er reflektiert darüber, dass er während des Nationalsozialismus mit (zumindest) der gleichen Wahrscheinlichkeit nicht nur Opfer, sondern auch Täter hätte werden können.
Welche Rolle spielt Josef Wulf in Grodes Argumentation?
Grode erinnert an das Schicksal des fast vergessenen Autodidakten und ehemaligen Auschwitz-Häftlings Josef Wulf. Wulf, der sich intensiv mit dem Holocaust auseinandersetzte und auf Widerstand stieß, resignierte und beging schließlich Selbstmord. Grode nutzt Wulfs Beispiel, um zu verdeutlichen, dass "Fremdheit in der Welt" eine "Ressource des Humanen" sein muss, um nicht zu Resignation und Verzweiflung zu führen.
Welche Literatur zitiert Grode?
Grode zitiert unter anderem Werke von Nicolas Berg, Peter Brokmeier, und sich selbst (Walter Grode). Diese Literatur bezieht sich auf Themen wie den Holocaust, die deutsche Geschichtsschreibung und die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit.
- Arbeit zitieren
- Dr. phil. Walter Grode (Autor:in), 2003, Behinderte Forscher. Fremdheit als Ressource des Humanen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109451