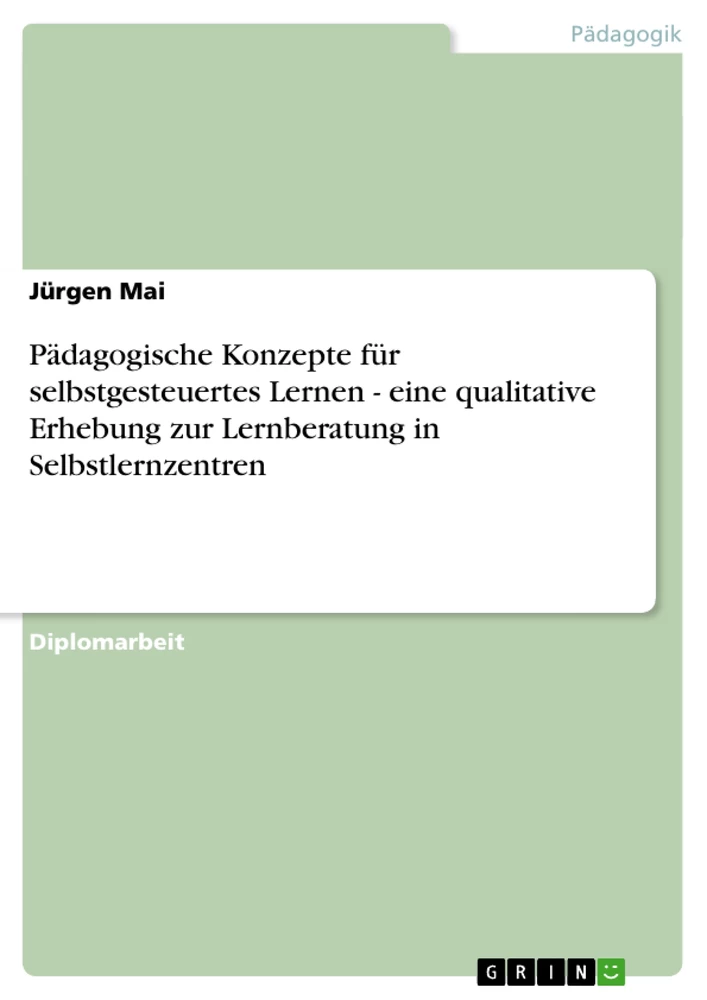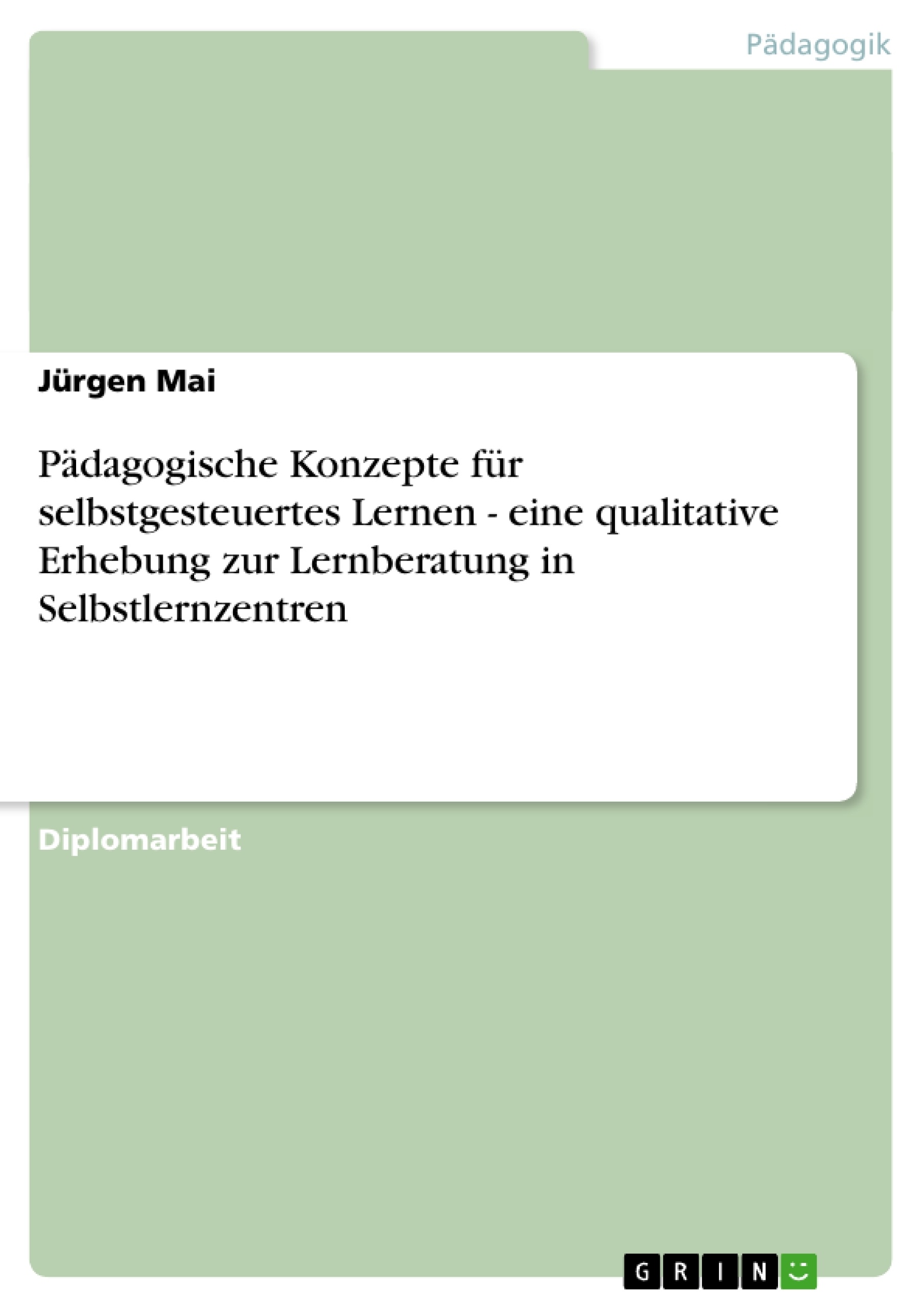Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2.elbstlernzentren – Idee und Geschichte
2.1.elbstlernzentren der 70er Jahre
2.1.1. Gesellschaftlicher Rahmen
2.1.2. Didaktische Konzeption
2.1.3. Rolle der Profession
2.1.4. Erste Erfahrungen
2.1.5. Resümee
2.2.elbstlernzentren Ende der 80er/Anfang der 90er Jahre
2.2.1. Gesellschaftlicher Rahmen. 19 2.2.2. Didaktische Konzeption
2.2.3. Rolle der Profession
2.3. Resümee –elbstlernzentren im Wandel der Zeit
3. Datenerhebung – Feldforschung
3.1. Die Rolle des Forschers und des Vorwissens
3.1.1. Zum Führen eines Forschungstagebuchs
3.2. Teilnehmende Beobachtung
3.2.1. Verortung der eigenen Beobachterrolle
3.2.2. Zumchreiben von Feldprotokollen
3.2.3. Weitere Daten im Rahmen teilnehmender Beobachtung
3.3. Interviews
3.3.1. Verortung des eigenen Vorgehens
3.3.2. Interviewpraxis – Zur Förderung des Gesprächsflusses
3.4. Transit
3.4.1. Das Forschungssetting im Überblick
3.4.2. Der Interviewleitfaden im Überblick
4. Neue Lernkultur und Lernberatung
4.1. Argumentationslinien
4.2. Der Begriff derelbststeuerung
4.3. Wirkungen auf Didaktische Arrangements
4.3.1. Individualisiertes vs. soziales Lernen
4.3.2. Erhöhung metakognitiver Anteile
4.3.3. Lernen mit Neuen Medien
4.3.3.1.ystematisierungen
4.3.3.2. Evaluation von Lernsoftware
4.4. Wirkungen auf Institutionen
4.5. Wirkungen auf die Profession
4.5.1. Konzepte von Lernberatung
4.5.1.1. nach Kemper/Klein
4.5.1.2. QINEB – Qualifizierung durch innovative Erwachsenenbildung
4.5.1.3. Biographieorientierte Ansätze
4.6. Fazit
5. Methodisches zur Datenauswertung
5.1. Inhaltsanalyse
5.2. Kategorien – und Typenbildung
5.3. Interpretationshilfen
5.4. Gütekriterien
6. Falldarstellung
6.1. Makrostrukturelle Rahmungen
6.1.1.tatistische Kennzahlen zu dentädten
6.1.2. Außendarstellung
6.1.3. Chronik, Förderung, Träger, Kooperationen
6.1.4. MitarbeiterInnenstruktur
6.1.5. Öffnungszeiten, Lage, Angebote
6.1.6. Ziel- und Nutzergruppen
6.2. Lernberatung
6.2.1. Zeit
6.2.2. Themen
6.2.2.1. Einführung
6.2.2.2. Prozessbegleitung
6.2.2.3. Metakognitionen
6.2.3. Eingesetzte Materialien
6.2.4.oziale Implementation
6.2.5. Kompetenzen, Tätigkeiten,elbstbilder
6.2.6. Organisationskultur
6.2.7.onstiges: Effekte auf TeilnehmerInnenseite
6.3. Diskussion der Ergebnisse
6.3.1.ystematisierung von Lernberatung
6.3.2. Dieelbstlernzentren im Kategorienraum
6.3.3. Rückbindung an die Diskussion umelbstgesteuertes Lernen
6.3.4. Zwei Idealtypen vonelbstlernzentren
7. Fazit: Zusammenfassung und Ausblick
8. Literaturverzeichnis
9. Abbildungsverzeichnis
10. Erklärung
1. Einleitung
Der erste Satz. Einen Anfang finden. Aber jetzt steht er da. Zu Beginn eine biographische Notiz, die jedoch auch übersprungen werden kann.
Mein Interesse an Lernberatung und Selbstgesteuertem Lernen entstammt zunächst einem Zufall. Ende 2000, das Vordiplom an der Justus-Liebig-Universität in Gießen gerade in der Tasche, schlendere ich zum – wie ich zu diesem Zeitpunkt dachte – letzten Mal durch die Flure des Instituts und bleibe an einer Ankündigung stehen.
„QINEB – Qualifizierung durch innovative Erwachsenenbildung – Gemeinsamer Weiterbildungsstudiengang für Praktiker und Studenten – Entwicklung von Selbstlernarchitekturen – Lernberatung als neue professionelle Rolle“ - so oder so ähnlich lauten die mir noch präsenten Fetzen des angepinnten DinA4-Papiers. Ich gehe weiter. „Warum meldest Du Dich nicht an?“ ruft mich eine Stimme zurück, die zu einer Absolventin des ersten Durchgangs von QINEB gehört. Ja, warum eigentlich nicht? Ich trage mich in die noch recht leere Anmeldeliste ein.
Seitdem ich vor einigen Jahren den Weiterbildungsstudiengang QINEB (s. Kapitel 4.5.1.2.) absolviert habe, lässt mich das Thema Lernberatung und Selbst- gesteuertes Lernen, das in einem weiteren Kontext unter dem Label „Lebenslanges Lernen“ auch in der täglichen Medienberichterstattung präsent ist, nicht los. Das Interesse wurde unterfüttert durch das Praktikum während des Hauptstudiums der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, das ich in einem Selbstlernzentrum absolvierte, in dem Lernberaterinnen und Lernberater tätig sind. Es schälte sich immer stärker heraus, in diesem Feld meine Diplomarbeit anzusetzen. An Material sollte es nicht mangeln: Lernberatung als neue professionelle Rolle zählt – nimmt man die stetig wachsende Trefferzahl in Literaturdatenbanken als Hinweis[1] – zu den
Boomthemen der Disziplin. Selbstlernzentren als im Zuge der Diskussion um neue Lernkultur wieder entdeckte und bildungspolitisch geforderte Organisationsform aus den 70er Jahren sind verbunden mit dem Reiz, eine historische Idee unter aktuellen Rahmenbedingungen neu zu denken. Hinzu kommt ein Wust an programmatischer und theoretischer Literatur zur Thematik „Selbstgesteuertes Lernen“, die von Kade (1998) gar als „eigener Handlungsbereich“ pädagogischer Praxis eingeschätzt wird.
Doch mit fortschreitender Lektüre gewann ich auch den Eindruck, das etwas fehlte: Beschreibungen des WIE von Lernberatung auf einer mikrodidaktischen Ebene in der pädagogischen Praxis. Wie schlagen sich die heeren Ideen selbstgesteuerten Lernens konkret nieder, welche Gestalt hat Lernberatung jenseits von theoretischen Programmatiken oder gut ausgestatteten Modellprojekten, wie sehen und beschreiben Lernberater ihre eigene alltägliche Praxis, welche Muster von Lernberatung lassen sich identifizieren? Dort, wo einschlägige programmatische Arbeiten zu neuer Lehr- und Lernkultur in der Regel enden, wollte ich anfangen und damit zum Beispiel dem Vorschlag von Fuchs-Brüninghoff (1999, S. 10) folgen, die neue Lehr- und Lernkultur als ein „Chiffre für Innovation“ beschreibt, das institutionell dechiffriert werden muss. Auch Schiersmann/Remmele (2002, S. 30) stellen fest, dass im Hinblick auf Lernberatung „die wissenschaftliche und bildungs- politische Diskussion der Praxis vorauseilt“ und Klein/Reutter/Dengler/Poppeck (2002, S. 44) beschreiben schließlich: „Selbststeuerung“, „Selbstorganisation“,
„Partizipation“, „Ganzheitlichkeit“ „Transparenz“ oder „Modularisierung“ gehören zu den andragogischen Schlüsselwörtern, die ausweisen, dass die Antragssteller und Dokumentierer auf der Höhe der Zeit sind. Inwieweit aus den mit diesen Schlüssel- wörtern verbundenen andragogischen Postulaten gelebte Praxis werden kann, erschließt sich nur aus einer gründlichen Analyse der dargestellten Wege, die zur Zielerreichung führen sollen“.
Zu diesem Zweck machte ich mich auf die Suche nach weiteren Selbstlernzentren, um dort Interviews mit LernberaterInnen durchzuführen mit dem Ziel, eine Analyse
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zu erstellen und vielleicht erste Hinweise auf Typen von Lernberatung geben zu können. „Hinweise“ deshalb, weil die Fall- zahlen (vier Selbstlernzentren, insgesamt sieben Interviews) natürlich gering sind, wenn auch Lamneks (1995, S. 204) Aussage zur Typenbildung, sie gehe einer „mit der Einschränkung eines Verzichts auf die Quantifizierung der Muster (wie viele Personen sich gemäß einem Muster verhalten, ist nicht von Belang)“ entlastend wirkt. So kann diese Erhebung zum einen als Co-Referat zu groß angelegten, quantifizierenden Forschungsprojekten wie zum Beispiel der Studie „Beratung in der Weiterbildung“ von Schiersmann/Remmele (2002) gelesen werden, das erschließen lässt, „was gemeint ist, was hinter den dürren Zahlen steht“ (Oswald 1997, S. 83). Zum anderen dient sie als empirische Ergänzung zur sehr breiten Diskussion auf theoretischer Ebene, denkt „von der Praxis aus“, ohne die theoretischen Konzepte außer acht zu lassen, was Kluge/Kelle (1999, S. 21) als eine Art „Zangengriff, bei dem der Forscher oder die Forscherin sowohl von dem vorhandenen theoretischen Vorwissen als auch von empirischem Datenmaterial ausgeht“, beschreiben.
Das bisher Gesagte lässt den Aufbau erahnen. Zunächst muss das methodische Vorgehen – Feldforschung, Forscherrolle, Teilnehmende Beobachtung, Interviews, (Kapitel 3) – konkretisiert werden. Dabei habe ich entschieden, die Darstellung des Vorgehens bei der Datenerhebung von der Beschreibung der Auswertungsmethodik (Kapitel 5) zu trennen. Zwar handelt es sich jeweils um methodische Gesichts- punkte, jedoch spiegelt diese Trennung den Prozess meiner Arbeit besser wieder. Denn nach einer ersten Lektürephase konzipierte ich den Interviewleitfaden, führte die Mehrzahl der Expertengespräche und transkribierte, so dass ich nach rund zwei Monaten die Erhebungsphase abgeschlossen hatte. Danach folgte nicht sofort die Auswertung, sondern eine zweite Phase des Aufarbeitens der für mich unter einer mikrodidaktischen Perspektive interessanten Stränge der Diskussion um Neue Lernkultur und Selbstgesteuertes Lernen (Erhöhung metakognitiver Anteile, Lernen mit Neuen Medien, Kapitel 4), wobei ich Konzepte von Lernberatung (Kapitel 4.5) besonders berücksichtige. Hier wartet viel begriffliches Glatteis, wie bereits die Tatsache, dass Selbstgesteuertes Lernen ein „modischer Containerbegriff“ (Meisel 2002, S. 140) zu werden droht und Lernberatung je nach Sichtweise als „Omnibus- begriff“ (Rohs/Käpplinger 2004), „Leerstelle“ (Gieseke/Käpplinger 2001, S. 246) oder auch „randständiges Problem, das sich in der Realität nicht selten auf eine Art Kursverwaltung reduziert“ (Kerres/Jechle 1999, S. 30) bezeichnet wird, ahnen lässt. Am Ende dieser theoretischen Lektüre skizziere ich jeweils den Ertrag für die Erstellung des Interview-Leitfadens beziehungsweise Perspektiven für die Auswertung der Gespräche.
Erst nach Abschluss von Kapitel 4 widmete ich mich intensiv – zunächst parallel zur Lektüre, dann ausschließlich – dem kreativen Part des Projekts, nämlich der Ana- lyse der Interviews. Zwar existierte bei ihrer Planung bereits eine Idee von der Auswertung via Inhaltsanalyse – nicht klar war jedoch, welche Klippen, Tiefen und Brüche dabei warten würden (Kapitel 5). Als Resultat dessen steht Abschnitt 6, der die ermittelten Kernkategorien vergleichend beschreibt, Zusammenhänge vorstellt und schließlich mit der Formulierung von zwei Idealtypen endet. Kapitel 7 dient der Ergebnissicherung und gibt einen Ausblick auf mögliche Anschlüsse.
Das nun folgende Auftaktkapitel zur Geschichte von Selbstlernzentren (Kapitel 2) mag zunächst als nicht recht zugehörig empfunden werden, ist jedoch aus drei Gründen sinnvoll. Erstens kann die Konturierung einer pädagogischen Tätigkeit wie Lernberatung nur auf der Folie des jeweiligen organisatorischen Rahmens erfolgen[2] und ich wollte der selbst erfüllenden Prophezeiung entgehen, im Zuge einer häufig geforderten Eingrenzung des Themas (zum Beispiel Fokussierung auf die Tätigkeit „Lernberatung“ unter Aussparung der Betrachtung der organisationalen Ebene „Selbstlernzentrum“) schon zu Beginn der Abhandlung zu wissen, dass im Fazit stehen würde: „Eigentlich hätte man stärker die Rahmenbedingungen beachten müssen.“ Auch Dietrich (2004, S. 65) äußert: „Die Richtung und Tiefe dieses (JM: Innovations-)Prozesses kann nur einrichtungsspezifisch unter Berücksichtigung der konkreten Bedingungen (Teilnehmendenschaft, Auftrag und Ziele der Institution, gewachsene Lernkultur, Führungsverhalten, beteiligte Akteure und deren Kompetenzen und Haltungen) definiert bzw. entschlüsselt werden.“ Deshalb erscheint der Versuch sinnvoll, ebenfalls die – wenn auch schwer zugänglichen (vgl. Schüssler 2004b, S. 35) – impliziten Normen und Regelungen der Organisationen zu betrachten und somit das Interesse an Lernberatung zu erweitern um einen Blick auf die Lernkultur der Einrichtung (vgl. ebd., S. 36 ff.)[3]. Zweitens ist die aktuelle Literaturlage zum Thema Selbstlernzentren spärlich[4], so dass der historische Rückgriff eine gute Möglichkeit bietet, diese Idee mit Leben zu füllen. Drittens lässt sich hieran eine Interpretationsfolie „Emanzipation vs. Ökonomisierung“ entwickeln – ein Thema, das im Diskurs um lebenslanges Lernen stets präsent ist und mein gesamtes Vorgehen als „Brille“ begleiten wird. Es wird sich zeigen, dass das Thema Emanzipation auch dann eine Betrachtung lohnt, wenn es sich – wie in den von mir analysierten Fällen – in weiten Teilen „nur“ um EDV-Kurse handelt.
In diesem Zusammenhang schreibt Koring:
„Die EB [...] meint, dass die pädagogische Qualität vom (möglichst emanzi- patorischen und bildungsfördernden) Lerninhalt abhängig ist. Dies ist aber eine falsche Perspektive, weil pädagogische Qualität ebenso für den EDV- Kurs wie für die politische Bildung realisierbar sein muss. Nur so ist eine unprofessionelle, moralisierende Pädagogik zu vermeiden, die über die vermeintlich autonome Selektion von Inhalten sich „Funktionalisierungen“ meint entziehen zu können.
Trotz dieser „breiten“ Ausrichtung gehen mit der Arbeit genügend thematische Begrenzungen einher. So findet keine allgemeine Diskussion von Beratung in der Weiterbildung (vgl. Sauer-Schiffer 2004) statt, ich springe direkt zur Betrachtung von Lernberatung als einer Form von personenbezogener Beratung, die sich auf TeilnehmerInnen bezieht, „die sich bereits in einer konkreten Lernsituation befinden“ (Schiersmann/Remmele 2004, S: 11, Hervorhebung JM). Außen vor bleibt das viel diskutierte reine Online-Learning und die Rolle einer „virtuellen Lernberatung“, da das Kernproblem dieser Debatte – wie kann Kommunikation zwischen nicht am selben Ort anwesenden Lehrenden und Lernenden erzeugt werden? (vgl. Kerres/Jechle 1999 und 2000, zum Online-Tutoring Behrendt/Ulmer/Müller-Tamke 2004; Schröder/Wankelmann 2002) – auf Selbstlernzentren, wo Face-to-Face-Inter- aktionen zwischen Lernberatenden und Lernenden an der Tagesordnung sind, nicht zutrifft. Zudem beschreibe ich die hinter den Konzepten liegenden lerntheoretischen Grundlagen nur in Kürze[5] und bevorzuge stattdessen, nach der Anschlussfähigkeit als „Taktgeber“ für die Praxis in Selbstlernzentren zu fragen. Auch die Diskussion von zwei „harten“ Fragen unterbleibt:
a) Ist das Vorgehen professionell?
Die Professionalisierungsdiskussion um Beratung (vgl. Sauer-Schiffer 2004b) streife ich nur insofern, da ich Kompetenzen benenne, die die interviewten Lernberater als wichtig erachten und Hinweise auf ihr Selbstbild gebe. Eine Entscheidung, ob Professionalität vorliegt, kann allein damit jedoch nicht getroffen werden. Hierzu hätte die biographische Perspektive stärker beachtet werden müssen, da davon auszugehen ist, dass Lernberatung als neue Rolle das bisherige Selbstbild der Lehrenden brüchig werden lässt und untersucht werden müsste, wie Professionelle diese Anforderung verarbeiten. Mittel der Wahl wären keine Experteninterviews, sondern narrative Interviews gewesen. Die gesamte Arbeit hätte anders angelegt, andere Begriffe (Profession, Professionalität, Professionalisierung) diskutiert, andere Theoriestränge (merkmalsbezogene Konzepte, wissenssoziologische Ansätze – vgl. für einen Überblick Nittel 2000) betrachtet werden müssen. Dieses Begriffswerkzeug für eine Bewertung der Frage nach Professionalität kann hier nicht erarbeitet werden, weshalb der Arbeit diesbezüglich der Charakter einer den Ist-Zustand beschreibenden Vorabstudie zukommt. Eine einordnende Bewertung bleibt anderen Autoren vorbehalten.
b) Lernen die Teilnehmenden da überhaupt etwas?
Dies wäre ein eigenes Thema aus dem Bereich der Wirkungsforschung (vgl. Schüssler 2004b zur Komplexität dieses Diskurses). Dennoch ein Hinweis: Obwohl man weiß, dass in kursorischen Arrangements Intentionen von Lehrenden und Wirkungen auf Lernende auseinander treten, man sich von der „Illusion der Machbarkeit“ (Schüssler 2004b) und der „trügerischen Gewissheit, dass solange sich Menschen in einem Seminarraum aufhalten, dort 'gelehrt' und 'gelernt' wird“ (Kerres /Jechle 1999, S. 31) verabschieden solle und man sich als Erwachsenen- bildner in Sachen Lernwirkung gerne auf Zukünftiges zurückzieht (zum Beispiel den „Sleeper-Effekt“, Siebert 2000b, S. 110) – sobald die Rede auf individualisierte Lern- arrangements kommt, sind diese Erkenntnisse schnell vergessen und der klassische Kurs erscheint gerade in Bezug auf den Erwerb inhaltlichen Wissens als wesentlich sinnvollere Alternative. Nun lindert dieser Vergleich nicht die Frage – Lernen die Leute da überhaupt was? – aber er mindert vielleicht ihre Schärfe. Einen kleinen Beitrag versuche ich zu diesem Thema dennoch zu leisten, indem ich von den Lernberatern beschriebenen Effekte auf Teilnehmerseite benenne.
Nun hinein in die Darstellung der letzten sechs Monate und den Versuch, die Diskussion um selbstgesteuertes Lernen um einen Blick auf pädagogische Konzepte in der Praxis zu erweitern und empirisch-beschreibend anzureichern, ohne der teilweise emphatischen Literatur unkritisch zu erliegen, aber auch ohne diese Diskussion vorschnell unter Ideologieverdacht zu stellen. Im Auswertungs- kapitel habe ich – angeregt durch einen Diskussionsstrang der Ethnologie (vgl. Kapitel 3.4.) – mit der Darstellungsform experimentiert, um so ein Stück weit Trans- parenz über den Auswertungsprozess zu schaffen. Zu diesen kleinen Schreib- experimenten zählen zum Beispiel der Einbau von Zitaten aus den Interviews[6], eingeklinkte Textinseln oder Notizen aus meinem Forschungstagebuch. Dies könnte man im Sinne von Ette (2004, S. 165 ff.) als „spielerische Elemente“ deuten, die ein Abdriften „hin zur Geheimwissenschaft für wenige Gleichgesinnte“ verhindern und Leserinnen und Lesen „zum Mitspielen“ animieren. Oder in den Worten von Barthes (1995, zit. nach Ette 2004, S. 168):
„Und ich bin mehr und mehr davon überzeugt, dass, sei es beim Schreiben, sei es beim Unterrichten, die grundlegende Operation des Loslassens, wenn man schreibt, in der Fragmentierung, wenn man vorträgt, in der Abschweifung besteht, oder, um es mit einem köstlich zweideutigen Ausdruck zu sagen: in der Exkursion. Ich wünschte also, dass Sprechen und Zuhören, die sich hier miteinander verflechten, dem Hin und Her eines Kindes glichen, das in der Nähe der Mutter spielt, sich von ihr entfernt, dann zu ihr zurückkehrt, um ihr einen Stein, einen Wollfaden zu bringen, so rings um ein friedliches Zentrum einen Spielraum schaffend, innerhalb dessen der Stein oder der Wollfaden letztlich weniger bedeuten als das von Eifer erfüllte Geschenk, das daraus gemacht wird.“
Ehe ich nun den „Wollfaden“ zur Diskussion um Selbstgesteuertes Lernen, Selbstlernzentren und Lernberatung werfe, noch einige formale Hinweise:
- Die Arbeit folgt den reformierten Regeln der deutschen Rechtschreibung. Zitate aus Literatur älteren Datums wurden weitestgehend nicht angeglichen.[7]
- Die transkribierten Interviews, Protokolle aus teilnehmender Beobachtung sowie Fotografien der von den Interviewpartnern gelegten Strukturbilder finden sich im separat gebundenen Anhang.
- So weit möglich und sinnvoll habe ich das Geschlecht betreffend neutrale Formen wie „Lehrende“ oder „Teilnehmende“ verwendet. Ansonsten bevorzuge ich das sogenannte Binnen-I wie zum Beispiel in LernberaterInnen.
2. Selbstlernzentren – Idee und Geschichte
In einem kleinen Band aus dem Jahr 1970 mit dem Titel „Zukunftsperspektiven der Erwachsenenbildung“ skizziert Hans Tietgens, seinerzeit Leiter der Pädagogischen Arbeitsstelle des Deutschen Volkshochschul-Verbandes, folgende Entwicklungen:
„Das SLZ (Anm. JM: Selbstlernzentrum) ist die Institutionalisierung der Tendenz zur Individualisierung des Lernens und zur Nutzung der technischen Möglichkeiten. Es gibt der Spontaneität und der Unmittelbarkeit der Lernbedürfnisse Raum und lässt dabei die Art, wie sie befriedigt werden, offen“ (Tietgens 1970, S. 88).
16 Jahre später ist es erneut Tietgens, der in einem Sammelband unter dem Titel „Aufforderung zur Erinnerung“ rückblickend die Geschichte der ersten Selbstlern- zentren in Deutschland in den 70er Jahren mit folgenden Schlagworten resümiert:
- Ein erstes Konzept: überlagert von der Technik
- Was unzulänglich blieb: die Beratung
- Eine ungenutzte Chance: das Angebot zur Selbstgestaltung und Kommunikation (vgl. Tietgens 1986, S. 75).
In den 90er Jahren konstatiert schließlich Susanne Kraft:
„Die betrieblichen Gründe für die Einrichtung von Selbstlernzentren liegen auf der Hand: Das Ziel ist v. a. eine Kostenersparnis im Weiterbildungsbereich und die Deckung des steigenden Bedarfs an Weiterbildung“ (Kraft 1998, S. 75).
Die Leerstellen zwischen diesen drei Spotlichtern auf die Geschichte von Selbstlern- zentren in Deutschland sollen im folgenden Kapitel gefüllt werden. Dabei dienen folgende Gesichtspunkte als Orientierung:
Gesellschaftlicher Rahmen Didaktische Konzeption Rolle der Profession
2.1. Selbstlernzentren der 70er Jahre
„Wir sind auf dem Weg in ein neues Jahrtausend, auf dem Weg, ein Kreuzzug ins Glück“ (Die Toten Hosen)
2.1.1. Gesellschaftlicher Rahmen
Betrachtet man im Jahr 2004 rückblickend das Arbeitspapier „Selbstlernzentrum und Volkshochschule“, das die Pädagogische Arbeitsstelle des Deutschen Volkshoch- schulverbands im Jahr 1970 zur Diskussion vorlegte und das wohl erstmals das Stichwort Selbstlernzentrum enthielt (vgl. Tietgens 1986, S. 81), stechen die mit dieser Organisationsform verbundenen emanzipatorischen Absichten ins Auge. Otto beschreibt: „Die Studentenunruhen Ende der 60er Jahre brachten beispielsweise in Berlin einen Club Voltaire, die Gegenuniversität und die Kinderläden vor. Ihre Beobachtung und kritische Diskussion ließen die Vorstellung von einer „Laden- Volkshochschule“ Gestalt gewinnen, die Bildung als Ware und als eine Möglichkeit der Selbstgestaltung begreift. Die Vorstellung von einer 'lernanregenden' Gesell- schaft sollte durch den Aufbau von Selbstlernzentren Realität werden“ (Otto 1979, S. 31). Selbstlernzentren galten somit als Ausdruck der „Innovationsfreudigkeit im Bildungswesen in den späten sechziger und frühen siebziger Jahren“ (Killait / Burr 1980, S. 323), verbunden mit der Vorstellung, dass „spontane Wünsche und Bedürfnisse in der Bevölkerung“ deutlich werden können und dass „politische Bildung einen Spielraum der Selbstgestaltung“ erhält (vgl. Arbeitspapier 1970, S. 6). Auch Dohmen argumentiert emanzipatorisch, wenn er im Zusammenhang mit Selbstlernzentren beansprucht, „soweit wie möglich selbst an der Basis zu entschei- den, statt dirigistisch von zentralen Gremien und Behörden gelenkt und kontrolliert zu werden“ (Dohmen 1979, S. 21). Und Jüchter (1971b, S. 111) formuliert:
„Selbstlernzentren sollen [...] offene kommunale Zentren sein. Sie sollen als Institution deutlich machen, dass Lernen und Weiterbildung ein öffentliches und freies Angebot sind, dessen Benutzung ebenso selbstverständlich werden kann wie die Benutzung öffentlicher Verkehrswege und öffentlicher Telefonleitungen.“
2.1.2. Didaktische Konzeption
Wie sah nun das didaktische Konzept der Selbstlernzentren der 70er Jahre aus? Welches Bild hatte man von den Lernprozessen, die sich in dieser Organisation vollziehen? Bei der Darstellung unterscheide ich zwischen vorab formulierten Ideen und Programmentwürfen sowie real erfolgten Umsetzungen.
Entwürfe
Mit Blick auf die makroorganisatorische Einbindung ist festzuhalten, dass eine Netz- werkbildung mit der Volkshochschule favorisiert wurde – sicherlich auch ein Zeichen für die damalige Fixierung des Weiterbildungssystems auf die VHS. Zudem wurde verschiedentlich eine Zusammenarbeit mit örtlichen Bibliotheken (vgl. Beddig/Er- nestus/Otto 1976) diskutiert, sollten doch Selbstlernzentren als Pendant die „Benutzung des ohnehin wachsenden Bestandes an objektivierten Lernmaterialien organisieren“ (Jüchter 1971b) und so als „Archivar“ fungieren[8].
Als Einstieg in die Darstellung der mikrodidaktischen Ebene ist ein Ansatz von Schäffter (1981, S. 31) hilfreich, der „Strukturmodelle von Lehr/Lernbeziehungen in der Erwachsenenbildung“ auf allgemeiner Ebene diskutiert und zwischen dem Schulungsmodell, dem Interventionsmodell, dem Marktmodell, dem Vermittlungs- modell, dem Selbstlernmodell und dem Selbstorganisationsmodell differenziert. Dabei unterscheidet er jeweils das Feld der Lehrer und das Feld der Lerner und ordnet diesen unterschiedliche Aktivitäts- bzw. Passivitätsniveaus zu.
Das Selbstlernmodell, für das Schäffter Selbstlernzen- tren als Beispiel nennt, „geht von einer hohen Aktivität im 'Feld der Lerner' aus, dem eine große Offenheit und organisatorische Flexibilität im 'Feld der Lehrer' entspricht“ (Schäffter 1981, S. 49). Somit entsteht ein
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Selbstlernmodell nach Schäffter
institutionelles Profil, das durch die Verbindung von hoher Differenzierung, weit gehender intentionaler Offenheit, Nondirektivität und organisatorischer Flexibilität (ebd., S. 50) gekennzeichnet ist.
Getreu diesen Charakteristika sollten in einem Selbstlernzentrum Angebotsformen unterschiedlichster Art vorhanden sein (siehe auch die Raumskizzen unten). Otto (1979, S. 33) nennt „schriftliche Informationshilfen, programmiertes Instruktions- material, strukturierte Bildreihen, Platten, Bänder, gespeichertes Fernsehmaterial, Sprachlabor-Kabinen, mathematisches Labor, naturwissenschaftliche Ausrüstung, Werkräume etc.“ Diese Lernanregungen sollten – unterstützt von Lernberatern – Erwachsene „in freierer und flexiblerer Weise abrufen, kombinieren und nutzen“ (Dohmen 1979, S. 23) können. Schäffter (1981, S. 50) gibt jedoch zu bedenken, sich „nicht über das hohe Maß an strukturellen Zielorientierungen hinwegtäuschen“ zu lassen. Für ihn bestehen auch in Selbstlernzentren „didaktisch ausgetüftelte Arrangements, mit denen gezielt Lernanreize hervorgerufen werden. Der Lernort soll die Teilnehmer zu eigenem Tun herausfordern“. Tietgens (1970, S. 88) liefert eine Kurzfassung des Konzepts: „Entscheidend ist,
- daß die Zugangsschwelle zum Lernen niedriger wird
- daß der Lernende den Zeitpunkt seines Lernens selbst wählen kann
- daß qualifiziertes Arbeitsmaterial bereitsteht
- daß eine Beratung möglich ist.“
Weitere Themen der didaktischen Diskussion
In der damaligen Debatte um Selbstlernzentren lassen sich zahlreiche Diskussionsstränge identifizieren, die heute wieder aktuell sind, ohne dass ihre historischen Bezüge (Ausnahme: Meisel 2002) registriert würden. Drei Beispiele:
a) Isolierung des Lernens? (siehe „aktuell“ Kapitel 4.3.2.)
Der Gefahr einer Isolierung des Lernens soll vorgebeugt werden, indem innerhalb der Selbstlernzentren die Möglichkeit zu „mannigfache[r] Kommunikation“ (Jüchter 1971a, S. 39) geschaffen wird und der „einzelne Lernende möglichst häufig auch Gelegenheit [erhält], sein Lernen gegenüber anderen zu artikulieren, Lerninforma- tionen auszutauschen und in der Gruppe kritisch zu werten“ (ders. 1971b, S. 125). Dies soll durch die räumliche Gestaltung (z.B. Cafeteria, Sitzecken, Gruppenräume) angeregt werden, wobei insbesondere die Notwendigkeit „kritischer Clubs“ betont wird. In ihnen soll mittels kontroverser Informationen Kritik und Reflexion trainiert werden und so Kritik „zum Thema und zum Prinzip des Lernens“ (Jüchter 1971b, S. 116/117) werden. Auch Kemna (vgl. 1979, S. 180) fordert einen Verbund von
Einzel- und Gruppenlernen und schreibt letzterem die Funktion zu, „die mehr oder weniger auswendiggelernten Kommunikationsabläufe der Lernprogramme systema- tisch zu verfremden; die Geschlossenheit jeder Programmsequenz muß in der Gruppenarbeit aufgebrochen werden zugunsten eines mehr und mehr programm- unabhängigen Artikulationswillens“.
b) Förderung von Selbstlernkompetenzen (siehe „aktuell“ Kapitel 4.3.2.) Jüchter fordert: „Das Lernen des Lernens muß an möglichst vielen Stellen angeregt und durch Trainingsprogramme gefördert werden.“ (Jüchter 1971b, S. 126). Und Kemna (1979, S. 178) stellt fest: „Selbstbestimmtes Lernen ist also keineswegs eine selbstverständliche Reaktion des Erwachsenen auf das Angebot eines Selbstlern- zentrums. Ganz ohne beratende und belehrende Hilfe scheint das meist nicht zu gehen.“ Unter “Hilfe“ möchte Kemna gerade nicht nur die „Hinführung und Moti- vation zu dieser Lernform“ mit ihren „harmlosen Bequemlichkeiten im Dienste der Individualisierung von Lernprozessen“ (z.B. freie Wahl von Lernzeiten, Lerngegen- stand, Lernweg, Lerntempo) verstanden wissen, sondern auch und gerade die Re- flexion von lernpsychologischen Voraussetzungen, Lerntechniken und Fähigkeiten der Selbstkontrolle.
c) Mediengestütztes Lernen als Spielerei? (siehe „aktuell“ Kapitel 4.3.3.)
Die auch in der heutigen Diskussion um computerbasiertes Lernen vorfindbare These, wonach die Gefahr besteht, dass „das didaktische Spielen mit den Medien- Apparaturen Selbstzweck wird“ spricht Jüchter (1971a, S. 113) bereits vor über 30 Jahren an. Er sieht aber im Einsatz jener Medien die Möglichkeit, „dem Lernen tatsächlich einiges von seinem Bierernst“ zu nehmen. „Lernen muss wieder Spaß machen dürfen“ (Jüchter 1971b, S. 127). Tietgens (1970, S. 89) gibt zu bedenken:
„Wir wissen zwar, welche nützliche Rolle beispielsweise programmierte Sequenzen in Sprachlaborkabinen spielen können (Hervorhebung: JM), aber wir haben sie noch nicht in hinreichender Zahl und Güte.“ Er mahnt an, dass ein SLZ auch „ein Gegengewicht zu möglichen, interessenbedingten Tendenzen der Lernmittel- industrie bilden“ sollte (ebd., S. 90). Ein SLZ sollte kein reines Medienzentrum sein, sondern auch als Ort der Bildungsarbeit informeller Gruppen, als Ort der politischen Bildung, als Ort künstlerischer Aktivität (vgl. ebd. 1970, S. 90) genutzt werden.
2.1.3. Rolle der Profession
„Die individuelle Beratung muss zur Programmstruktur des Selbstlern- zentrums gehören, vielleicht sogar ihr pädagogischer Kern sein.“
(Jüchter 1971b, S. 116)
Liest man die Texte zur der Rolle der Professionellen im Selbstlernzentrum, stellt sich wie bereits bei der didaktischen Diskussion der Effekt ein, dass einige der heute vorgebrachten Argumente (vgl. Kapitel 4.5.) an vermeintlich innovatorischer Kraft einbüßen. So fordert Jüchter (1971a, S. 109 ff.), „vom Dozieren [...] wegzu- kommen“ und dass „ein Lehrer bzw. Dozent als Vermittler zwischen Lernstoff und Lernenden (im Sinne direkter Steuerung des Lernprozesses) vermieden [wird]“. An diese Stelle treten folgende Bilder: individueller, helfender Lernberater, Animator von Lernkontakten (Jüchter 1979), aufmerksamer Beobachter, Hilfestellung- Leistender, Ratgeber, sachgerechter Ermutiger, der jedoch situationsbedingt auch als „Lernanwalt gegen [...] eingeschliffene Verhaltensweisen“ fungieren kann (Heintz/Killait 1978, S. 83), Lerntechniker, Lernprozessberater, Lernplaner, Rat- geber, Lebenshelfer, Lernorganisator, Bildungswerber, Weichensteller, Curriculums- konstrukteur (Heintz 1978, S. 97).
Hauptaufgabe ist es, bei der Auswahl der Programme zu assistieren, mögliche Lernwege zusammenzustellen, bei Lernschwierigkeiten zu helfen und „Lernschleifen“ anzubieten (vgl. Voß-Schulz 1981, S. 12). Auf einer Mesoebene wird gefordert: „Da die soziale Offenheit der Lernorte nicht vorausgesetzt werden kann, muß sie von den pädagogischen Mitarbeitern immer wieder in den Interaktions- prozessen zwischen den beteiligten Gruppen gefördert oder hergestellt werden“ (Schäffter 1981, S. 114).
Ehe ich mich der Frage zuwende, wie diese Programmatiken in der Praxis umgesetzt und welche Erfahrungen mit Selbstlernzentren gemacht wurden, soll eine Raumskizze aus dem Arbeitspapier „Selbstlernzentrum und Volkshochschule“ der Pädagogischen Arbeitsstelle des Deutschen Volkshochschulverbands die Ebene von Kapitel 2.1. – Ideen und normative Forderungskataloge – abrunden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Skizze eines Selbstlernzentrums (Jüchter 1970, S. 10).
2.1.4. Erste Erfahrungen – Selbstlernzentren in der Praxis
Indizien zur Beantwortung der Frage nach der Umsetzung in die pädagogische Praxis lassen sich aus den Erfahrungsberichten gewinnen, die zu den Selbstlern- zentren in Marl, Dillingen (1975-1978) und Wuppertal (1973-19769) vorliegen und in mehr oder weniger ausführlicher Form zugänglich sind. Zur Einordnung ist zu beachten, dass es sich dabei um Ergebnisse von Umfragen unter den NutzerInnen der Selbstlernzentren handelt. Die Schilderung folgt einem Gliederungsvorschlag von Heintz (1978): Räumlichkeiten, Medien, Beratung.
Räumlichkeiten
Aus dem SLZ Dillingen stammt der Befund, dass sich „kein pädagogisches Reizklima“ entwickelt hat, wobei zu beachten ist, dass Reizklima positiv im Sinne von kritikfreudiger Diskussionsatmosphäre konnotiert ist. Die erhoffte „mannigfache Kommunikation“ entsteht nicht, nur [9],2 Prozent der Befragten bejahen die Aussage:
„Man kann vor und nach der Arbeit diskutieren und gesellig beieinander sein, wenn man Lust dazu hat“. Entsprechend wird der Wunsch nach regelmäßigen Lern- gruppen sowie einem didaktischen Verbund aus Lernberatung, mediengestütztem Einzellernen und Gruppenlernen formuliert. Dieser „didaktische Verbund“ wird wiederum aktuell diskutiert – unter dem Schlagwort „Blended Learning“, das als Reaktion auf die Ernüchterung der Euphorie um E-Learning gilt.
Medien
Es entstand die Kritik, dass Selbstlernzentren einseitig auf technische Medien fixiert waren, die zudem weder qualitativ (vgl. Tietgens 1970, S. 89) noch quantitativ den Ansprüchen genügten. Jüchter zieht das Fazit (1979, S. 67): „Es fehlt an geeigneten Selbstlernmedien der Weiterbildung“, wobei er Buch-Lernprogramme als „meistens langweilig“, Audio- oder Video-Programme als „mit Informationen überfrachtet“ und Sprach-Lern-Programme als zu wenig kommunikationsbasiert einschätzt.
Heintz (1978, S. 112), beteiligt beim Modellversuch in Dillingen, verteidigt diese Ausrichtung damit, dass „viele Teilaspekte des Medieneinsatzes in der Erwachsenenbildung noch weitgehend unerforscht [sind]“ und man sich deshalb
„ermutigt fühlen [darf], gerade auch in Selbstlernzentren den Einsatz von program- miertem Material zu experimentieren“. Auch Otto (1979, S. 15) argumentiert im Modus eines „noch nicht“ und beschreibt Probleme bei der Medienausstattung, „weil es noch nicht hinreichende Erfahrungen und entsprechend abgesicherte Beurteilungskriterien für die Wahl von Geräten und Trägermaterialien im visuellen, auditiven und audiovisuellen Bereich gibt. Es zeigt sich häufig, daß das relativ umfangreiche Angebot von Unterrichtsmedien für das öffentliche Schulwesen zwar auch für die Erwachsenenbildung geeignet erscheint, aber der besonderen Adaption bedarf, die zeitraubend und kostspielig ist und für die kaum Erfahrungen vorliegen“. In den Erfahrungsberichten – und insofern scheint Tietgens’ Vorwurf der Technik- zentrierung gerechtfertigt – finden sich keine Hinweise auf künstlerische Aktivitäten oder Bildungsarbeit selbstorganisierter Gruppen[10]. Eine These wie die folgende:
„Vielmehr sind Selbstlernzentren auch ohne jede unterrichtstechnologische Ausstattung wünschenswert, möglich und erfolgsversprechend“ (Beier 1975, S. 9, zit. nach Heintz 1978, S. 76) wurde nicht verfolgt.
Beratung
Während sich der Rückblick auf Modellversuche der 70er Jahre für ein Kernthema dieser Arbeit – Selbstlernzentren als Organisationsform der Erwachsenenbildung – als ergiebig erwies, so ist der Ertrag für den zweiten Fokus – Welche Muster von Lernberatung lassen sich identifizieren?– gering. Tietgens (1986, S. 85) merkt an, die Beratung sei unzulänglich geblieben, was er an einem „Zu wenig“ an Personal festmacht. Einen Eindruck vermittelt die Schilderung eines typischen Ablaufs:
- „Der Lerner kommt in die Mediothek und geht dort zu einer Art Theke.
- Er gibt seinen Bibliotheksausweis ab und nennt seinen Lernwunsch.
- Die Mediotheksmitarbeiterin (man braucht sie nicht „Mediothekarin“ zu nennen, sondern kennt bald ihren Namen) sucht in den Regalen die gewünschten Lernmedien heraus und gibt sie dem Lerner.
- Sie zieht aus der Lernerkartei die Karte des jeweiligen Lerners und trägt dort die von ihm gewünschten Medien ein.
- Sie trägt den Lerner in die Tagesstatistik ein.
- Sie führt den Lerner in die Handhabung der Geräte ein, falls dieser sie noch nicht kennt“ (Jüchter 1979, S. 53).
Jüchter (ebd., S. 54) weist darauf hin, dass Lernberater zudem einen sogenannten
„Lernpaß“ (Aufzeichnung der Lernschritte, Teilnehmerbescheinigungen) ausgestellt haben und dass ergänzend zur Tätigkeit der Lernberater nebenberufliche Mit- arbeiter auf Honorarbasis Fachberatungen für Lerner mit speziellen Problemen in den Fächern Englisch, Französisch, Deutsch und Naturwissenschaften angeboten haben.
Heintz (1978, S. 91) resümiert als Ergebnis aus der Nutzerbefragung:
- bereichsweise zu große Distanz zwischen Beratung und Benutzern
- größere Teilnahme der Berater am Lernprozess der Benutzer würde wohl als motivierend empfunden und schlägt schließlich folgendes Kompetenzprofil vor:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Kompetenzprofil von Lernberatern in Selbstlernzentren (Heintz 1978, S. 91).
2.1.5. Resümee: Selbstlernzentren der 70er Jahre
Die erhoffte emanzipatorisch inspirierte Lernatmosphäre mit kritisch-lebhaften Diskussionsrunden, mannigfacher Kommunikation und Gruppenarbeit stellte sich nicht ein. Wie Tietgens (1986, S. 81) in seinem rückblickenden Aufsatz bemerkt, hat die „Faszination, die von unterrichtstechnologischen Entwürfen [...] ausging, über- sehen lassen, daß das Konzept der Selbstlernzentren nicht eng an technische Apparaturen gebunden war“. Das Selbstlernzentrum als „Ort für Probier- bewegungen“ wurde einseitig interpretiert, der „Gedanke an Kommunikations- zentren“ trat in den Hintergrund (ebd., S. 84). Auch Schäffter (1981, S. 51) kritisiert, dass das „Selbstlernmodell weitgehend mit Individualisierung gleichgesetzt wird und die Möglichkeit selbstorganisierten Lernens von Gruppen nicht gesehen wird“. Er bedauert: „Die Einzellernkabine mit einem Selbstlernprogramm scheint der Prototyp selbstorganisierten Lernens zu sein, andere Möglichkeiten[11] werden nicht in ähnlichem Ausmaß umgesetzt“ (vgl. ebd., S. 113 f.).
Vorteile eines Selbstlernzentrums sind vor allem in den individualisierten Zeit- mustern zu sehen, wie das folgende, rührige Beispiel von Kemna (1979, S. 173) verdeutlicht: „Denn meistens geht es ja doch um Zeitprobleme. Der Mann, dessen Bronchitis pünktlich um sieben Uhr abends ihren Höhepunkt erreicht, kann seine Frau natürlich nicht alleine husten lassen. Gleich aber beginnt der Kursus. Und sie möchte so gern mal nach Frankreich. Aber heute geht’s wieder nicht. Soll sie aufgeben? Sie muß nicht. Vormittags hat sie Zeit. Das Tonmaterial zu dem Lehrbuch ihres Kurses ist auch im Selbstlernzentrum vorhanden. Sie kann sich also Versäumtes dort erarbeiten, so gut das halt allein geht.“
Mit Blick auf die Rolle der Profession scheint trotz der mangelnden Datenlage die Vermutung gerechtfertigt, dass sich Lernberatung vor allem auf einen organisatori- schen Part – die Abwicklung der Ausleihe von Lernmedien – beschränkte und somit mediothekarische Züge annahm.
2.2. Selbstlernzentren Ende der 80er/Anfang der 90er Jahre
2.2.1. Gesellschaftlicher und bildungspolitischer Rahmen
Just zu dem Zeitpunkt, da Tietgens Mitte der 80er Jahre eine „Aufforderung zur Erinnerung“ startet und das Selbstlernzentrum zu den „vergessenen Themen und verkannten Ansätze aus der Geschichte der Erwachsenenbildung“ rechnet, erscheint der Diskurs auf einer anderen Ebene in anderer Gestalt höchst präsent. Zum einen wechseln die Publikationsorgane: Artikel zu Selbstlernzentren finden sich vor allem in Schriften der betrieblichen Bildung mit wirtschaftlichem Zuschnitt. Gewandelt haben sich zum anderen die Legitimationen: Argumentiert wird nicht mehr auf der Folie kritisch-emanzipatorischer Pädagogik, sondern im Modus der Effizienz, was vor allem durch den Vormarsch der Informations- und Kommu- nikationstechnologien bedingt ist, die die Möglichkeiten des Lernens mit dem Computer zunehmend reizvoller scheinen lassen. Hierzu einige Textzitate:
- „Mit einer solchen Einrichtung (Anm. JM: dem Selbstlernzentrum) werden mittler- weile Lücken in der Berufsausbildung geschlossen, neue Arbeitsplatzanforderungen schneller und kostengünstiger vermittelt, anstehende Weiterbildungsmaßnahmen individueller und effizienter gestaltet und durchgeführt“ (Lernfeld Betrieb 1993, S. 7).
- „Die neue Lust am Lernen amortisiert sich schnell“ (über Selbstlernzentren bei einem deutschen Automobilhersteller, www.ibusiness.de/cbt/db/cbt.958995726ln.9- 59787737ln.959097056ln.html, [30. November 2004]).
- „Das 'Massenproblem' (Anm. JM: immer mehr Menschen benötigen Wissen um neue Technologien) ist mit traditionellen Lehr-/Lernmethoden kaum mehr in vertretbarer Zeit und mit akzeptablem Aufwand lösbar“ (Lagemann 1988, S. 13).
- „Folglich ist ein Lernen gefordert, das es gestattet, eine pädagogische Beziehung zu definieren, die sich ohne Qualitätseinbußen auf jedermann anwenden und auf eine größtmögliche Anzahl von Personen ausweiten läßt“ (Debaty 1990, S. 33).
- „...bei größeren Teilnehmerzahlen ist CBT im direkten Vergleich zur traditionellen Schulung bis zu 40 % wirtschaftlicher, ab ca. 50 Teilnehmer kann sich bereits die einmalige Erstinvestition eines Entwicklungsauftrages lohnen“ (Kvech 1990, S. 23).
2.2.2. Didaktische Konzeption
Zu diesem Punkt finden sich in den Publikationen keine näheren Ausführungen. Die Idee von Lernprozessen scheint sich auf „Mensch lernt mit Software und wird dabei punktuell unterstützt“ zu beschränken, wobei betont wird: „Lerninhalte, Lerntempo und Lerndauer können somit selbst gesteuert werden“ (Lernfeld Betrieb 1993, S. 7).
2.2.3. Rolle der Profession
Die Rolle der Beschäftigten in Selbstlernzentren scheint ebenfalls nicht der Rede wert und wird im Vergleich zu den 70er Jahren noch nicht einmal mehr auf program- matischer Ebene diskutiert. Zwar steht „dem Teilnehmer selbstverständlich ein Berater und Betreuer für die gründliche Einweisung in den Umgang mit dem Rechner, die Nutzung der Lernprogramme und die daraus entstehenden Fragen zur Verfügung“ (Knorr 1998, S. 30). Doch wenn Kvech (1990, S. 22) anzeigt, dass sich Mitarbeiter „bewusst auf administrative Tätigkeiten“ beschränken sollen, so wird klar, dass das Kompetenzprofil (s.o.) von pädagogischen Ideen wie Beratung zu Lernstrategien oder Organisation von Gruppenarbeiten weitgehend gereinigt ist.
Dieser Ansatz wird von einer empirischen Studie von Kraft, die Ergebnisse einer Mitarbeiterbefragung zur Nutzung betrieblicher Selbstlernzentren präsentiert, in denen keine Lehrperson anwesend ist, in Zweifel gezogen. Dort findet sich die Aussage: „Ich bin froh, daß keine Lehrperson da ist“ mit der geringsten Zustimmung auf dem letzten Rangplatz (vgl. Kraft 1998, S. 179). Kraft merkt hierzu an: „Das Fehlen oder der Wunsch nach einer Lehrperson [...] kann Unterschiedliches bedeuten. Bei auftretenden technischen Problemen wird von den Befragten ein technischer Berater bzw. Experte nachgefragt. Bei auftretenden fachlich-inhaltlichen Fragen besteht der Wunsch nach einem fachlichen Experten als Ansprechpartner (reale Person oder Tele-Tutor). Davon zu unterscheiden sind die Lernberater, die insbesondere bei auftretenden Lern- und Motivationsproblemen unterstützen sollen“ (ebd. S. 181). Krafts Schlussthese lautet, dass für Selbstlernzentren „eher mehr als weniger Lehrpersonal in der betrieblichen Weiterbildung“ nötig sei (ebd., S. 182). Die Notwendigkeit von Beratung unterstützt auch eine Akzeptanzstudie des Selbst- lernzentrums der Volkswagen AG (Brinkner/Fischer/Schröder 1993), die in der
„Möglichkeit, jederzeit Hilfe anzufordern, wenn der Lerner sie benötigt, aber auch in Ruhe ungestört arbeiten und selbstbestimmt vorgehen zu können“, einen „ent- scheidenden Vorteil gegenüber dem Einsatz von Lernprogrammen in anderen Lernumgebungen“ ausmacht (ebd., S. 16).
2.3. Resümee – Selbstlernzentren im Wandel der Zeit?
Der Überblick über die historische Entwicklung hat gezeigt, dass sich unter- schiedliche Legitimationen für Selbstlernzentren identifizieren lassen – überspitzt formuliert ein emanzipatorisches und ein ökonomisches. Auch im heutigen Diskurs um Selbstgesteuertes Lernen lassen sich beide Muster problemlos verorten, wie Kraft (2002, S. 17-20) in ihrem Überblicksartikel „Wenn viele vom Gleichen sprechen...“ darlegt. So wird auf der einen Seite davon ausgegangen, „dass zunehmende Selbststeuerung dem pädagogischen Leitziel einer Förderung der Mündigkeit des Menschen entspricht“, andererseits erscheint selbstgesteuertes Lernen als „Lösung gegen Kostenexplosion und leere (Weiterbildungs-)Kassen“.
Zudem hat sich gezeigt, wie facettenreich und lebhaft die Diskussion über Selbstlernzentren bereits in den 70er Jahren geführt wurde. Jedoch scheinen diese Erträge für die heutige Debatte um „Neue Lernkultur“ kaum berücksichtigt zu werden. Es lässt sich als Resümee ziehen – und sollte für die Lektüre des Kapitels zu Selbstgesteuertem Lernen im Hinterkopf behalten werden – „dass vieles von dem, was heute als innovatives Lernarrangement bezeichnet wird, so neu gar nicht ist. Eigentlich ist es überraschend, dass in jener Zeit (Anm. JM: den 70er Jahren) unter dem didaktischen Prinzip der Teilnehmerorientierung durchaus visionär vorgedacht und bereits mehrfach praktisch erprobt wurde, was heute wieder als besonders innovativ gilt“ (Meisel 2002, S. 132).
Aus dem nun abgeschlossenen historischen Rückblick ergibt sich als Fragestellung und Interpretationsfolie für die Interviews, wo in diesem Feld von Emanzipation und Ökonomisierung die Selbstlernzentren der Gegenwart verortet werden können, welche Medien ausgewählt werden und welche Bedeutung bei der didaktischen Planung Kommunikationsprozessen beigemessen wird. Zwar bieten die besuchten Einrichtungen – so der erste Eindruck – bevorzugt computerbasierte Lernsoftware an. Jedoch wäre es ein vorschnelles Urteil, sie deshalb mit pädagogisch oft nur minimal betreuten betrieblichen Selbstlernzentren gleichzusetzen, da alle vier Fälle der öffentlichen Erwachsenenbildung zuzurechnen sind und eine Untersuchung von Selbstlernzentren dieser Art bislang nicht vorliegt (siehe zur Auswahl der Stichprobe auch Kapitel 3.3.1.).
3. Datenerhebung – Feldforschung
„Forschung ist auch ein intellektuelles, methodisches und soziales Abenteuer“ (Friebertshäuser 2003a, S. 527)
Gibt ein Forscher an, eine qualitative Erhebung machen zu wollen, so scheint zunächst geboten, die Vorteile dieser Denkart gegenüber einer quantitativ orientierten Forschungslogik zu betonen. Jedoch möchte ich den Dualismus[12] auf dieser allgemeinen Ebene nur erwähnen, nicht jedoch alle gängigen Argumente diskutieren. Dies wäre ein eigenes Thema, zudem ist Keiner zuzustimmen, für den die „Entgegensetzungen von ‚quantitativen’ und ‚qualitativen’ Methoden [...] eine ebenso lange Tradition [haben] wie die Argumente und Appelle gegen dieses syste- matisch inkonsistente, methodologisch wertlose und methodisch unbrauchbare duale Schema“ (Keiner 1999, S. 116). Auch Oswald (1995, S. 74) merkt an, dass es sich „bei qualitativen und quantitativen Methoden nicht um diametral entgegenge- setzte oder sich ausschließende Typen wissenschaftlicher Forschung handelt, son- dern dass es Gemeinsamkeiten und Überschneidungen ebenso gibt wie vielfältige sinnvolle Kombinationsmöglichkeiten“.
Da subjektive Konzepte von Lernberatung sowie die Diskussion ihres pädago- gischen Gehalts im Fokus meines Interesses stehen und „verbale Datenerhebungs- methoden de[n] Königsweg für die Analyse subjektiver Annahmen, Absichten, Weltanschauungen etc. bieten“ (Wiedemann 1986, S. 21), liegt die Entscheidung nahe, Interviews mit in der pädagogischen Praxis als LernberaterInnen tätigen Menschen zu führen. Aufgrund eines regelmäßigen Zugangs zu einem der vier Selbstlernzentren – dort war ich zunächst Praktikant, bin mittlerweile als Honorar- kraft „angestellt“ und ein Einfluss dieser Tätigkeit auf die Idee zu dieser Diplomarbeit lässt sich kaum leugnen – werden die Gespräche in diesem Fall ergänzt durch teil- nehmende Beobachtung sowie die Analyse von Dokumenten (z. B. Protokolle, Lernpläne, Projektberichte) wie auch von quantitativen Daten (z. B. Nutzer- statistiken), so dass für diesen Fall eine Methodenkombination vorliegt, die es wohl erlaubt, ihn als Feldforschung zu bezeichnen. So skizziert Friebertshäuser (2003a, S. 515): „Methodenkombination in der Feldforschung meint die Erhebung und Analyse von Dokumenten unterschiedlichster Herkunft und Natur. Diese werden genutzt, um das Forschungsfeld möglichst umfangreich zu erschließen und aus verschiedenen Perspektiven auszuleuchten.“ Bei den Selbstlernzentren SLZ2, SLZ3 und SLZ4 besteht aus zeitlichen und geographischen Gründen die Möglichkeit einer teilnehmenden Beobachtung und Sammlung weiterer Dokumente vor Ort nicht: Jedoch werden auch hier die Interviewtranskripte ergänzt durch leicht zugängliche Materialien, die von Personen des Feldes erzeugt wurden, wie Flyer oder Texte der Einrichtung zur Selbstdarstellung auf Internet-Homepages.
Die Darstellung der Erhebungsinstrumente „Teilnehmende Beobachtung“ (3.2.) und „Interview“ (3.3.) bildet im folgenden ein je eigenes Unterkapitel, das sich durch drei Schritte auszeichnet: Nach (1) der Sichtung theoretischer Positionen folgt (2) die Darstellung meines eigenen Vorgehens. In einem (3) abschließenden Subtext – sichtbar gemacht durch eine Trennlinie und einen anderen Schrifttyp – sammele ich zudem Heuristiken, Tipps, methodische Praktiken und Durchführungshinweise. Dieses Vorgehen ist als Reaktion darauf zu verstehen, dass sich im Laufe des Studiums nur wenige Möglichkeiten ergeben, an Forschungsprojekten teilzunehmen und so durch „learning by doing“ in Erhebungsmethoden einsozialisiert zu werden[13], was zu einem Dilemma führt: Man ist darauf angewiesen, durch die Lektüre von theoretischen Texten Anhaltspunkte für die praktische Durchführung zu generieren. Dabei begibt man sich bewusst oder unbewusst auf die Suche nach Rezepten – trotz des allgegenwärtigen „Aber“, dass es solche gar nicht geben kann – und neigt dazu, die „Tipps und Tricks“ verschämt aus der gedruckten Arbeit hinaus zu ver- weisen. Der Sub-Text ist vielleicht eine Möglichkeit, die Hinweise zu benennen, je- doch zugleich Distanz gegenüber der Vorstellung einer direkten Anwendbarkeit auszudrücken.
Den Auftakt des Kapitels (3.1.) bildet eine Schilderung der anvisierten Haltung als Forscher, die den Prozess der Datenerhebung wie auch der späteren Auswertung als Basis „grundiert“. Auch hier werden in einem Subtext Hinweise zum Führen eines Forschungstagebuchs gesammelt. Zu beachten ist, dass im Abschlusskapitel 3.4. die Brücke zur Auswertung geschlagen wird, indem ein bestimmter Diskus- sionszweig der Ethnologie zur Kenntnis genommen wird, der Folgen vor allem für die Haltung beim Schreiben hat. Die Diskussion um die Güte des Vorgehens findet zudem gebündelt für Datenerhebung und Auswertung in Kapitel 5 statt.
3.1. Die Rolle des Forschers und des Vorwissens
„Vielleicht findest Du mich zwischen Zeilen irgendwo“ (Herbert Grönemeyer – Letzte Version)
Die Reflexion der eigenen Rolle ist eine zentrale Forderung an qualitative Forschung. Es gilt die Annahme: „Ohne Subjekt ist Erkennen nicht möglich; infolgedessen ist die Subjektivität des Forschers/der Forscherin in den Forschungs- und Erkenntnisprozess inkorporiert, und zwar in mehrfacher Hinsicht: Zum einen in Form von Vorannahmen, Erkenntnisinteressen, gegenstandsbezogenen Setzungen, Untersuchungsstrategie- und Methodenentscheidungen usw., zum anderen als kompetenzregulierte Anwendung heuristischer Verfahren, analytisch-hermeneu- tische Datenzugriffe und -interpretationen usw.“ (vgl. Fichten/Dreier 2003, Absatz 1). Als Anregung für mein Vorgehen diente die von Alheit (2001, S. 12 f.) beschriebene „ethnographische Haltung“, die er definiert als eine „Disposition zur Welt, die das pädagogisch begegnende ‚Andere’ als Fremdes akzeptiert“. Ähnlich argumentiert Riemann, der mit Blick auf studentische Aufenthalte im Feld eine Haltung empfiehlt, die zu einer „Befremdung der eigenen Praxis“ (Riemann 2004, S. 190) führt und dafür das Führen von Feldprotokollen (siehe Kapitel 3.2.) anregt. [14]
Zur Reflexion der eigenen Rolle gehört auch, sich die Funktion des Vorwissens zu vergegenwärtigen. Entgegen häufiger Vorstellungen, wonach „die Haltung des Interviewers/Wissenschaftlers durch prinzipielle Offenheit gegenüber der Empirie gekennzeichnet ist bzw. unter Ausklammerung des theoretischen Vorwissens als tabula rasa konzeptioniert wird“ (Witzel 2002, Absatz 3[15] ), spreche ich der Position zu, wonach das Vorwissen als untrennbar mit dem Forscher und seinem Vorgehen im Feld verbunden angesehen wird oder wie Kluge/Kelle (1999, S. 17) bezogen auf Kant formulieren: „Es kann keine Wahrnehmung geben, die nicht von Erwartungen durchsetzt ist.“ Somit ist davon auszugehen, dass das Vorwissen einerseits im Prozess der Datenerhebung zum Beispiel beim Aufbau des Frageleitfadens wertvolle Dienste leistet, da es ohne Vorkenntnisse über einen Gegenstand schwierig ist, „intelligente Fragen“ zu stellen (Legewie 1998b, S. 7). Andererseits kann während der interpretierenden Auswertung seine kreative Funktion (vgl. Bachmann 1997) nützlich sein. Doch da es auch „fehlerhaft sein und Vorurteile oder Voreingenommenheiten erzeugen kann“, wird gefordert, „dass der Forscher sich in einem Prozess der Selbstreflexion seine Vorannahmen zum Forschungsgegenstand zu Beginn und während der Studie so weit wie möglich selbst explizit macht und dass er die Vorannahmen auch für andere offen legt“ (Legewie 1998b, S. 7). Alheit (1999, S. 7) bringt den changierenden Umgang mit dem Vorwissen durch die Begriffe „zielstrebige Offenheit“ bzw. „geplante Flexibilität“ auf den Punkt: „Geplant insofern, als gewisse hypothetische Vorannahmen auch über ein neues Forschungsfeld notwendig und sinnvoll sind; ‚flexibel’ und ‚offen’, weil sich im Forschungsprozess diese Vorannahmen ändern können.“ Kluge/Kelle (1999, S. 21) beschreiben das Zusammenspiel zwischen Vorwissen und Forschungsprozess als „eine Art „Zangengriff“, bei dem der Forscher oder die Forscherin sowohl von dem vorhandenen theoretischen Vorwissen als auch von empirischem Datenmaterial ausgeht“.[16]
Meine Vorannahmen zum Thema werden zum einen mittels der Vorstellung und Diskussion der theoretischen Konzepte zu Selbstlernzentren (Kapitel 2), Selbstge- steuertem Lernen Neue Lernkultur und Lernberatung (Kapitel 4) offen gelegt, zum anderen habe ich regelmäßig ein Forschungstagebuch in Form einer Kladde geführt, in die ich Notizen und Interpretationsideen, aber auch aktuelle Zeitungs- artikel aus dem weiteren Umfeld des Themas oder Eindrücke aus der „Kontakt- geschichte“ (wie reagieren die Selbstlernzentren auf Anfragen? siehe S. 29 dieser Arbeit) eingetragen, gesammelt und geschildert habe. Friebertshäuser (1997, S. 517) beschreibt, in einem Forschungstagebuch wird „alles festgehalten, was sich während der Feldforschung ereignet und was die Forscherin oder den Forscher im Forschungsprozess im Feld bewegt. Das können sein: Emotionen [...], Reaktionen [...], Selbstreflexionen, Beschreibungen des Forschungsvorgehens, Hypothesen, Ideen, Gedanken, Fragen und Probleme“ (Friebertshäuser 1997, S. 517). Auch Marotzki (1996, S. 59) betont die Nützlichkeit zur Dokumentation der „Prozessualität des gesamten Forschungsprozesses“.
3.1.1. Zum Führen eines Forschungstagebuchs
- Wie geht es mir im Projekt? Was lerne ich im Projekt? Was habe ich bisher gelernt? Was fördert mich? Was hindert mich? (Unterbruner 2001)
- alle Beobachtungen und eigenen Gefühle, allgemeine Notizen (z. B. Literatur oder andere Einrichtungen mit ähnlichen Zielen o. ä.) sowie Notizen zur gewählten besonderen Thematik werden aufgeschrieben; das erfordert eine gewisse Disziplin, die sich allerdings beim Schreiben nicht nur erleichternd, sondern auch qualitätssteigernd auswirkt (Lippitz 2004).
- Gliederung nach Ideen, „Lesefrüchten“, Zusammenfassungen, Zitaten, Gedanken zum Projekt (www.ph-freiburg.de).
- Daher ist es wichtig, ein Forschungstagebuch (neben den anderen Aufzeich- nungen) zu führen, in das du dir jeden Tag deine Gedanken, Probleme und Freuden der Forschung, aber auch den Ärger bei dieser einträgst. Dies regt zu ehrlichem Nachdenken über dich selbst und deine Forschung an, aber auch zur Selbstkritik (Girtler o. J.).
- „Dialog mit dem grausamen Selbst“ (Canetti 1981, zitiert nach Altrichter / Posch 1998, S. 27).
- persönlichen Stil entwickeln
- regelmäßig
- mühsam
- private Produkte
- Datum und Ort zu jedem Eintrag
- Absätze, Überschriften, Subüberschriften, Unterstreichungen
- „Ins Heft können auch Dinge, die für den Forschungsprozeß von Belang sind, eingeklebt werden: Gedanken, die man unterwegs auf einem kleinen Zettel notiert hat, Fotografien und Zeichnungen, Kopien von Dokumenten usw.“ So entsteht ein „Steinbruch von Beispielen“ (ebd., S. 31).
- Unterscheidung von beschreibenden und interpretierenden Passagen sowie von theoretischen und methodischen Notizen (ebd., S. 36 f.)
3.2 Teilnehmende Beobachtung
„Der größte Teil der kulturellen Produktion der letzten Jahre wäre durch einfaches Turnen und zweckmäßige Bewegung im Freien mit großer Leichtigkeit zu verhindern gewesen“ (Berthold Brecht).
Plant man als Student, Lernberater zu ihrer alltäglichen Berufspraxis zu interviewen, so ist schnell der Gedanke geboren, parallel dazu Beobachtungssequenzen in das Forschungssetting einzubauen. Denn „während Interviewverfahren und Frage- bogenerhebungen Verhaltensweisen lediglich aus den Angaben der Befragten erschließen, vermag die [...] Beobachtung Verhalten in vivo zu erfassen und zu dokumentieren“ (Friebertshäuser 2003a, S. 505). Auch Lamnek (1995, S. 243) merkt an: „Befragte Personen sind oft nicht imstande, ihr eigenes Verhalten richtig zu beschreiben oder wiederzugeben“: Die Zielsetzung von Friebertshäuser (2003a, S. 521) verklammert beobachtetes Verhalten mit Interpretation: „Die Kunst der teilnehmenden Beobachtung liegt nun darin, zunächst einmal den Sinn und die Bedeutung von Handlungen aus der Perspektive der Erforschten zu erfassen.“ Doch die so alltagsnah erscheinende Tätigkeit des Beobachtens erweist sich – genauso wie das dem alltäglichen Gespräch so ähnlich scheinende Interview – schnell als mit einer Fülle von Problematiken verbunden und berührt erkenntnistheoretische Grundfragen („Was ist eigentlich Wirklichkeit?“).
Versucht man eine nähere Begriffsbestimmung, so ist zunächst festzuhalten: Die Beobachtungsmethode existiert nicht. Friedrichs (1980, S. 273) unterscheidet insgesamt acht Formen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Beobachtungsformen nach Friedrichs (1980, S. 273)
Zunächst scheidet aufgrund meiner Rolle als studentischer Praktikant/Honorarkraft die nicht-teilnehmende Form von vorneherein aus. Auch ist in diesem Zusammenhang das Argument plausibel, dass man überhaupt nicht „nicht teil- nehmen“ kann, sondern dass es sich um ein mehr oder weniger Teilnehmen handelt, das mit der Anwesenheit einhergeht (vgl. Bachmann 2002). Wendet man sich dann ausschließlich der teilnehmenden Beobachtung zu, so stößt man auf eine teilweise scharf geführte Diskussion mit zwei Extrempolen. Auf der einen Seite die „unstrukturierte, freie Feldforschung“, für die – häufig mit einem „anti-metho- dologischen und -theoretischen Affekt“ (Lüders 1995, S. 318) – Girtler ein typischer Vertreter ist und die sich aufgrund ihrer literarisch-anekdotischen Eigenschaften Vorwürfen wie „Ethnofiction“ oder „Mogelpackung“ ausgesetzt sieht. Den Gegenpol bilden systematische, quantifizierende Beobachtungen mit vorgefertigten Katego- rienschemata, Häufigkeitszählungen und standardisierten Protokollbögen, die wiederum als eine „Geheimsprache“ verwendende „Verandasoziologie“ oder
„Schreibtischsoziologie“ (Lamnek 1993, S. 309) kritisiert werden (vgl. auch Aster/Repp 1989, S. 122 f.), so dass man wohl sagen kann, dass sich hier die Debatte zwischen quantifizierender und qualifizierender Sozialforschung eingeschrieben hat. Die folgende Tabelle bündelt basierend auf einem Artikel von Lindner (1984, ergänzt um Girtler 1984 und Reichertz 1989), der die quantifizierende Variante als „nicht-interaktiv“ und die qualifizierende Spielart als „interaktiv“ bezeichnet, einige typische Argumente der Diskussion.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Nicht-interaktive und interaktive teilnehmende Beobachtung im Vergleich (Tabelle: JM, erstellt nach Lindner 1984, Girtler 1984 und Reichertz 1989)
Da die Bedeutung von Situationen immer abgeleitet ist – wäre sie es nicht „sondern als solche vorhanden, dann würden alle Menschen, die an denselben sozialen Interaktionen partizipiert haben, Dingen dieselben Bedeutungen zuschreiben, das heißt ihre Objekte in der gleichen Weise wahrnehmen“ (Merkens 1989, S. 12) –, das Vorwissen nicht ausgeschaltet werden kann (siehe Kapitel 3.1.) und man bei der nicht-interaktiven Ausrichtung Gefahr läuft, dass mögliche „Ängste in die Unter- suchungsergebnisse Eingang finden, in Form von Verzerrungen, Vorurteilen, ‚Dramatisierungen’, ‚Projizierungen’ und Selbstrechtfertigungen“ (Lindner 1984, S. 60), wird in dieser Arbeit der interaktiven Variante zugesprochen. Diese versucht, die Reziprozität der Beobachtungssituation bewusst zu machen. Die idealtypisch geforderte Distanz des Forschers zur Situation wird ersetzt durch die Vorstellung einer „dialektischen Spannung von Nähe und Distanz“ (ebd., S. 64). Die Präsen- tation der Identität des Forschers wird zur Voraussetzung von Datengewinnung und man geht davon aus, dass die erste Begegnung mit dem Forschungsobjekt ein
„Datum ersten Ranges“ (ebd., S. 52) ist. Breidenstein (1999, S. 14) beschreibt, dass „es schon viel über das Untersuchungsfeld aussagt, wie es mit dem Beobachtet- werden umgeht“ und Heeg (1996, S. 48) schildert sogar – idealtypisch – einen Lebenslauf der Forschungsinteraktionen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Lebenslauf von Forschungsinteraktionen (Heeg 1996, S. 48)
Auffällig beim Literaturstudium zum Thema Teilnehmende Beobachtung ist, dass – im Gegensatz zu Abhandlungen über Interviews – nur selten Forscher- oder Beo- bachterprotokolle explizit zugänglich gemacht werden[17], was ein Grund dafür sein könnte, dass Vorwürfe wie fehlende Objektivität oder Beobachterselektivität nicht verstummen, obwohl die teilnehmende Beobachtung in wenig erforschten Feldern ohne Alternative ist: „Sie ist wie keine andere Methode dazu geeignet, etwas zu entdecken, das man vorher nicht gewusst hat – genauer: eine Fragestellung zu entwickeln, von der man vorher noch nicht wusste, dass dies eine wichtige Frage ist“ (Bachmann 2002).
3.2.1. Verortung der eigenen Beobachterrolle
Meine Rolle in SLZ 1 ähnelt – legt man die Typologie von Schwartz/Schwartz und Gold (zit. nach Lamnek 1995, S: 263) zugrunde, die a) völlige Identifikation mit dem Feld, b) Teilnehmer als Beobachter, c) Beobachter als Teilnehmer und d) reiner Beobachter ohne Interaktion mit dem Feld unterscheiden – der des Teilnehmers als Beobachter, der „primär Teilnehmer der Feldsituation und sekundär Beobachter“ (ebd., S. 264) ist. Im Alltag stellte und stellt[18] sich dies so dar, dass an manchen Tagen – zum Beispiel „entlastet“ durch den Fakt, dass drei andere LernberaterInnen anwesend waren – viele Beobachtungen möglich waren. An anderen Tagen über- wog die Rolle als Teilnehmer und Honorarkraft, wodurch die Protokolle eher mit der Reflexion des eigenen Handelns (in Anlehnung an die von Reimann (s.o., S. 24) vorgeschlagenen Feldprotokolle) denn mit der Darstellung des Verhaltens der LernberaterInnen beschäftigt sind und so vielleicht der Gefahr des „going native“, die Lamnek (vgl. 1995, S. 270) für den Teilnehmer als Beobachter – wenn auch in abgeschwächter Form gegenüber der völligen Teilnahme – sieht, entgegenwirken.
Die Unsicherheit, wie mit spontan entstehenden Gesprächen mit Lernberatern um- zugehen sei, bei denen ich im Anschluss oft das Gefühl hatte, etwas Wichtiges über Lernberatung, Selbstlernzentren oder die impliziten Organisationsregelungen erfahren zu haben, wurde durch die Lektüre von Kleining gemindert, der derartige Gespräche als spontan rezeptive und provozierte rezeptive Interviews (vgl. Kleining 1995, S. 127)[19] bezeichnet. So ergaben sich zum Beispiel häufig im Anschluss an eine typische Frage zum Arbeitsbeginn wie „Was gibt’s Neues?“ (die auf der Gegen- seite mit Nachfragen nach dem Fortgang meiner Diplomarbeit korrespondierten) oft spannende Berichte: Der oder die LernberaterIn erzählte, ich beschränkte mich auf aktives Zuhören (vgl. Lamnek 1995, S. 83) und protokollierte anschließend den Inhalt aus dem Gedächtnis, was akzeptabel ist, da die sprachliche Form in diesem Zusammenhang meist weniger interessant ist (vgl. Kleining 1995, S. 127).
Konkrete Fragen für die Feldprotokolle in SLZ1 sind die folgenden, teils quantifizierend-auszählenden, teils qualitativ-offenen Fragen:
- Was tun die Lernberater im Laufe eines Tages? Wie häufig treten sie in Kontakt mit Lernern, wie häufig werden sie gerufen, wie groß sind die Anteile an organisatorischer (Schreibtisch-, Telefon-)Arbeit?
- Wie gehen Lernberater mit außergewöhnlichen Situationen („schwierigen Lernern“) um? Wer wird als „schwieriger Lerner“ bezeichnet?
- Was sind die Themen, wenn ein Lernberater von einem Lerner gerufen wird, weil er eine Frage oder ein bestimmtes Problem hat?
- Wie verläuft eine Eingangsberatung, also die zu Beginn stattfindende, ausführliche Zwei-Stunden-Beratung?
3.2.2. Zum Schreiben von Feldprotokollen
- mit großer Aufmerksamkeit auf „das Fremde“ achten
- Bereitschaft, ein Problem auch „mit den Augen des anderen“ zu sehen
- Wahrnehmungsperspektiven vergleichen
- intensives biographisches Interesse an den Betroffenen und die Bereitschaft, für thematisch offene Gespräche ohne Zeitdruck (vgl. Alheit 2001)
- Regelmäßig oder einmalig? Sind Situationen und Interaktionen typisch?
- Reaktionen der Teilnehmer auf außergewöhnliche Verhaltensweisen beachten
- Gibt es Differenzen zwischen Gesagtem und Getanem? (vgl. Girtler 1984)
- Ist es eine Aufzeichnung „nur für mich“ oder für eine spezifische Wissen- schaftler-Gemeinde? Wie würde die Beschreibung aussehen, wenn ich sie für einen privaten Kontext machen würde? Berichte ich in einer Terminologie, die sich auf (äußere) Verhaltens- und Geschehensaspekte bezieht oder thema- tisiere ich auch meine inneren Reaktionsweisen (Gefühle, Eindrücke, Asso- ziationen) Wie kann ich letztere so in den Beobachtungsprotokollen dokumen- tieren, daß sie im Sinne einer Problemaufhellung (als repräsentative Teil- nehmer-Reaktion, als Interpretations-Heuristik o. ä.) genutzt werden können?
- Sind unterschiedliche Text-Formen des Berichtens alternativ oder parallel möglich (Chronik, Story)? (vgl. Breuer 1996, S. 140 f.)
- Raymond Queneau (1989): Stilübungen
[...]
[1] Dieser Prozess vollzieht sich so dynamisch, dass zum Beispiel eine kürzlich erschienene Publikation von Henning Pätzold mit dem Titel „Lernberatung und Erwachsenenbildung“ keine Berücksichtigung mehr fand.
[2] Heid zählt es zu den „Verhängnissen“ der Erziehungswissenschaft, dass „Mikro- und Makroanalysen zu unabhängig voneinander konzipiert, durchgeführt und ausgewertet werden“ (Heid 1990, S. 30).
[3] Schwarz (2003, S. 19) vertritt zudem mit Blick auf die mich nur am Rande interessierende Frage (siehe unten) nach der Professionalität die Auffassung: „Unter der Perspektive professionellen Handelns in der Erwachsenenbildung sind somit mindestens zwei miteinander verbundene Ebenen zu berücksichtigen, von denen die eine mit dem unmittelbaren, didaktisch-methodischen Handlungsfeld des Lehrenden, die andere mit den durch die Einrichtung gesetzten Rahmenbedingungen gegeben ist.“
[4] Der Begriff wird häufig als rein programmatisches Schlagwort (siehe als Beispiel Forum Bildung Hessen, o.J., S. 12) verwendet. Eine Ausnahme bildet Wack 2000, der Selbstlern- zentren in England detailliert beschreibt.
[5] Diskutiert man die lerntheoretischen Grundlagen ausführlicher, gerät man schnell in einen normativen Diskurs, der meiner Absicht, zunächst einmal bestehende Muster von Selbst- lernzentren und Lernberatung vergleichend zu beschreiben, insofern hinderlich wäre, da leicht die Neigung bestehen könnte, bestehende Praxis als defizitär zu kennzeichnen. Vgl. in diesem Zusammenhang Frigga Haugg (2003, S. 29), die in einer ausführlichen Diskussion Holzkamps normative Lerntheorie problematisiert, da seine Unterscheidung von defensiven und expansivem Lernen dazu neige, „die meisten realen Lernvorgänge als defizitär erscheinen“ zu lassen. Ich nehme Selbstgesteuertes Lernen also als reale Tatsache, als einen im Alltag häufig anzutreffenden „durchschnittlichen Lernprozess“ (ebd. S. 34), der – obwohl er wie viele andere Lernprozesse auch aus der Sicht Holzkamps vermutlich nicht „expansiv“ ist – dennoch eine Betrachtung lohnt.
[6] Rumpf (2004, S. 90) beklagt, dass Befragte in Forschungsberichten wenig sichtbar werden und kritisiert: „Eine Entmündigung des Praxiswissens ist dabei auch am Werk. Man (Anm.: JM: TheoretikerInnen und PraktikerInnen) begnügt sich mit dem Leben auf getrennten Ster- nen. Der Preis, um dem vermeintlichen Sumpf der Subjektivität zu entkommen, ist hoch.“
[7] Ausnahmen sind der automatischen Korrekturfunktion des Textverarbeitungsprogramms geschuldet.
[8] An anderer Stelle diskutiert Hoffmann (1971) die Verzahnung von Selbstlernzentren mit der kommunalen Kulturarbeit.
[9] Das SLZ in Wuppertal wurde unter dem Titel „Fachbereich 0“ als Standardangebot der VHS verankert und sollte den Einstieg in die Weiterbildung fördern (vgl. Jüchter 1979).
[10] Zwar finden sich im Sammelband von Otto (1979) Beispiele selbstorganisierter Gruppen- arbeit (z.B. Fabrik Hamburg), diese firmieren jedoch nicht unter dem Begriff SLZ.
[11] Schäffter (1981, S. 113/114) nennt beispielsweise aktivierende 'Lernenviroments' für Berufsgruppen mit Möglichkeiten zur Kreativitätsentfaltung, zeitlich/organisatorisch unregle- mentierte Arbeitsformen für Gruppen, Kontaktzentren für Gruppen, die einen öffentlichen Rahmen für gesellschaftspolitische, sozio-kulturelle, sozialpolitische oder künstlerische Initia- tiven suchen.
[12] Der angesprochene „Quanti-Quali“-Dualismus hinterlässt sogar im universitären Alltag seine Spuren. So sorgte die Frage „Was ist denn nun Deine Kernhypothese?“, die mir eine „quantitativ“ orientierte Kommilitonin zu Beginn meiner Arbeit stellte, für Verwirrung auf beiden Seiten. Mich irritierte die Selbstverständlichkeit dieser Frage, mein Gegenüber war von meiner „Offenheit“ und der Antwort verwirrt, wonach ich vielleicht erst am Ende des Projekts zu einer fundierten Hypothese kommen würde. Hierzu Legewie (1998b, S. 6): Da „die große Stärke [qualitativer Untersuchungen] das Entdecken völlig neuer und auch unerwarteter Zusammenhänge und die Entwicklung neuer Theorien [ist], gibt es in qualitativen Untersuchungen keine vorab formulierten, aus bekannten Theorien abgeleitete Vorhersagen, die als Null- oder Alternativ-Hypothesen zur Überprüfung anstehen.“
[13] Die notwenigen kleinen Seminargrößen stellen sich nur äußerst selten ein.
[14] siehe auch Breuer (1996, S. 15), der von einer „Exotisierung des Vertrauten“ spricht.
[15] Kluge / Kelle (1999, S. 12) bezeichnen dies als „induktivistisches Selbstmissverständnis“.
[16] Hieran anschließen ließen sich Überlegungen zu einer dritten Art der Hypothesenbildung neben Induktion und Deduktion, nämlich die Abduktion nach Charles Sanders Peirce: „Eine Abduktion generiert also eine mögliche Erklärung für die überraschende Tatsache C, indem eine neue Regel A konstruiert wird, deren Geltung die Tatsache als selbstverständlich erscheinen lassen würde. Das erfordert eine Umdeutung und Neubewertung empirischer Phänomene, ein Vorgang, so Peirce, der ohne die Kreativität des Forschers oder der Forscherin, ohne einen spielerischen Umgang mit Daten und Theorien gar nicht denkbar ist.“ (Kluge / Kelle 1999, S. 23) – oder wie Alheit (1999, S. 8) gleichfalls im Anschluss an Peirce formuliert, Abduktion sei „die überraschende Fähigkeit, etwas in Beziehung zu setzen, was zusammenzubringen wir uns vorher nicht hätten träumen lassen“.
[17] Eine Ausnahme bilden Gerdes/von Wolffendorf-Ehlert (1979). Die von mir geschriebenen Protokolle können im Anhang dieser Arbeit eingesehen werden.
[18] Da ich den Wert von Protokollen als Reflexionsmittel auch der eigenen Arbeit schätzen gelernt habe, plane ich, auch nach Ende der Diplomarbeit weiterhin zu schreiben. Im Anschluss an Alheit (2001, S. 15) lässt sich damit vielleicht der „Erfahrung des Veraltens und Austrocknens beruflicher Fähigkeiten und Fertigkeiten“ entgegenwirken.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst folgende Hauptpunkte: Einleitung; Selbstlernzentren – Idee und Geschichte (mit Unterpunkten zu den 70er Jahren und Ende der 80er/Anfang der 90er Jahre); Datenerhebung – Feldforschung (mit Unterpunkten zur Rolle des Forschers, teilnehmender Beobachtung und Interviews); Neue Lernkultur und Lernberatung (mit Unterpunkten zu Selbststeuerung, didaktischen Arrangements und Auswirkungen auf Institutionen und Profession); Methodisches zur Datenauswertung; Falldarstellung; Fazit: Zusammenfassung und Ausblick; Literaturverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; Erklärung.
Was ist das Hauptthema der Einleitung?
Die Einleitung beschreibt das persönliche Interesse des Autors an Lernberatung und selbstgesteuertem Lernen, seinen Hintergrund in QINEB und die Motivation, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Sie betont das Fehlen von Beschreibungen des "WIE" von Lernberatung in der Praxis und die Notwendigkeit, diese zu analysieren.
Welche methodischen Ansätze werden in Kapitel 3 "Datenerhebung – Feldforschung" verwendet?
Kapitel 3 beschreibt die methodischen Ansätze der Feldforschung, einschließlich teilnehmender Beobachtung und Interviews. Es diskutiert die Rolle des Forschers, die Bedeutung von Vorwissen und die Reflexion der eigenen Rolle im Forschungsprozess. Es enthält auch heuristische Tipps zur Durchführung der Datenerhebung.
Welche Argumentationslinien werden bezüglich neuer Lernkultur und Lernberatung in Kapitel 4 diskutiert?
Kapitel 4 behandelt Argumentationslinien zur neuen Lernkultur und Lernberatung, einschließlich des Begriffs der Selbststeuerung, Wirkungen auf didaktische Arrangements (Individualisiertes vs. soziales Lernen, Erhöhung metakognitiver Anteile, Lernen mit Neuen Medien), Wirkungen auf Institutionen und Profession sowie Konzepte von Lernberatung.
Was sind die Hauptpunkte von Kapitel 5, "Methodisches zur Datenauswertung"?
Kapitel 5 behandelt die methodischen Aspekte der Datenauswertung, einschließlich Inhaltsanalyse, Kategorien- und Typenbildung, Interpretationshilfen und Gütekriterien.
Was wird in Kapitel 6 über die Falldarstellung gesagt?
Kapitel 6 präsentiert eine Falldarstellung mit makrostrukturellen Rahmungen, Details zur Lernberatung (Zeit, Themen, eingesetzte Materialien, soziale Implementation, Kompetenzen) und eine Diskussion der Ergebnisse. Es behandelt auch die Systematisierung von Lernberatung und die Rückbindung an die Diskussion um selbstgesteuertes Lernen.
Was sind die wichtigsten Punkte der historischen Entwicklung von Selbstlernzentren (Kapitel 2)?
Kapitel 2 gibt einen Überblick über die historische Entwicklung von Selbstlernzentren in Deutschland, von den 70er Jahren bis Ende der 80er/Anfang der 90er Jahre. Es werden gesellschaftliche Rahmenbedingungen, didaktische Konzeptionen und die Rolle der Profession in den verschiedenen Zeitperioden beleuchtet.
Welche verschiedenen Beobachtungsformen nach Friedrichs (1980, S. 273) werden in Kapitel 3.2 erwähnt?
Folgende Formen von Beobachtungen werden erwähnt: teilnehmende vs. nicht-teilnehmende; offene vs. verdeckte; systematische vs. unsystematische; Selbst- vs. Fremdbeobachtung; standardisierte vs. nicht standardisierte; experimentelle vs. nicht experimentelle; Feld- vs. Laborbeobachtung; indirekte vs. direkte.
Welche Kritikpunkte gibt es am quantitativen Ansatz der Teilnehmende Beobachtung?
Die quantifizierende Spielart wird als „Geheimsprache“ verwendende „Verandasoziologie“ oder „Schreibtischsoziologie“ kritisiert.
- Arbeit zitieren
- Jürgen Mai (Autor:in), 2004, Pädagogische Konzepte für selbstgesteuertes Lernen - eine qualitative Erhebung zur Lernberatung in Selbstlernzentren, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109544