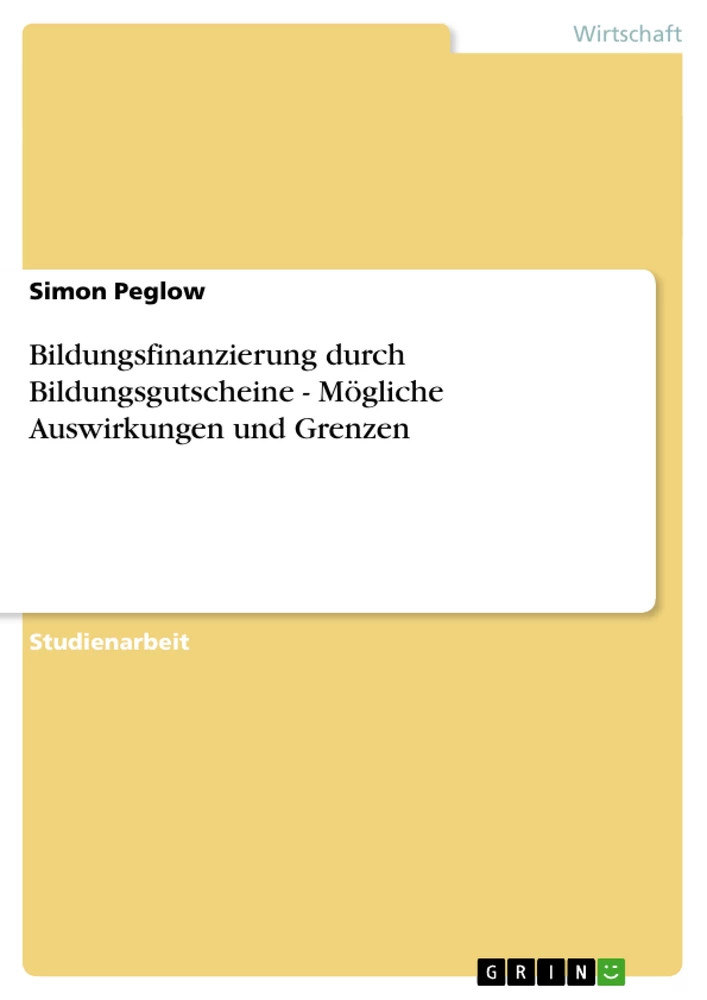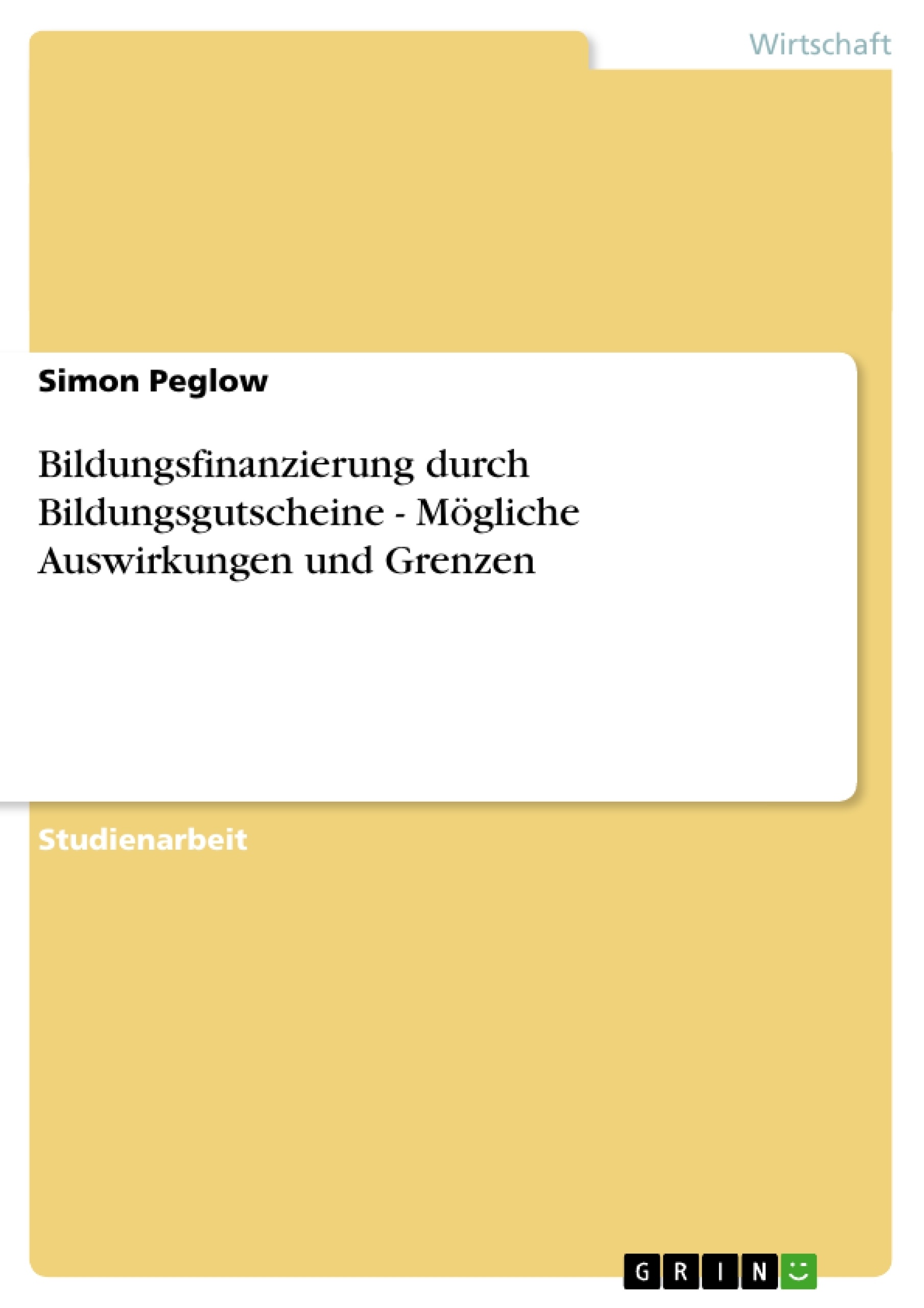Inhaltsverzeichnis
1Einleitung
2Bildungsgutscheine als Instrument der Bildungsfinanzierung
2.1.Ziele und Befürworter
2.2.Kritische Betrachtung
2.2.1.Relative Produktivität
2.2.2.Vouchers, Peergruppeneffekte und Sorting
2.2.3.Cream skimming und die Frage nach dem Voucher-Design
3Zusammenfassung
1 Einleitung
Nicht zuletzt aufgrund schlechter Ergebnisse deutscher Schüler bei internationalen Vergleichstests wie PISA, findet in Deutschland wie in anderen Ländern verstärkt eine politische aber auch akademische Debatte darüber statt, wie das Bildungssystem reformiert werden kann. Aus ökonomischer Sicht stellt Bildung kein öffentliches Gut dar. Ein Ausschluß vom Konsum ist möglich und es existiert Rivalität im Konsum. Es muß daher andere Gründe für die Dominanz des Staates bei der Bereitstellung von Bildung geben. Neben der Tatsache, daß das Bildungswesen aus historischer Sicht stark staatlich geprägt war und dies bis heute ist, können etwa positive externe Effekte der Bildung oder Gerechtigkeitsvorstellungen als Begründungen für die starke Stellung des Staates im Bildungswesen dienen. Es kann aber auch die Auffassung vertreten werden, die Erziehung der Schüler zu demokratischen und mündigen Bürgern müsse Aufgabe des Staates sein. Da die akademische und politische Debatte über Reformen des Bildungssystems sehr stark geprägt ist von Vorschlägen zur Stärkung von Marktelementen, soll hier das Konzept der Bildungsgutscheine kritisch beleuchtet werden. Dazu werden neuere theoretische Beiträge sowie empirische Studien zu dieser Thematik und ihre Schlußfolgerungen über mögliche Auswirkungen und Risiken des Instruments der Bildungsgutscheine betrachtet.
2 Bildungsgutscheine als Instrument der Bildungsfinanzierung
2.1. Ziele und Befürworter
Die Bildungsinstitutionen wurden bisher direkt von staatlicher Seite mit Finanzmitteln aus dem Steueraufkommen ausgestattet. Doch das staatliche Bildungsangebot geht nicht auf die Bedürfnisse von Schülern und Eltern ein, wie es der Fall wäre, wenn diese Kunden der Schulen sind. So sind viele Haushalte zunächst auf das staatliche Angebot angewiesen, denn eine Alternative im privaten Bereich bietet sich für die meisten nicht. Bildungsgutscheine (engl. vouchers) gelten als alternative Finanzierungsform des staat- lichen und privaten Schulwesens. Dabei werden die Eltern vom Staat mit Kaufkraft in Form zweckgebundener Vouchers ausgestattet. Es erfolgt damit ein Wechsel von der Objekt- zur Subjektfinanzierung, der es den Individuen ermöglichen soll aus der Rolle des bloßen Abnehmers staatlicher Bildungsangebote herauszutreten. Durch die verstärkte Bereitstellung von Bildung über den Markt soll ein Beitrag zur allokativen wie auch produktiven Effizienz des Bildungssystems geleistet werden. Durch die Wettbewerbssituation sollen die Anbieter gezwungen werden die Bildung nicht nur kostenminimal, sondern auch den Präferenzen der Nachfrager entsprechend anzubieten.
So soll die Wahlfreiheit zunehmen und das Bildungsangebot, gesteuert durch die Nachfrage, breiter werden. Befürworter von Vouchern wie etwa Elterninitiativen, katholische Bildungseinrichtungen oder Marktwirtschaftler führen an, daß durch das marktwirtschaftliche Prinzip ein kostenbewußteres Verhalten der Schulen und durch die gesteigerte Konkurrenz eine bessere Anpassung des Bildungsangebots an aktuelle Bedürfnisse erreicht werden kann. Weiter wird argumentiert, daß die Wahlfreiheit und auch die Aufstiegschancen besonders für einkommensschwache Haushalte ansteigen würden. Die erhofften Vorteile durch die Einführung von Vouchern sollen im folgenden ökonomisch genau geprüft und mögliche Risiken aufgezeigt werden.
2.2. Kritische Betrachtung
In der akademischen Debatte über das Konzept der Bildungsgutscheine werden u.a. die möglichen Auswirkungen solcher Voucher in Bezug auf die schulischen Leistungen sowie die Aufteilung der Schüler auf die Schulen unterschiedlich eingeschätzt. Praktische Erfahrungen darüber, welche Effekte der Einsatz von Bildungsgutscheinen hat, existieren bisher nur wenige. In den USA wurden Versuche nur in beschränkter Form auf lokaler Ebene durchgeführt, d.h. nicht alle Schüler, die prinzipiell für ein Voucherprogramm in Frage kamen, erhielten einen Gutschein. Im Moment spielen Vouchers also noch eine geringe Rolle im amerikanischen Bildungssystem. In Chile und Neuseeland existieren allerdings Erfahrungen mit landesweiten Programmen. Die geringe Erfahrung mit Gutscheinsystemen bedeutet für die USA , daß Daten über Voucher nur beschränkt verfügbar sind und neuere Studien[1] zeigen, daß anhand dieser Daten keine klaren Aussagen über die gesamten Auswirkungen von Vouchern getroffen werden können. Ladd (2002) ist der Ansicht, daß vor der Durchführung groß angelegter Voucherprogramme in den USA zur Informationsgewinnung über ihre Effekte, den Programmen in Chile und Neuseeland mehr Beachtung geschenkt werden muß.
2.2.1. Relative Produktivität
Ein Ziel von Vouchern ist es, die schulischen Leistungen zu erhöhen. Es wird argumentiert, daß durch die Einführung von Vouchern Schüler aus dem öffentlichen in den privaten Sektor wechseln werden. Damit steige die Gesamtproduktivität an, da Privatschulen produktiver seien bei der Produktion schulischer Leistungen. Um Unterschiede bei den schulischen Leistungen von Schülern im öffentlichen und privaten Sektor bei selbem familiären Hintergrund zu untersuchen, stützen sich Coleman, Hoffer und Kilgore (1982) auf Daten der High School and Beyond Survey HSB. Sie folgern, daß öffentliche Schulen beim Generieren schulischer Leistungen ineffizient sind und Privatschulen dies besser können. Neal (2002) führt an, daß diese Beziehung zwischen Privatschulen und schulischen Leistungen durch bestimmte Eigenschaften der Schüler und Familien zustande kommen könnte, die nicht erfaßt wurden aber sowohl die Wahl der Schule als auch die schulischen Leistungen beinflussen. Auch Evans und Schwab (1995) stützen sich bei ihrer Analyse auf die Daten der HSB. Sie kommen zu dem Schluß, daß katholische Privatschulen einen Anstieg der schulischen Leistungen relativ zum öffentlichen Sektor mit sich bringen. In den USA ist ein Großteil der Privatschulen unter katholischer Trägerschaft. Dies hat in der Vergangenheit Voucher-Kritiker dazu veranlaßt, auf eine Trennung von Kirche und Staat zu bestehen und die indirekte Finanzierung von solchen Privatschulen zu verhindern. Ein Urteil des US Supreme Court kam jedoch zu dem Schluß, daß es keine verfassungsmäßigen Bedenken bei der indirekten Finanzierung religiöser Schulen gibt.
Neal (1997a) benützt einen anderen Datensatz, um die Beziehung zwischen schulischer Leistung und katholischen Schulen zu untersuchen. Die Longitudinal Survey of Youth 1979 befragte 12000 Schüler zwischen 14 und 22 Jahren. Im Gegensatz zu Coleman et alt.(1982) und Evans und Schwab (1995) kommt Neal zu dem Schluß, daß die Leistungszuwächse durch den Besuch katholischer Schulen für bestimmte ethnische Gruppen höher sind als für andere. Der Effekt des Besuchs einer katholischen Schule wird von Neal für Afroamerikaner und Schüler spanischer Abstammung mit einem Anstieg der High School Abschlußraten dieser Gruppen um 26 Prozentpunkte in den Großstädten beziffert. Für weiße Schüler in Großstädten können nur geringe Zuwächse gefunden werden. Schüler aus den meist besser situierten Vororten jedoch zeigen unabhängig von ihrer ethnischen Gruppe keinerlei Zuwächse bei der schulischen Leistung durch den Besuch katholischer Schulen. Grogger und Neal (2000) kommen mit einem anderen Datensatz zu ähnlichen Ergebnissen. Sie finden heraus, daß der Besuch katholischer Schulen die Abschlußrate ethnischer Minderheiten um 18 Prozentpunkte erhöht. Auch bei ihnen sind die Zugewinne für weiße Schüler in den Städten gering und in den Vorstädten zeigen sich für keine ethnische Gruppe Zugewinne. Studien über die relative Produktivität von privaten und öffentlichen Schulen stützen sich auch auf Voucher- Experimente wie dem Milwaukee Parental Choice Program. Dieses war nicht groß angelegt, d.h. nur ein geringer Teil der Schüler, die eigentlich für das Programm in Frage kämen, erhielten tatsächlich Voucher. Nach Ladd (2002) waren bis Ende der neunziger Jahre nur 1,5% der Schüler des Bezirks am Milwaukee- Programm beteiligt. Witte, Stern und Thorn (1995) konnten keine signifikanten Leistungszugewinne von am Milwaukee-Programm teilnehmenden Schüler im Vergleich zur Zufallsstichprobe von Schülern im öffentlichen Sektor finden. Rouse (1998), die berücksichtigen konnte, daß viele Schüler den ihnen angebotenen Voucher nicht nutzten, fand heraus , daß das Milwaukee- Programm geringe Leistungszuwächse in Mathematik aber keine Zugewinne beim Lesen zur Folge hat.
Im Gegensatz zum von der öffentlichen Hand getragenen Milwaukee- Projekt gab es auch kleinere Voucher- Experimente, die von privater Seite finanziert wurden. Beispiele hierfür gibt es aus Dayton, Ohio, New York City und Washington D.C. Die Schüler der Kontroll- und der Voucher- Gruppe wurden bei diesen Projekten jährlich getestet. Die private Finanzierung ermöglichte ein Einlösen der Voucher auch bei religiösen Schulen. Gestützt auf die Daten von New York, Washington und Dayton finden Howell und Peterson (2002) keine Anhaltspunkte dafür, daß zwischen öffentlichen und privaten Schulen für alle ethnischen Gruppen ein Unterschied in den schulischen Leistungen besteht. Schüler, die in den privaten Sektor wechselten brachten im Durchschnitt keine höheren schulischen Leistungen als die Schüler im öffentlichen Sektor. Doch auch hier zeigt sich wieder der zuvor schon beobachtete Effekt, daß einige Gruppen in ihren Leistungen vom Voucher profitieren: Für afroamerikanische Schüler waren Leistungs- zuwächse zu beobachten, wenn auch die Muster der Leistungsunterschiede über die verschiedenen Klassen hinweg nicht beständig waren. Im Gegensatz zu den Ergebnissen von Neal (1997a) allerdings zeigen weiße oder Schüler spanischer Abstammung bei privat finanzierten Vouchers keine Unterschiede in der Leistung. Ladd (2002) weist jedoch darauf hin, daß die Leistungszuwächse bei Afroamerikanern auf den Wechsel in eine Privatschule zurückzuführen sind und nicht auf die Tatsache, daß Vouchers eingeführt wurden. Schließlich war nach einigen Jahren nur noch ein Teil der Schüler mit Voucher auch noch auf einer Privatschule. Innerhalb der Gruppe der Afroamerikaner existiert bei der Frage der Inanspruchnahme des Vouchers weiter einselection bias, d.h. bestimmte Eigenschaften der Schüler verändern die Wahrscheinlichkeit, daß ein Voucher tatsächlich wahrgenommen wird. Dies führt dazu, daß nur ein bestimmter Teil und nicht alle einkommensschwachen Afroamerikaner einen Leistungszuwachs zeigen. Ladd (2002) führt an, daß bei einem größer angelegten Voucherprogramm nicht klar ist, ob dieselben positiven Effekte auftreten. Da der Erfolg der Privatschulen bei Afroamerikanern nicht auf weniger Bürokratie und mehr Selbstverwaltung zurückgeführt werden kann (davon würden alle Gruppen profitieren), besteht die Möglichkeit, daß die Leistungszuwächse dieser (Unter-) Gruppe auf der Tatsache beruhen, daß speziell in katholischen Schulen ein diszipliniertere Schülerschaft ist und Schüler, deren Eltern Gebühren zahlen, motivierter sind.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text "Inhaltsverzeichnis"?
Der Text befasst sich mit Bildungsgutscheinen als Instrument der Bildungsfinanzierung. Er untersucht die Ziele und Befürworter von Bildungsgutscheinen, betrachtet sie kritisch und geht auf Aspekte wie relative Produktivität, Peergruppeneffekte, Sorting und Cream Skimming ein.
Was sind die Hauptziele von Bildungsgutscheinen, laut dem Text?
Laut dem Text zielen Bildungsgutscheine darauf ab, die Wahlfreiheit der Eltern zu erhöhen, das Bildungsangebot zu diversifizieren und sowohl die allokative als auch die produktive Effizienz des Bildungssystems zu verbessern. Sie sollen auch ein kostenbewussteres Verhalten der Schulen fördern und die Konkurrenz zwischen den Anbietern steigern.
Welche Kritikpunkte an Bildungsgutscheinen werden in dem Text diskutiert?
Der Text diskutiert Kritikpunkte wie mögliche negative Auswirkungen auf schulische Leistungen, die Aufteilung der Schüler auf Schulen, Peergruppeneffekte, Sorting, Cream Skimming (d.h. die Bevorzugung von leistungsstarken Schülern) und Fragen zum Design von Bildungsgutscheinen.
Was sagt der Text über die Erfahrungen mit Bildungsgutscheinen in anderen Ländern?
Der Text erwähnt, dass es in den USA bisher nur begrenzte Erfahrungen mit Bildungsgutscheinen auf lokaler Ebene gibt. Er verweist auf Chile und Neuseeland als Länder mit landesweiten Programmen und betont, dass die geringe Erfahrung in den USA die Datenlage einschränkt und keine klaren Aussagen über die Gesamtauswirkungen von Bildungsgutscheinen zulässt. Ladd (2002) wird zitiert, der eine stärkere Beachtung der Programme in Chile und Neuseeland fordert, bevor groß angelegte Programme in den USA durchgeführt werden.
Welche Studien werden im Text erwähnt, um die relative Produktivität von öffentlichen und privaten Schulen zu untersuchen?
Der Text erwähnt Studien von Coleman, Hoffer und Kilgore (1982), Neal (2002), Evans und Schwab (1995) und Neal (1997a), die sich auf Daten wie die High School and Beyond Survey (HSB) und die Longitudinal Survey of Youth 1979 stützen, um die schulischen Leistungen von Schülern im öffentlichen und privaten Sektor zu vergleichen.
Welche Erkenntnisse lassen sich aus den Studien zur relativen Produktivität ziehen?
Die Studien kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Einige deuten darauf hin, dass Privatschulen produktiver sind als öffentliche Schulen, während andere zeigen, dass die Leistungszuwächse vom ethnischen Hintergrund der Schüler abhängen. Insbesondere afroamerikanische Schüler scheinen in katholischen Privatschulen von höheren Abschlußraten zu profitieren. Die Ergebnisse sind jedoch nicht einheitlich und es wird auf mögliche *selection bias* und andere Faktoren hingewiesen, die die Ergebnisse beeinflussen könnten.
Was wird über das Milwaukee Parental Choice Program berichtet?
Das Milwaukee Parental Choice Program war ein Voucher-Experiment, das jedoch nur einen kleinen Teil der potenziellen Teilnehmer erreichte. Studien zu diesem Programm zeigten keine signifikanten Leistungszugewinne der teilnehmenden Schüler im Vergleich zu Schülern im öffentlichen Sektor.
Welche Rolle spielt die private Finanzierung von Voucher-Experimenten?
Der Text erwähnt, dass privat finanzierte Voucher-Experimente (z.B. in Dayton, Ohio, New York City und Washington D.C.) es ermöglichten, Voucher auch bei religiösen Schulen einzulösen. Die Ergebnisse zeigen, dass es im Durchschnitt keine Leistungsunterschiede zwischen öffentlichen und privaten Schulen für alle ethnischen Gruppen gab. Allerdings profitierten afroamerikanische Schüler von Leistungszuwächsen, was jedoch auf den Wechsel in eine Privatschule zurückzuführen sein könnte und nicht auf die Einführung von Vouchern selbst. Es wird auch auf *selection bias* hingewiesen, der die Ergebnisse beeinflussen könnte.
- Citar trabajo
- Simon Peglow (Autor), 2005, Bildungsfinanzierung durch Bildungsgutscheine - Mögliche Auswirkungen und Grenzen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109571