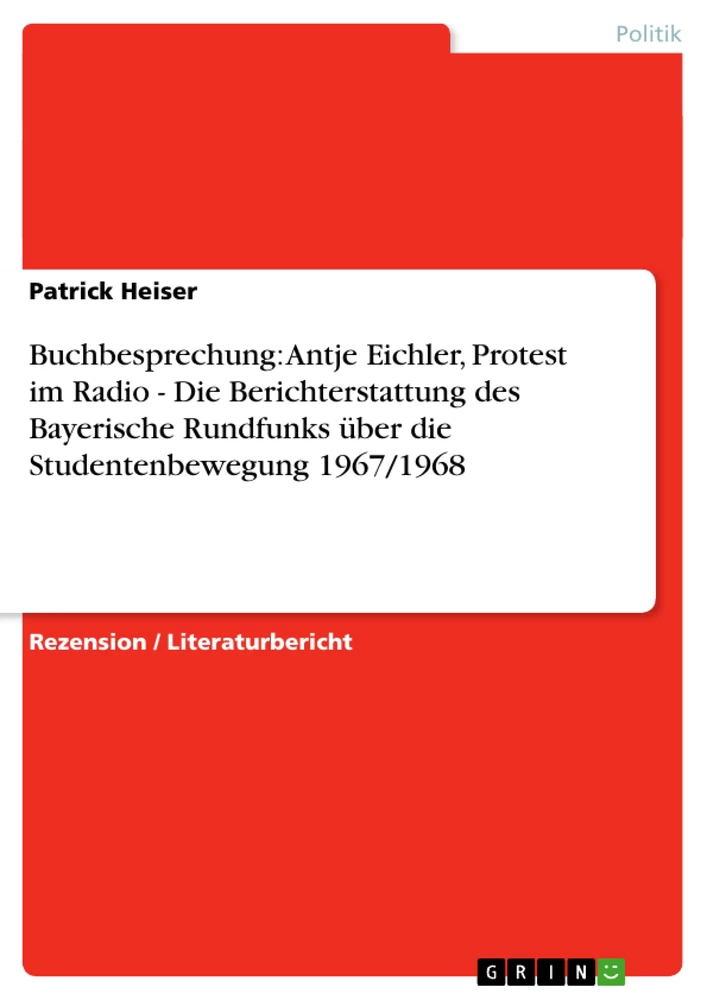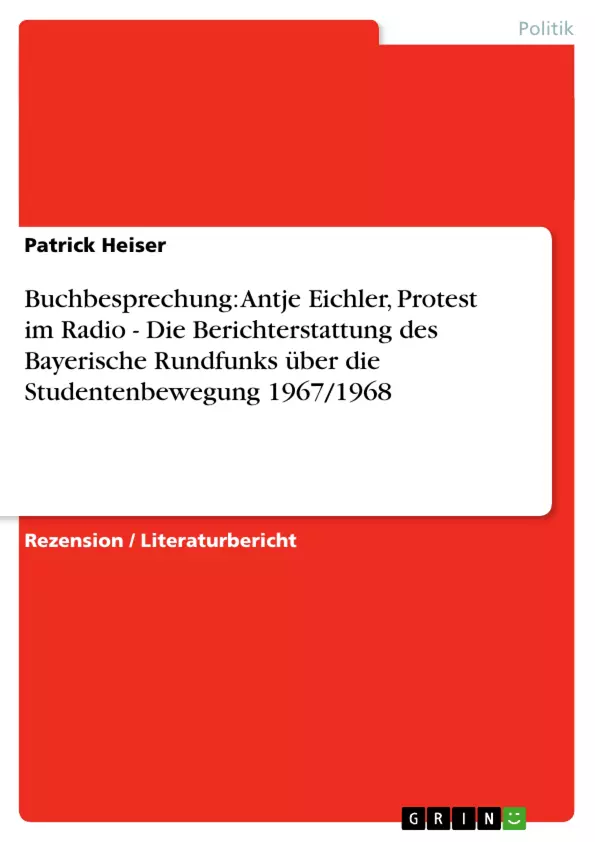Inhalt
Vorbemerkung
Einleitende Hinweise
Die Studentenproteste 1967/1968 und die Medien
Das Buch: Protest im Radio
Die Autorin: Antje Eichler
Aus dem Inhalt
Teil 1 – Grundlagen
Teil 2 – Anlage und Ergebnisse der Untersuchung
Antje Eichlers Resümee
Kritische Bewertung
Literatur
Monografien und Sammelbände
Internet-Links
Vorbemerkung
Das zu besprechende Werk „Protest im Radio – Die Berichterstattung des Bayerischen Rundfunks über die Studentenbewegung 1967/1968“ ist im Frühjahr 2005 im Peter Lang Verlag erschienen. Aufgrund dieser Aktualität existieren noch keine weiteren Rezensionen, die zum Vergleich hätten herangezogen werden können.
Die Autorin Antje Eichler hat mit der vorliegenden Studie als Diplomarbeit Ihr Studium der Journalistik und Osteuropawissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität in München abgeschlossen. Weitere Veröffentlichungen – und somit detailliertere Informationen zu ihrer Biografie – waren ebenfalls nicht zu finden.
Einleitende Hinweise
„Ja, man möchte nicht einmal neben ihnen sitzen, weil sie – nun einige Vertreter dieser so genannten Studenten haben wir auf unserer Pressetribüne zu Gesicht und auch zu Geruch bekommen.“[1]
Die Studentenproteste 1967/1968 und die Medien
Wären die 68er nicht die 68er sondern sozusagen die 05er, würden wir eine soziale Bewegung mit vergleichbarem Ausmaß also heute miterleben können, so wäre wohl klar: Wir könnten live im Fernsehen mitverfolgen, wie Demonstranten mit Steinen die Fensterscheiben der Springer-Filialen in Berlin einwerfen, ein Foto des gerade erschossenen Studenten Benno Ohnesorgs wäre morgen formatfüllend auf der Titelseite der Bild-Zeitung abgedruckt und von der Druckerei-Blockade der gleichen Zeitung würden unzählige Rundfunkreporter live berichten.
Doch am Ende der 1960er Jahre war die Medienwirklichkeit in Deutschland eine andere: Das Fernsehen war weniger verbreitet, der Farbfernseher gerade erst im Jahre 1967 erfunden. Radio und Presse spielten im Vergleich noch die wichtigeren Rollen. Die einzelnen Landesrundfunkgesetze und die entsprechenden Staatsverträge waren eben erst gut zehn Jahre alt[2] und die deutsche Diktatur, die sich die Massenmedien für ihre Propaganda geschickt zunutze gemacht hatte, war noch in deutlich frischerer Erinnerung.
Dadurch war eine Berichterstattung über die Studentenproteste und – damit zwangsläufig einhergehend – eine Kommunikation der studentischen Ideen zu dieser Zeit keineswegs so selbstverständlich wie das heutzutage wahrscheinlich der Fall wäre; zumal eine „staatsgefährdende und gewaltverherrlichende“ Berichterstattung – damals wie heute – durch die einschlägigen Gesetze unter Strafe gestellt war.
Und egal welche historische Rolle man der Studentenbewegung der Jahre 1967 und 1968 heute zusprechen mag – sei es eine „Politisierung der Öffentlichkeit“[3], wie Jürgen Habermas sagt, eine „Überwindung tradierter obrigkeitsstaatlich orientierter, autoritärer Verhaltensdispositionen“[4], wie es Ingrid Gilcher-Holtey formuliert, oder „mit ihrem eigentlichen Ziel […] gescheitert“[5], wie Antje Eichler schreibt – eines haben die Proteste seinerzeit sicherlich verändert: Heute wird ohne jede Frage über (neue) soziale Bewegungen wie Globalisierungsgegner, Proteste gegen den Irak-Krieg oder auch Demonstrationen gegen „Hartz IV“ berichtet. „Eine der wesentlichen Folgen der 68er Bewegung für die Massenmedien besteht […] darin, dass Protestereignisse sehr viel selbstverständlicher Gegenstand öffentlicher Berichterstattung geworden sind“, resümiert Wolfgang Kraushaar[6].
Doch wie stellte sich die Situation für die Redakteure dar, die am Ende der 1960er Jahre entscheiden mussten, welche Meldungen über den Sender gehen sollten und wie die Proteste zu kommentieren seien?
Das Buch: Protest im Radio
Dieser Frage geht Antje Eichler in ihrem Buch „Protest im Radio – Die Berichterstattung des Bayerischen Rundfunks über die Studentenbewegung 1967/1968“ für den Bayerischen Rundfunk (BR) und die Zeit zwischen dem 27. Mai 1967 und dem 2. Juni 1968 nach.
Sie analysiert dabei hermeneutisch Interviews, die sie mit damals verantwortlichen Mitarbeitern des BR geführt hat, und führt eine ausführliche quantitative Inhaltsanalyse der im Untersuchungszeitraum in beiden Hörfunkprogrammen des BR gesendeten Beiträge durch, um die Frage zu beantworten, „inwieweit der Bayerische Rundfunk bei der Berichterstattung über die 68er-Studentenproteste seinen Programmauftrag wahrgenommen hat und welche Einflüsse möglicherweise die darin vorgeschriebene Meinungsvielfalt und Ausgewogenheit verhindert haben.“ (EICHLER 2005, S. 9)
Ihre diesbezügliche Diplomarbeit wurde dabei im Auftrag des Bayerischen Rundfunks selbst als Buch herausgegeben und ist in der Reihe „Studien zur Geschichte des Bayerischen Rundfunks“[7] erschienen.
Bevor ich kritisch bewerte, ob sie die von ihr gestellten Forschungsfragen schlüssig beantworten kann und ob die dabei von ihr angewandten Methoden wissenschaftlichen Maßstäben genügen, möchte ich noch ein paar kurze Stickworte zur Autorin selbst geben und den Inhalt des vorliegenden Buches zusammenfassen.
Die Autorin: Antje Eichler
Antje Eichler wurde 1976 in Gera geboren und volontierte, vor Ihrem Studium der Journalistik und Osteuropawissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität, an der Deutschen Journalistenschule – beides in München, dem Sitz des Bayerischen Rundfunks. Ihr Studium schloss sie 2004 mit der vorliegenden Untersuchung als Diplomarbeit ab und arbeitet seither als freie Journalistin.[8]
Aus dem Inhalt
Nach einer kurzen Einleitung, in der Antje Eichler zu dem Ergebnis kommt, dass die Berichterstattung über die Studentenproteste Ende der 1960er Jahre noch nicht wissenschaftlich analysiert wurde, in der sie begründet, warum ihrer Studie im Speziellen die Berichterstattung des BR zugrunde liegt[9], in der sie die Fragestellungen Ihrer Diplomarbeit kurz anreißt und schließlich selbst die Kapitel ihrer Arbeit zusammenfasst, lässt sich das vorliegende Buch in drei weitere Teile einteilen:
- In einem ersten Teil werden theoretische, historische und programm-strukturelle Grundlagen zusammengetragen.
- Anschließend stellt die Autorin die Anlage Ihrer Untersuchung vor und analysiert und interpretiert ausführlich deren Ergebnisse,
- um dann – in einem dritten Teil – zusammenfassende Schlussfolgerungen zu ziehen.
Teil 1 – Grundlagen
Im Grundlagenteil, den Antje Eichler sehr ausführlich verfasst und dessen Umfang annähernd die Hälfte des Textes ausmacht, stellt sie zunächst die rechtlichen Grundlagen, die sich auf Programminhalte des Hörfunks beziehen[10], dar und betont dabei den pluralistischen Gedanken, der diesen Gesetzen zugrunde liegt. Wichtig für Ihre Arbeit scheint danach die Frage, inwieweit die im Rahmen der Studentenproteste auftretenden Gruppen „als relevant beurteilt und in welchem Umfang sie bei der Berichterstattung berücksichtigt wurden“, um dieser Idee gerecht zu werden. (EICHLER 2005, S. 15) Das bringt sie zu einer generellen Reflexion über die Begriffe Vielfalt und Ausgewogenheit, die sie anhand der Theorien von Denis McQuail vollzieht[11]. In ihrer Studie wird sie ein besonderes Augenmerk auf die inhaltliche Vielfalt des analysierten Programms legen, die sie an drei Punkten festmacht:
- formale Charakteristika (Aufbau und Struktur von Gesamtprogramm und einzelnen Sendungen)
- Anzahl der zu Wort kommenden Personen sowie der im Programm vorkommenden Themen, Anlässe, Orte
- Verschiedenheit der dargebrachten Meinungen und Argumente
Den Begriff Ausgewogenheit stellt sie in seiner Wichtigkeit im Vergleich zur Vielfalt zurück und bezieht sich dabei u.a. auf Wolfgang Hofmann-Riem: „Ausgewogenheit ist vielmehr der Modus, der sich herstellt, wenn alle Interessen zu Wort kommen.“[12]
Im Anschluss ermittelt Eichler Faktoren, die auf das Programm des BR einwirkten und es determinierten. Sie macht dabei einerseits die sog. Nachrichtenfaktoren[13] aus und benennt auf der anderen Seite das „Rollenverständnis und die Einstellung des Redakteurs“, die Organe der Rundfunkanstalt und die Einflussmöglichkeiten der Politik, die sie später genauer analysieren wird.
Im folgenden Kapitel beschreibt die Autorin die historischen Hintergründe und teilt zunächst – Jürgen Habermas folgend – die Studentenproteste in drei zeitliche Phasen[14] ein bevor sie die Bewegung anhand von neun Punkten inhaltlich umreißt:
- Den Beginn der vorliegenden Studie markiert der Besuch des Schah von Persien in Deutschland Ende Mai 1967, der eine bundesweite Diskussion über den Imperialismus der USA und Demonstrationen auslöst. Auf einer dieser Demonstrationen wird am 2.6.1967 der Student Benno Ohnesorg von der Polizei erschossen, was zu teils gewalttätigen Gegenreaktionen der Studenten führt und eine allgemeine Gewaltdiskussion auslöst.
- Neben der Forderung nach einer Reform der Hochschule (Stichwort: Drittelparität[15] ) gilt laut Eichler
- „die Eskalation des Vietnamkriegs im Jahr 1965 als zweite wichtige Ursache für die Entstehung der Studentenbewegung“ (EICHLER 2005, S. 42).
- Die Kapitalismuskritik der Studenten fand ein Ventil in der Anti-Springer-Kampagne, die im Frühjahr 1968 mit Brandanschlägen, dem Attentat eines „bekennenden Bild-Lesers“ auf SDS[16] -Sprecher Rudi Dutschke und den Tumulten vor der Bild-Druckerei nur kurz eskalierte.
- Nachhaltiger für die Studentenproteste war hingegen die Kritik an den Notstandsgesetzen [17], mit der die Studenten vor einem Rückfall in die Diktatur warnen wollten. Und die auch zum ersten Mal zu direkt gegen die Medien gerichteten Aktionen führte, als tausende von Demonstranten am 29.5.1968 vor dem Gebäude des BR in München aufzogen und Sendezeit für ihre Argumente einforderten.
- Aber nicht nur an diesen Gesetzen sondern generell an der Großen Koalition übten die Studenten Kritik, die „ihrer Meinung nach undemokratisch war, weil sie nur dem Machterhalt der beiden großen Volksparteien diente und das Parlament schwächte“ (EICHLER 2005, S. 46).
Weitere Aspekte der Stundenbewegung waren nach Eichler
- die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit,
- eine allgemeine Gesellschaftskritik und der Kampf gegen autoritäre Strukturen, sowie, als Folge der Studentenproteste,
- eine Debatte um die Bewegung selbst und ihre teils gewalttätigen Aktionen.
Darauf aufbauend beschäftigt sich die Autorin mit der Bedeutung der Medien für die Studentenbewegung und stellt heraus, dass es den Studenten sehr wohl bewusst war, dass sie am besten durch spektakuläre Aktionen Gehör bei diesen finden konnten und ihre Proteste somit an den Nachrichtenfaktoren (siehe Fußnote 13) orientierten. Des weiteren kritisiert sie Autoren, die in früheren Veröffentlichungen die Berichterstattung über die Studentenbewegung als „linksorientiert, einseitig, aufbauschend“ charakterisierten, dies aber „kaum durch systematische Studien belegt“ hätten. Sie führt für dieses Phänomen – in Anlehnung an den vielbeschworenen Begriff Mythos ´68 – den Ausdruck Medien-Mythos ´68 ein, auf den sie in ihrem abschließenden Fazit noch zurückkommen wird[18].
Vorher jedoch berichtet Antje Eichler – im letzten Kapitel des Grundlagenteils – von den programmlichen und strukturellen Rahmenbedingungen innerhalb des Bayerischen Rundfunks im Untersuchungszeitraum. Sie beschreibt dabei die Hörfunknutzung in den 1960er Jahren, grenzt die beiden Programme des BR gegeneinander ab und zählt die einzelnen Sendungen auf, die sie für Ihre Studie analysieren wird. Dabei spricht sie bereits zwei Probleme an, auf die ich in meiner Kritik am Ende dieser Arbeit noch genauer eingehen werde: Nämlich erstens die fehlenden empirischen Zahlen zur Einschaltquote[19] und zweitens die im Hörfunkarchiv des BR teils nicht mehr vorhandenen Manuskripte zu Sendungen, die für die Analyse der Inhalte durchaus hätten interessant und wichtig sein können[20].
Sie stellt außerdem mit Programmdirektor Walter von Cube und Intendant Christian Wallenreiter die Führungsriege des BR vor, umreißt die einzelnen Abteilungen, benennt die maßgeblichen Kommentatoren und kommt zu dem Schluss, dass die „einzelnen Redaktionen relativ autonom [arbeiteten], was vor allem auf engagierte Abteilungsleiter zurückzuführen war.“ (EICHLER 2005, S. 62)
Teil 2 – Anlage und Ergebnisse der Untersuchung
Nun widmet sich die Autorin ihrer eigentlichen Untersuchung und fasst zusammen, dass es bisher noch „keine historische Studie zu Vielfalt und Ausgewogenheit, die das Programm eines Hörfunksenders […] über einen Abschnitt der Geschichte der Bundesrepublik untersucht“, gibt. Sie definiert den Untersuchungszeitraum vom 27.5.1967 bis 2.6.1968[21] und erklärt, dass sie sich „wegen vieler Unklarheiten“ gegen Hypothesen und für die Formulierung von Forschungsfragen entschieden hat (vgl. EICHLER 2005, S. 64). Sie teilt ihre Studie dabei in zwei Teile ein und fragt
- erstens ob, wie und in welchem Umfang relevante Themen, Gruppen, Meinungen und Argumente in der Berichterstattung des BR vorkamen und wie sich diese im Laufe des Untersuchungszeitraums ggf. verändert haben. Dies möchte sie durch eine quantitative Inhaltsanalyse intersubjektiv nachvollziehbar ermitteln.
- Zweitens fragt sie nach Einflüssen auf die Berichterstattung von innerhalb und außerhalb des Senders, die sie durch die Auswertung von Dokumenten und Zeitzeugengesprächen aufdecken will.
Für die inhaltliche Analyse greift die Autorin auf Unterlagen des Historischen und des Schallarchivs des Bayerischen Rundfunks zurück, die sich auf mindestens eine der oben genannten Aspekte der Studentenbewegung beziehen und bewertet diese zunächst formal nach Sendeart, Beitragsform, zeitlichem Umfang und Platzierung im Programm (im Laufe der Woche und im Tagesverlauf, korrelierend mit der jeweiligen vermeintlichen Einschaltquote). Inhaltlich schlüsselt sie jeden einzelnen Beitrag nach Thema, Kommunikator (z.B. Nachrichtenredakteur oder Kommentator aber auch politischer oder studentischer Akteur im O-Ton) und Meinungsposition auf und differenziert weiter – Satz für Satz – die vorgebrachten Argumente, um auf die Haltung des Kommunikators zu schließen[22].
Antje Eichler kommt dabei zu folgenden Ergebnissen:
- Die Berichterstattung über die Studentenproteste war gleichmäßig verteilt auf beide Hörfunk-Programme des BR, alle Sendeformate und auch innerhalb von Tages- und Wochenverlauf, allerdings war das Thema selten Aufmacher einer Sendung.
- Die Verteilung der Anlässe, über die berichtet wurde, deutet auf eine an Hintergründen und schwächeren sozialen Gruppen orientierte Berichterstattung hin, die sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben bewegt.
- Die Herangehensweise an das Thema war von Redaktion zu Redaktion unterschiedlich, was insgesamt zu einer differenzierten Berichterstattung von verschiedenen Standpunkten aus führte.
- Besonders einseitige Argumente wurden dadurch kompensiert, dass die Gegenseite ihre Standpunkte ausführlicher vertreten durfte.
- Bei den Meinungspositionen zu Vietnamkrieg und Schahbesuch kamen fast nur eindeutige Haltungen vor, was auf harte Fronten hindeutet.
- Unter den einzelnen Kommunikatoren fanden sich alle relevanten gesellschaftlichen Gruppen. Dabei ist allerdings eine unausgeglichene Verteilung zugunsten von politischen Akteuren festzustellen. Unter den studentischen Akteuren kamen die radikalsten überdurchschnittlich häufig zu Wort. Obwohl auch kritische Stimmen von Seiten der Studenten im Programm vorkamen,
- wurden also radikale Argumente der Studenten gesendet, auch wenn dies die Redakteure durchaus in Konflikt mit dem Rundfunkgesetz bringen konnte, das staatsgefährdende und gewaltverherrlichende Berichte verbietet.
- In den aktuellen Sendungen allerdings kamen vornehmlich politische Akteure zu Wort, was sie eher studentenfeindlich machte. In hintergründigen Sendungen waren dagegen häufiger die Studenten zu hören.
- Am studentenfreundlichsten war die Berichterstattung in den Monaten nach dem Schahbesuch. Im Jahr 1968 nahm die Sympathie dann aber ab, die Zahl der ablehnenden Stimmen wurde größer und die Anzahl der Beiträge über Studentenproteste ohne konkreten Anlass deutlich geringer. Daran zeigt sich laut Antje Eichler „das Dilemma jeder Protestbewegung: Um mit ihren Forderungen in die Medien zu kommen, bedarf es der spektakulären Aktionen; allzu heftige Aktionen aber können die Forderungen überlagern und den Interessen der Prostbewegung zuwider laufen.“[23]
Nach formalen Aspekten war die Berichterstattung des BR also durchaus ausgewogen. Bei den Kommunikatoren und den von ihnen vertretenen Meinungspositionen kam „Vielfalt aber nur insofern zustande als jede Gruppe, jedes Thema und jede Meinungsposition […] grundsätzlich auftauchte. Ihre Verteilung war aber insgesamt unausgewogen […]“ (EICHLER 2005, S. 111)
Bei der Frage nach den Einflüssen auf die Berichterstattung des BR über die Studentenproteste macht die Autorin drei potentielle Ursachen aus:
- Arbeitsabläufe in den Redaktionen und persönliche Einstellungen der Redakteure
- Strukturen und Einstellungen der Organe des Bayerischen Rundfunks
- externe Einflüsse von Seiten der Politik und anderer gesellschaftlicher Gruppen
Sie analysiert dabei hermeneutisch – auf theoretische Überlegungen gestützt und unter Heranziehung der in der Inhaltsanalyse gewonnenen Erkenntnisse – Dokumente aus den oben genannten Archiven des BR und Interviews, die sie mit ehemaligen Mitarbeitern geführt hat.
Bezüglich der persönlichen Einstellungen der Redakteure stellt Eichler fest, dass diese durchaus in der Berichterstattung zu erkennen waren und eine studentenfreundliche Haltung vor allen Dingen dort auftauchte, wo eine persönliche Meinung des Redakteurs durchaus gefragt war, wie beispielsweise in Kommentaren. Nur vereinzelte Sendeschienen waren laut ihrer Analyse eindeutig studentenfeindlich[24]. Beeinflusst wurde die Berichterstattung aber auch durch technische Aspekte, wie zum Beispiel durch die Qualität der vorhandenen O-Töne. In diesem Zusammenhang spielt auch eine Rolle, dass die Studenten über keine Öffentlichkeitsarbeit verfügten und somit häufig nur sendbares Material aus der Politik in den Redaktionen vorlag.
Zwar kann die Autorin eine grundsätzliche Antipathie der leitenden Mitarbeiter des BR gegenüber den Studentenprotesten feststellen, kommt aber insgesamt zu dem Ergebnis, dass diese nicht in die tägliche Arbeit der Redakteure eingriffen, sondern „ihren Mitarbeitern weitgehend freie Hand bei der Gestaltung des Programms“ ließen, was zu einer ausgewogenen Berichterstattung führte[25].
Extern auf die Berichterstattung wirkte naturgemäß vornehmlich der Rundfunkrat ein, dessen Forderungen aber – genau wie die teils heftigen Angriffe von Seiten der Politik – von den Leitern des BR (namentlich Hörfunkdirektor Walter von Cube und Intendant Christian Wallenreiter) gegenüber den Redaktionen abgedämpft wurden. „Bei einzelnen, vor allem jungen Redakteuren“, konstatiert Eichler, „ haben diese ständigen Beschwerden aber möglicherweise zu mehr Vorsicht und Rücksichtnahme geführt, um die eigene Karriere […] nicht zu gefährden.“ (EICHLER 2005, S. 134).
Obwohl sich die Berichterstattung des BR also offenkundig eher an der öffentlichen Meinung als an den Ansichten der Politik orientierte, hatten es die Studenten nicht immer einfach, Ihre Meinungen im Programm zu platzieren.
Antje Eichlers Resümee
Diesen Punkt greift Antje Eichler in Ihren „Schlussbetrachtungen“ als erstes auf und zieht das allgemeine Fazit, dass aufgrund der oben beschriebenen Arbeitsabläufe und Strukturen etablierte und mächtige Gruppen leichter Zugang zum Rundfunk finden als unbekannte Gruppen und neue soziale Bewegungen. Trotzdem hat der Bayerische Rundfunk, so resümiert die Autorin, „dem Thema [Studentenbewegung, Anm. d. Verf.] breiten Raum gewährt“.
Sie fasst nun noch einmal knapp die Ergebnisse er Inhaltsanalyse zusammen und folgert, dass Themen, die ohnehin auf der politischen Agenda standen, mehr Sendezeit eingeräumt wurde[26], sich der BR also offensichtlich an „politisch-administrativen Vorgaben“ orientierte. Einer großen Anzahl an Kommentaren, „in denen sich die progressive Einstellung einiger Redakteure widerspiegelte“, sei es zu verdanken, „dass die Verteilung der Argumente dennoch zugunsten der Stundenten“ und „die Argumentation bezüglich der Studentenproteste insgesamt recht vielfältig und ausgewogen“ ausfiel.
Besonders stellt Eichler noch einmal den Wandel hin zu einer aktuelleren und damit oberflächlicheren Berichterstattung heraus und begründet diesen mit der Radikalisierung der Studentenproteste. Diese habe den Studenten zwar einerseits „mehr Aufmerksamkeit [eingebracht], als es 1967 der Fall war“, aber andererseits auch eine hintergründigere, die Ideen der Studenten kommunizierende Berichterstattung verhindert[27].
So kommt die Autorin abschließend zu einem ambivalenten Fazit und stellt fest, „dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk gemäß seinem Programmauftrag gesellschaftliche Veränderungen wahrnehmen und kritisch begleiten kann.“ Auf der anderen Seite aber gibt es – wie oben dargestellt – viele Einflussnahmen von innen und außen, durch die „eine vielfältige und ausgewogene Berichterstattung teilweise ernsthaft gefährdet“ wird.
Dass das Programm des BR Ende der 1960er Jahre trotz einiger heftiger Proteste aus der politischen Elite heraus den gesetzlichen Vorgaben entsprach, ist laut Eichler „vor allem der starken Position von Intendant und Hörfunkdirektor zu verdanken“, die Ihren Redakteuren eine autonome und durchaus progressive Arbeitsweise ermöglichten.
Kritische Bewertung
Tatsächlich gelingt es Antje Eichler mit Ihrer Diplomarbeit „Protest im Radio – Die Berichterstattung des Bayerischen Rundfunks über die Studentenbewegung 1967/1968“ offenbar eine Forschungslücke zu schließen, denn vergleichbare inhaltliche Studien, die sich empirisch mit der Hörfunkberichterstattung über die Studentenproteste Ende der 1960er Jahre beschäftigen, sind nicht auffindbar. Es existiert lediglich eine unvollständige Aufstellung gesendeter Beiträge aller ARD-Rundfunkanstalten[28].
Mehr Material lässt sich zur Fernsehberichterstattung finden, welches zusammenfassend feststellt, das Fernsehen habe die Protestbewegung erst bekannt gemacht und eine Verstärkerfunktion für die Forderungen der Studenten übernommen, durchaus auch mit den Protesten sympathisiert, aber letztendlich über die ganze Bandbreite der studentischen Anliegen berichtet[29]. Auch zu Presseveröffentlichungen liegen einige Analysen vor.
Es gelingt der Autorin, ihre Forschungsfragen nach Art, Umfang und zeitlicher Veränderung der Berücksichtigung aller relevanten Themen, Gruppen und Meinungen schlüssig zu beantworten und die quantitative Inhaltsanalyse scheint dabei – Werner Früh folgend – das methodische Mittel der Wahl zu sein: „Die Inhaltsanalyse ist eine empirische Methode zur systematischen, intersubjektiv nachvollziehbaren Beschreibung inhaltlicher und formaler Merkmale von Mitteilungen […].“[30]
Eichler gibt sich viel Mühe bei der Analyse der vom BR im fraglichen Zeitraum gesendeten Hörfunkbeiträge und codiert die von ihr recherchierten Manuskripte mit großem Aufwand Satz für Satz.
Allerdings stößt sie dabei an die Grenzen vieler historischer Studien und ist ausschließlich auf das Material, das sie in den Archiven des Bayerischen Rundfunks gefunden hat, angewiesen. Dieses ist aber keineswegs zwangsläufig vollständig und so schreibt sie selbst: „Neben der politischen Information kamen für die Inhaltsanalyse einige Sendungen des Wirtschaftsfunks und der Regionalabteilung sowie der Hauptabteilung (HA) Kultur und Erziehung in Frage. Innerhalb der ersten beiden Abteilungen sind jedoch überhaupt keine Manuskripte erhalten, bei letzterer fehlen die Aufzeichnungen der Kulturredaktion und des Frauenfunks.“ (EICHLER 2005, S. 58)
Zwar kommt sie insgesamt auf die durchaus beachtliche Zahl von 414 ausgewerteten Beiträgen, diese erreicht sie aber nur dadurch, „dass ein gebauter Beitrag, der aus Text und O-Tönen besteht, beim Codieren in O-Ton und Text zerlegt und jedes Element als selbstständiger Beitrag behandelt wurde.“ (EICHLER 2005, S. 71). Nun ist der so genannte „gebaute Beitrag“ aber eine übliche und auch häufig im Hörfunk gesendete journalistische Stilform. Und wenn man berücksichtigt, dass jeder einzelne gebaute Beitrag aus einer ganzen Reihe von einzelnen Beiträgen (O-Töne und Textpassagen) bestehen kann, so reduziert sich die Anzahl der tatsächlich gesendeten und hier analysierten Programmelemente vermutlich erheblich. Dies lässt beispielsweise folgenden Schluss wissenschaftlich nicht haltbar erscheinen: „Das bedeutet, dass der BR-Hörfunk im Schnitt pro Tag einen Beitrag […] ausgestrahlt hat. […] Dieser erste Überblick weist darauf hin, dass der Bayerische Rundfunk den Studentenprotesten insgesamt einigermaßen viel Aufmerksamkeit geschenkt und sie in seinem gesamten Programm berücksichtigt hat.“ (EICHLER 2005, S. 73). Eine reine Division der von Eichler auf diese Weise ermittelten Beitragszahl durch die Anzahl der Tage im Untersuchungszeitraum scheint hier banal.
Diese, statistisch betrachtet, schwache Datenbasis und die daraus folgenden „wackeligen“ Schlussfolgerungen möchte ich anhand von zwei Beispielen verdeutlichen:
Die Autorin behauptet beispielsweise, die Beiträge zur Studentenbewegung seien gleichmäßig über die Wochentage verteilt und stellt zu diesem Zweck eine Tabelle auf, die ausweist, dass über das gesamte Jahr insgesamt 39 Beiträge an Montagen gesendet wurden. Zehn dieser Beiträge stammen dabei aber aus einer einzigen Sendung an einem einzigen Montag. Wäre allein das Manuskript dieser Sendung nicht mehr im Archiv zu finden gewesen, gäbe es eine Abweichung um rund 26 Prozent[31].
Mein zweites Beispiel bezieht sich auf einen Beitrag des Redakteurs Burghard Freudenfeld, der vom BR am 10.6.1968 als Antwort auf einen Brief von Franz Josef Strauß gesendet wurde. Dabei kommt Freudenfeld zu dem Schluss, dass sich bei der Kommentierung zur Notstandsgesetzgebung eine „abgewogene Wahl der Autoren [gefunden habe]. Die Befürwortung beziehungsweise bedingte Befürwortung der Verabschiedung überwog dabei.“ Antje Eichler hingegen kommt in diesem Punkt nur auf eine Zustimmung von 28,5 Prozent, und zwar, weil sie drei von dem BR-Redakteur berücksichtigte Kommentare nicht analysieren konnte, weil zu diesen keine Manuskripte mehr vorlagen. Diese sehr geringe Zahl von Beiträgen vermag die Schlussfolgerungen also offenbar deutlich umzukehren.
Als problematisch ist darüber hinaus anzusehen, dass keine detaillierten Zahlen zum Hörverhalten (Einschaltquote) Ende der 1960er Jahre vorliegen und die Autorin diese nur anhand späterer Werte „vermuten“ kann, trotzdem aber Schlüsse zieht wie: „Dass der Bayerische Rundfunk die Berichterstattung über die Studentenbewegung nicht in Nischen versteckt hat, ist daraus ersichtlich, dass fast drei Viertel der Beiträge […] in einer Zeit [liefen], in der die Einschaltquote immerhin mäßig hoch war.“[32]
Wiederum schlüssig beantwortet werden aber die Fragen nach internen und externen Einflussnahmen auf das Programm des BR, die Eichler anhand zahlreicher Dokumente belegen kann. Mit insgesamt neun ehemaligen Mitarbeitern des BR hat sie darüber hinaus selbst Interviews geführt und deckt dabei alle Bereiche der Rundfunkanstalt zufrieden stellend ab.
Beachtlich ist der Umfang des Anhangs zur vorliegenden Diplomarbeit, der annähernd die Hälfte ihres Gesamtumfangs ausmacht. Neben den üblichen Angaben zu Quellen und Literatur findet man dort sämtliche von der Autorin ermittelten statistischen Daten sowie ausführliche biografische Notizen und Fotos von den im Buch erwähnten Akteuren. Eine tabellarische Aufstellung der historischen Ereignisse im Untersuchungszeitraum ist genauso abgedruckt wie interessante die Untersuchung betreffende Dokumente aus den 1960er Jahren.
Literatur
Monografien und Sammelbände
EICHLER, ANTJE, 2005: Protest im Radio - Die Berichterstattung des Bayerischen Rundfunks über die Studentenbewegung 1967/1968 , Reihe: Studien zur Geschichte des Bayerischen Rundfunks, Hg. Ulm, Renate und Bettina Hasselbring, Bd. 3, Frankfurt a.M. u.a.: Peter Lang Verlag.
GILCHER-HOLTEY, INGRID (HRSG.), 1998: 1968 - Vom Ereignis zum Gegenstand der Geschichtswissenschaft, Reihe: Geschichte und Gesellschaft, Heft 17, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
GILCHER-HOLTEY, INGRID, 2001: Die 68er Bewegung - Deutschland, Westeuropa, USA , Reihe: Beck'sche Reihe, Bd. 2183: Beck.
HABERMAS, JÜRGEN, 1970: Protestbewegung und Hochschulreform, Frankfurt am Main: Suhrkamp
KRAUSHAAR, WOLFGANG, 1998: 1968 - Das Jahr, das alles verändert hat, München u.a.: Piper.
KRAUSHAAR, WOLFGANG, 2001: 1968 und die Massenmedien, in: Archiv für Sozialgeschichte Jg. 41 (2001)
McQAUIL, DENIS UND JAN J. VAN CUILENBURG, 1982: Vielfalt als medienpolitisches Ziel, In: - Beschreibung eines evaluativen Forschungsansatzes am Beispiel der Niederlande, in: Media Perspektiven (Heft 11), Seite 681-692
SCHULZ, WINFRIED, 1990: Die Konstruktion von Realität in den Nachrichtenmedien - Analyse der aktuellen Berichterstattung, Freiburg/München: Alber
WILKE, JÜRGEN (HRSG.), 1999: Mediengeschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.
Internet-Links
Arbeitsgemeinschaft außeruniversitärer historischer Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland e.V. zur Tagung „Studien zur Rundfunkgeschichte nach 1945 - Interdisziplinäre Ansätze und Forschungsperspektiven“ vom 15. bis 17. Januar 2004 in München, Nr. 005 vom 20.2.2004:
http://www.ahf-muenchen.de/Tagungsberichte/Berichte/pdf/2004/005-04.pdf
Auf oben genannten Tagung wurde das Buch von Antje Eichler vorgestellt. Hier findet man eine kurze Kritik.
Homepage des Bayerischen Rundfunks:
http://www.br-online.de/br-intern/medienforschung/radionutzung/tagesverlauf/
Auf den Seiten des BR findet man Informationen zu Hörgewohnheiten und Einschaltquoten seit Beginn der 1990er Jahre
Homepage des Peter Lang Verlags:
http://www.peterlang.com/Index.cfm?vID=52126&vHR=1&vUR=2&vUUR=5&vLang=D
Hier findet man kurze Texte zu Buch und Autorin.
[...]
[1] „Landtagskommentar“ von Bernd Ücker vom 17.2.1968, gesendet im 1. Programm des Bayerischen Rundfunks, Quelle: Historisches Archiv des BR, zitiert nach EICHLER 2005, S. 117
[2] „Mit dem Deutschlandvertrag 1955 wird der Rundfunk endgültig der Selbstbestimmung der Deutschen übergeben. […] Die Länderregierungen nutzen ihren Einfluss auf die Rundfunkanstalten und Rundfunkordnungen. Das ständische Modell der ersten Rundfunkgesetze […] wird von einem parlamentarischen Modell abgelöst.“ (DIEDERICHS, HELMUT 2002, Fernsehgeschichte in Deutschland, in: Seminar Theorie und Empirie des Fernsehens an der FH Dortmund)
[3] zitiert nach GILCHER-HOLTEY 2001, S. 109
[4] GILCHER-HOLTEY 2001, S. 127
[5] EICHLER 2005, S. 135
[6] KRAUSHAAR 2001, S. 346
[7] Es handelt sich um den dritten Band dieser Reihe. Des weiteren erschienen sind:
- SCHRADER, STEPHANIE: Von der „Deutschen Stunde in Bayern“ zum „Reichssender München“ – Der Zugriff der Nationalsozialisten auf den Rundfunk, Peter Lang Verlag, 2002
- MAUDER, STEPHANIE: Eugen Jochum als Chefdirigent beim Bayerischen Rundfunk, Peter Lang Verlag, 2003
[8] vgl. Autoreninformation auf der Homepage des Peter Lang Verlags: http://www.peterlang.com/Index.cfm?vID=52126&vHR=1&vUR=2&vUUR=5&vLang=D
[9] Die Autorin begründet diese Wahl damit, dass es beim Bayerischen Rundfunk erhebliche Spannungen zwischen Redakteuren und Politik im Bezug auf die Studentenproteste gegeben habe und beim BR ein grundsätzliches Interesse an der historischen Aufarbeitung des Programms vorhanden sei, vgl. EICHLER 2005, S. 8
[10] zu nennen wären hier Artikel 5 GG und die Landesrundfunkgesetze bzw. die diesbezüglichen Staatverträge. Außerdem beschäftigt sich die Autorin ausführlicher mit der Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Thema Rundfunk.
[11] Dieser hat zusammen mit Jan. J. van Cuilenburg als Maßstäbe für Vielfalt die Begriffe „diversity as reflection“, „diversity as access“ und „“diversity as choise“ zur Analyse der holländischen Presse eingeführt. Vgl. McQUAIL/CUILENBURG 1982
[12] zitiert nach EICHLER 2005, S. 22
[13] Es handelt sich dabei um sechs Dimensionen, die vornehmlich von Winfried Schulz formuliert wurden und den „Wert“ einer Nachricht bestimmen: Zeit, Nähe, Status, Dynamik, Valenz und Identifikation. Vgl. SCHULZ 1990, S. 32ff.
[14] Phase 1: Bildung der Großen Koalition (1968), Formierung der APO und des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS), Aktionen hauptsächlich auf Universitäten beschränkt
Phase 2: Auslöser war der Tod des Studenten Benno Ohnesorgs, der am 2.6.1967 während einer Demonstration von der Polizei erschossen wurde. Darauf folgten teils gewalttätige Aktionen im gesamten Bundesgebiet
Phase 3: Durch die Verabschiedung der Notstandsgesetze am 30.5.1968 brach das wichtigste Angriffsziel der APO weg, die Studenten zogen sich wieder in die Hochschulen zurück bis sich der SDS am 21.3.1970 selbst auflöste Vgl. HABERMAS 1970, S. 10ff.
[15] Die Studenten wollten erreichen, dass sich die Universitäten selbst verwalten, und zwar unter jeweils gleicher Mitbestimmung von Professoren, Assistenten und Studenten.
[16] SDS = Sozialistischer Deutscher Studentenbund, die wohl wichtigste und die Proteste anstoßende Studentenorganisation Ende der 1960er Jahre, dessen Auflösung am 21.3.1970 gemeinhin das Ende der Studentenbewegung markiert, vgl. GILCHER-HOLTEY 2001, S. 110f.
[17] Im Deutschlandvertrag von 1954 hatten sich die Amerikaner ein Vorbehaltsrecht für den inneren und äußeren Notstand gesichert, das so lange gelten sollte, bis Deutschland über eine eigene Notstandsregelung verfügen würde. Die SPD lehnte die ersten Entwürfe allerdings ab und erst im Rahmen der Großen Koalition von 1966 kam es zu einer neuen Vorlage, die am 29.6.1967 in erster Lesung im Bundestag beraten wurde.
[18] vgl. EICHLER 2005, S. 49ff.
[19] „Letztendlich lässt sich aus den wenigen bekannten Zahlen aber vermuten [H.i.O.], dass der BR Ende der sechziger Jahre morgens am meisten, vormittags und nachmittags mäßig und am Abend kaum gehört wurde.“ Diese Vermutung wird nicht näher belegt, deckt sich aber mit heutigen Zahlen (vgl. Homepage des BR: http://www.br-online.de/br-intern/medienforschung/radionutzung/tagesverlauf/)
[20] vgl. EICHLER 2005, S. 58
[21] Historisch gegrenzt wird der Untersuchungszeitraum vom Beginn der studentischen Protestaktionen gegen den Besuch des Schahs, der am 31.5.1967 in München eintrifft und einer Sondersendung des BR zur Verabschiedung der Notstandsgesetze am 2.6.1968
[22] Technisch definiert Antje Eichler dabei so genannte Meinungspositionen wie z.B. „Die Verabschiedung der Notstandsgesetze muss verhindert werden“. Zu jeder Meinungsposition formuliert sie dann jeweils fünf Pro- und Contra-Argumente, wie z.B. „Erinnerung an Nationalsozialismus; Gefahr des Rückfalls in Faschismus“ bzw. „Notstandsgesetze nötig für die völlige Souveränität Deutschlands“.
Jedem analysierten (Teil-)Beitrag ordnet sie nun ein solches Argument zu und ermittelt dessen Ausprägung von 1 (absolute Zustimmung) bis 5 (absolute Ablehnung). Die Summe aller Ausprägungen teilt sie anschließend durch die Anzahl aller Argumente, so dass eine ausgewogene Berichterstattung theoretisch beim Wert 3,0 vorliegen würde.
Die ausgeglichene Anzahl würde aber noch nicht unbedingt eine ausgeglichene Berichterstattung bedeuten, so dass die Autorin darüber hinaus auswertet, wie viel Sendezeit jedem einzelnen Argument eingeräumt wurde.
[23] EICHLER 2005, S. 111, vgl. hierzu auch GILCHER-HOLTEY 2001, S. 95
[24] Als Beispiel führt sie den Landtagskommentar an, der grundsätzlich von Bernhard Ücker gehalten wurde, welcher nicht nur die Studentenproteste ablehnte, sondern „deren Protagonisten sogar verunglimpfte“ (vgl. Fußnote 1).
Zwar wurden seine Kommentare im Gesamtprogramm wieder ausgeglichen. Wenn man aber von einem festen Stammpublikum des Landtagskommentars ausgeht, „erscheint die einseitig negative Kommentierung dann doch problematisch. Hier ist vor allem der Leitung des Hauses eine gewisse Nachlässigkeit vorzuwerfen.“ (EICHLER 2005, S. 117)
[25] vgl. EICHLER 2005 S. 120ff.
[26] So ist ein Ergebnis der Studie, dass einzelnen Themen wie Hochschulreform oder Notstandsgesetze im Programm des BR eine hohe Aufmerksamkeit zuteil wurde, hingegen studentische Themen wie der Vietnamkrieg oder die Kapitalismuskritik kaum Berücksichtigung fanden.
[27] vgl. EICHLER 2005, S. 137f.
[28] POLSTER, GEORG 1987: Studentenbewegung, Außerparlamentarische Opposition (APO), 1966-1970. Bild- und Tonträgerverzeichnisse der ARD-Archive – Presseauswertung, Bd 1: Hörfunkbeiträge
[29] vgl. WILKE 1999, S. 689f.
Eine der ausführlichsten Studien, die sich auf die Politmagazine bezieht, stammt von Gerhard Lampe: Vier links – keins rechts. 1968 und die politischen Fernsehmagazine, in: ESTERMANN, MONIKA/LERSCH, EDGAR (Hrsg.) 2003: Buch, Buchhandel und Rundfunk – 1968 und die Folgen, Wiesbaden
[30] FRÜH, WERNER 2001, Inhaltsanalyse – Theorie und Praxis, Konstanz, S. 25
[31] bezogen auf EICHLER 2005, S. 75
Häufig gestellte Fragen zu "Protest im Radio – Die Berichterstattung des Bayerischen Rundfunks über die Studentenbewegung 1967/1968"
Was ist das Thema des Buches "Protest im Radio"?
Das Buch von Antje Eichler untersucht die Berichterstattung des Bayerischen Rundfunks (BR) über die Studentenbewegung in den Jahren 1967 und 1968. Es analysiert, inwieweit der BR seinen Programmauftrag wahrgenommen hat und welche Einflüsse die Meinungsfreiheit und Ausgewogenheit beeinflusst haben könnten.
Wer ist die Autorin des Buches?
Die Autorin ist Antje Eichler, geboren 1976 in Gera. Sie hat Journalistik und Osteuropawissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität in München studiert und das Buch als Diplomarbeit abgeschlossen. Sie arbeitet als freie Journalistin.
Was sind die Hauptteile des Buches?
Das Buch ist in drei Hauptteile unterteilt: 1. Grundlagen (theoretische, historische und programmstrukturelle Aspekte) 2. Anlage und Ergebnisse der Untersuchung (quantitative Inhaltsanalyse und qualitative Analyse von Interviews und Dokumenten) 3. Zusammenfassende Schlussfolgerungen
Welche methodischen Ansätze verwendet die Autorin?
Antje Eichler verwendet eine Kombination aus quantitativer Inhaltsanalyse von Hörfunkbeiträgen des BR und hermeneutischer Analyse von Interviews mit damals verantwortlichen Mitarbeitern sowie Dokumenten aus den Archiven des BR.
Welche rechtlichen Grundlagen werden im Buch berücksichtigt?
Das Buch berücksichtigt Artikel 5 GG (Grundgesetz) und die Landesrundfunkgesetze bzw. Staatsverträge, die sich auf Programminhalte des Hörfunks beziehen, sowie die Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Thema Rundfunk.
Welche historischen Ereignisse werden in Bezug auf die Studentenbewegung betrachtet?
Die Studie betrachtet Ereignisse wie den Besuch des Schahs von Persien, den Tod von Benno Ohnesorg, die Eskalation des Vietnamkriegs, die Anti-Springer-Kampagne, die Kritik an den Notstandsgesetzen und die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit.
Wie bewertet die Autorin die Berichterstattung des BR insgesamt?
Antje Eichler kommt zu einem ambivalenten Ergebnis. Sie stellt fest, dass der BR der Studentenbewegung breiten Raum gegeben hat, aber auch, dass etablierte Gruppen leichter Zugang zum Rundfunk hatten als neue soziale Bewegungen. Sie betont die Bedeutung einer autonomen Arbeitsweise der Redakteure für eine vielfältige und ausgewogene Berichterstattung.
Welche Kritikpunkte werden an der Studie geäußert?
Kritisiert wird die möglicherweise schwache Datenbasis der quantitativen Inhaltsanalyse aufgrund fehlender Manuskripte und das Fehlen detaillierter Zahlen zum Hörverhalten (Einschaltquoten) Ende der 1960er Jahre. Diese fehlenden Daten erschweren die Interpretation und Verallgemeinerung der Ergebnisse.
Welche Quellen und Literatur werden im Buch verwendet?
Das Buch verwendet Monografien und Sammelbände zur Studentenbewegung und Mediengeschichte sowie Internet-Links zu relevanten Informationen des Bayerischen Rundfunks und des Peter Lang Verlags. Es werden auch Studien zur Rundfunkgeschichte und zur Inhaltsanalyse zitiert.
Was ist der "Medien-Mythos '68", der im Buch erwähnt wird?
Der "Medien-Mythos '68" bezieht sich auf die unkritische Übernahme der These, dass die Berichterstattung über die Studentenbewegung "linksorientiert, einseitig, aufbauschend" gewesen sei, ohne dass dies durch systematische Studien belegt wurde. Die Autorin versucht, diesen Mythos durch ihre empirische Untersuchung zu hinterfragen.
- Quote paper
- Patrick Heiser (Author), 2005, Buchbesprechung: Antje Eichler, Protest im Radio - Die Berichterstattung des Bayerische Rundfunks über die Studentenbewegung 1967/1968, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109590