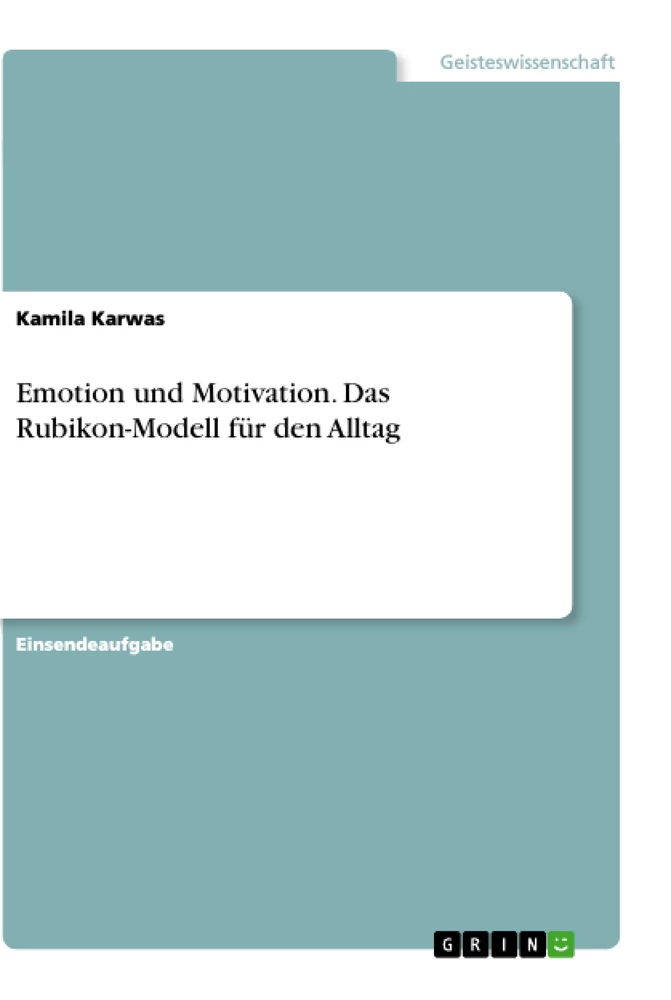Der Fokus dieser schriftlichen Arbeit liegt insbesondere auf den Begriffen Motivation und Emotion. Somit fokussiert sich die Problemstellung auf die folgenden Fragen: Wie kann das "Rubikon-Modell" im Alltag angewendet werden? Wie lässt sich die Handlungskontrollstrategien nach Kuhn zielführend einsetzten? Wie entstehen Motivation und Emotion? Was soll dabei beachtet werden? Welche Bedeutung hat der Umgang und die Regulation von Emotionen im beruflichen Alltag? Wie können Präventions- oder Interventionsmaßnahmen aussehen, um die Motivkongruenz herstellen zu können? Alle diese Fragestellungen sollen in dieser Arbeit ausgearbeitet werden.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- PROBLEMSTELLUNG
- ZIELSETZUNG
- VORGEHEN
- TEXTTEIL ZU AUFGABE A
- DEFINITION „RUBIKON-MODELL“
- UNTERSCHIED ZWISCHEN MOTIVATION UND VOLITION
- ANWENDUNGSBEISPIEL: WIE LASSEN SICH HANDLUNGSKONTROLLSTRATEGIEN NACH KUHL ZIELFÜHREND EINSETZEN?
- TEXTTEIL ZU AUFGABE B
- WAS SIND EMOTIONEN?
- WIE ENTSTEHEN EMOTIONEN?
- ERLÄUTERN SIE DIE BEDEUTUNG DES UMGANGS MIT UND DIE REGULATION VON EMOTIONEN IM BERUFLICHEN ALLTAG
- WAS VERSTEHT MAN UNTER DEM BEGRIFF „EMOTIONSARBEIT“
- TEXTTEIL ZU AUFGABE C
- UNTERSCHIED ZWISCHEN EXPLIZITEM UND IMPLIZITEM MOTIV
- WAS VERSTEHT MAN UNTER DEM BEGRIFF „MOTIVINKONGRUENZ“?
- WELCHE NEGATIVEN FOLGEN KANN DIE MOTIVINKONGRUENZ HABEN?
- WIE KÖNNEN DIE PRÄVENTIONS- ODER INTERVENTIONSMAßNAHMEN AUSSEHEN, UM MOTIVKONGRUENZ HERZUSTELLEN?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den psychologischen Konzepten von Emotionen, Motivation und Volition, insbesondere im Kontext des „Rubikon-Modells“, „Emotionsarbeit“ und „Motivkongruenz“. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis dieser Konzepte zu vermitteln und deren Anwendung in realen Situationen zu illustrieren.
- Das „Rubikon-Modell“ und die Bedeutung von Handlungskontrollstrategien
- Die Entstehung und Regulation von Emotionen im beruflichen Kontext
- Der Unterschied zwischen expliziten und impliziten Motiven
- Das Konzept der „Motivkongruenz“ und deren mögliche negative Folgen
- Präventions- und Interventionsmaßnahmen zur Herstellung von Motivkongruenz
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die grundlegenden Begriffe „Emotion“ und „Motivation“ vor, die im Zentrum dieser Arbeit stehen. Sie definiert Motivation anhand verschiedener wissenschaftlicher Definitionen und betont deren Relevanz für menschliches und tierisches Verhalten. Außerdem werden die zentralen Fragestellungen der Arbeit skizziert, die sich auf die Anwendung des „Rubikon-Modells“, die Handlungskontrollstrategien nach Kuhl, die Entstehung und Regulation von Emotionen sowie die Bedeutung von „Emotionsarbeit“ und „Motivkongruenz“ konzentrieren.
Textteil zu Aufgabe A
Dieser Abschnitt erläutert das „Rubikon-Modell“ und den Unterschied zwischen Motivation und Volition. Anhand eines konkreten Beispiels wird gezeigt, wie Handlungskontrollstrategien nach Kuhl zielführend eingesetzt werden können.
Textteil zu Aufgabe B
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Definition von Emotionen und ihrer Entstehung. Der Fokus liegt darauf, die Bedeutung des Umgangs mit und der Regulation von Emotionen im beruflichen Alltag zu verdeutlichen und den Begriff der „Emotionsarbeit“ zu erklären.
Textteil zu Aufgabe C
Dieser Abschnitt untersucht den Unterschied zwischen expliziten und impliziten Motiven und erklärt das Konzept der „Motivkongruenz“. Darüber hinaus werden mögliche negative Folgen von „Motivinkongruenz“ betrachtet und Ansätze für Präventions- und Interventionsmaßnahmen zur Herstellung von Motivkongruenz vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Emotionen, Motivation, Volition, Rubikon-Modell, Handlungskontrollstrategien, Emotionsarbeit, Motivkongruenz, explizite Motive, implizite Motive, Prävention, Intervention.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Rubikon-Modell der Handlungsphasen?
Das Modell beschreibt den Übergang vom Abwägen von Wünschen (Motivation) zum verbindlichen Handeln (Volition). Der „Rubikon“ ist der Punkt, an dem aus einem Wunsch eine feste Absicht wird.
Was ist der Unterschied zwischen Motivation und Volition?
Motivation bezieht sich auf die Auswahl von Zielen und das Abwägen von Nutzen. Volition (Willenskraft) ist die gezielte Umsetzung dieser Ziele gegen Widerstände und Ablenkungen.
Was versteht man unter „Emotionsarbeit“ im Beruf?
Emotionsarbeit bezeichnet die Notwendigkeit, im beruflichen Alltag Gefühle zu zeigen (oder zu unterdrücken), die den Erwartungen des Arbeitgebers oder Kunden entsprechen, unabhängig vom tatsächlichen Empfinden.
Was bedeutet „Motivinkongruenz“ und welche Folgen hat sie?
Motivinkongruenz liegt vor, wenn die bewussten (expliziten) Ziele nicht mit den unbewussten (impliziten) Bedürfnissen übereinstimmen. Dies kann zu Unzufriedenheit, Stress und Burnout führen.
Wie lassen sich Handlungskontrollstrategien nach Kuhl einsetzen?
Strategien wie Aufmerksamkeitskontrolle oder Motivationskontrolle helfen dabei, die Konzentration auf ein Ziel aufrechtzuerhalten und emotionale Blockaden bei der Ausführung zu überwinden.
Wie entstehen Emotionen laut dieser Arbeit?
Die Arbeit erläutert die psychologische Entstehung von Emotionen als Reaktion auf Reize und deren Bedeutung für die Verhaltenssteuerung und die soziale Interaktion.
- Citar trabajo
- Kamila Karwas (Autor), 2021, Emotion und Motivation. Das Rubikon-Modell für den Alltag, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1096557