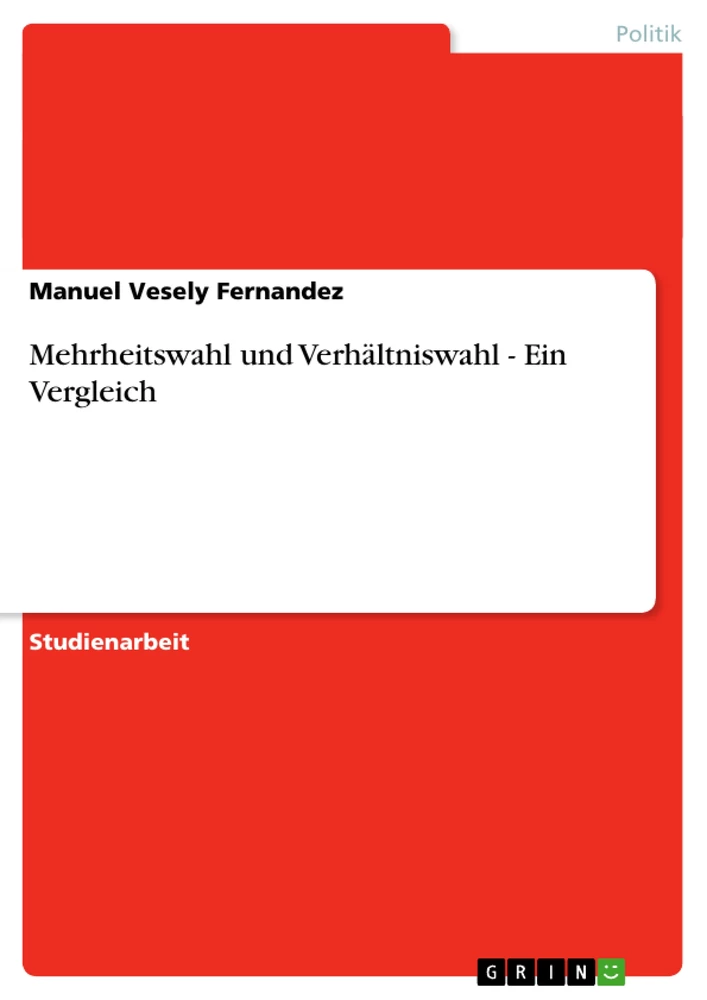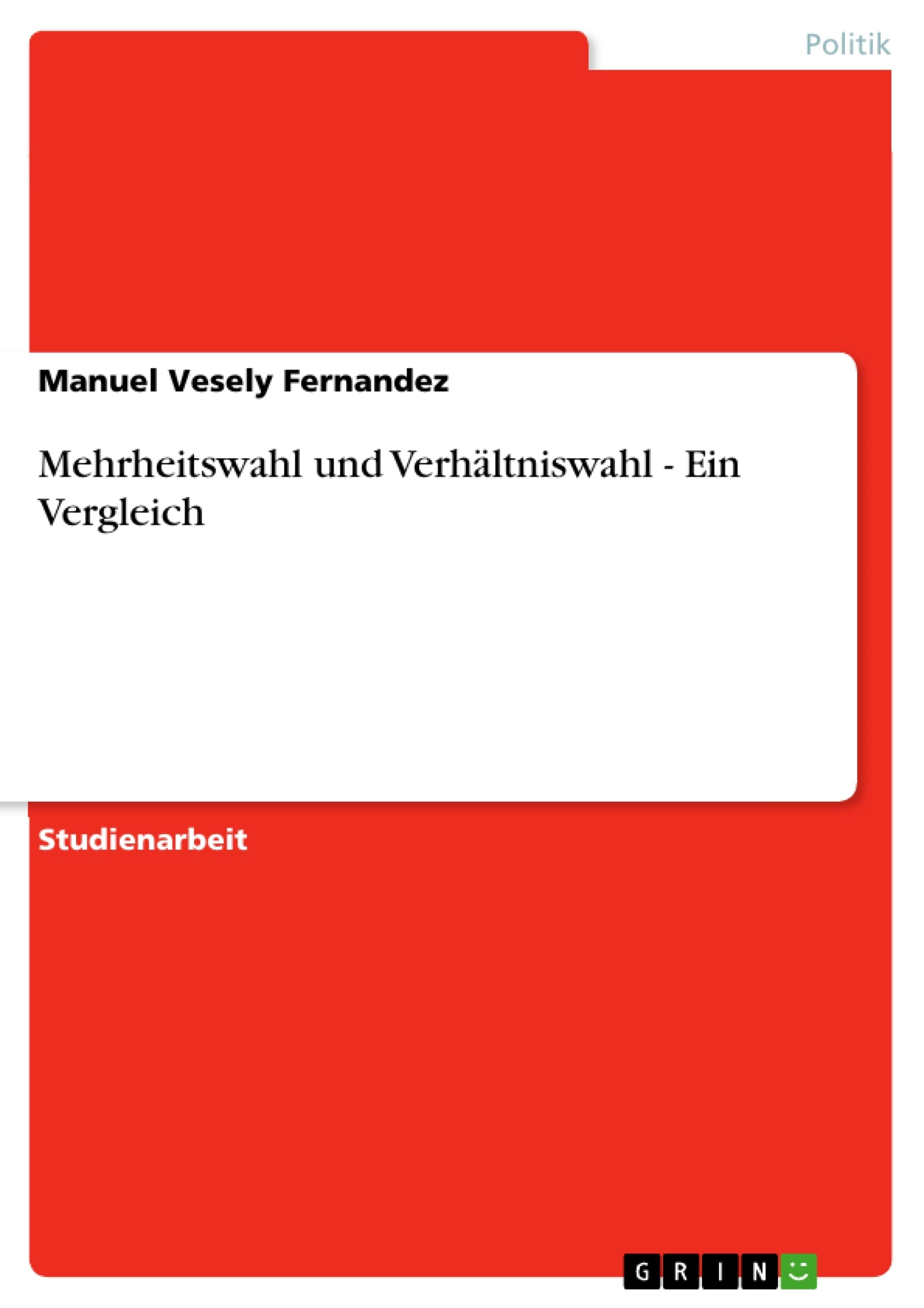Stellen Sie sich vor, das Fundament unserer Demokratie, die Wahlurne, verwandelt sich in ein undurchsichtiges Labyrinth, in dem Stimmen verzerrt, ignoriert oder überproportional verstärkt werden. Dieses Buch ist Ihre Ariadnefaden, der Sie sicher durch das Dickicht der Wahlsysteme führt. Es enthüllt die verborgenen Mechanismen von Mehrheitswahl und Verhältniswahl, zwei fundamental unterschiedlichen Ansätzen, die das Gesicht der politischen Landschaft prägen. Tauchen Sie ein in eine umfassende Analyse, die aufzeigt, wie Wahlsysteme Parteiensysteme formen, das Wahlverhalten beeinflussen und die Stabilität und Gerechtigkeit einer Regierung bestimmen. Anhand von fiktiven Wahlergebnissen werden die potenziellen Auswirkungen beider Systeme greifbar und verständlich gemacht. Entdecken Sie, wie Mehrheitswahl zu Zweiparteiensystemen und "manufactured majorities" führen kann, während die Verhältniswahl eine breitere Repräsentation, aber auch die Zersplitterung der Parteienlandschaft begünstigen kann. Erfahren Sie, warum die viel diskutierte "Gerechtigkeit" eines Wahlsystems eine Frage der Perspektive ist und ob die Stimme jedes Wählers tatsächlich den gleichen Wert besitzt. Dieses Buch ist ein Muss für alle, die verstehen wollen, wie Wahlen wirklich funktionieren und wie sie unsere politische Realität formen. Es ist eine Einladung, hinter die Kulissen der Macht zu blicken und die subtilen, aber tiefgreifenden Auswirkungen von Wahlsystemen auf unsere Gesellschaft zu erkennen. Sind Mehrheitsentscheidungen immer fair? Fördert die Verhältniswahl wirklich die politische Integration? Dieses Werk liefert die Antworten und regt zur kritischen Auseinandersetzung mit den Grundlagen unserer Demokratie an. Es zeigt, dass es kein pauschales "besser" oder "schlechter" gibt, sondern dass die Wahl des geeigneten Systems immer von den spezifischen Bedingungen und Zielen einer Gesellschaft abhängt. Eine fesselnde Lektüre für Politikwissenschaftler, Studierende und alle, die sich für die Funktionsweise von Demokratien interessieren, und ein unverzichtbarer Leitfaden zur Navigation durch die komplexe Welt der Wahlsysteme, ihrer Vor- und Nachteile, ihrer Gerechtigkeitsansprüche und ihrer Auswirkungen auf politische Stabilität. Verpassen Sie nicht die Chance, Ihr Verständnis von Demokratie und politischer Repräsentation grundlegend zu erweitern.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Die beiden Grundtypen der Wahlsysteme
2.1 Die relative Mehrheitswahl
2.2 Die reine Verhältniswahl
3 Die beiden Wahlsystemgrundtypen im Vergleich
3.1 Das Wahlsystem und die Parteienlandschaft
3.2 Das Wahlsystem und das Wahlverhalten
3.3 Das Wahlsystem und die Funktionalität
3.4 Das Wahlsystem und die Gerechtigkeit
4 Fazit
5 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Zwei Grafiken sind es, die man als Fernsehzuschauer am Abend einer Parlamentswahl immer wieder vor Augen geführt bekommt: Zum einen die Grafik, die die Stimmenanteile der einzelnen Parteien aufzeigt, zum anderen die Grafik, die die Mandatsverhältnisse im Parlament darstellt. Das Wahlsystem – das Verfahren, das zwischen Stimmenabgabe und Mandatszuteilung liegt – wird dabei in der Regel nicht erklärt. Seine Funktion ist es, die Wählerstimmen in Parlamentsmandate umzuwandeln. Dadurch kommt ihm eine große Bedeutung für das politische System zu.
Unterschiedliche Umwandlungsmethoden führen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Daher prägt das Wahlsystem 1.) die Parteienlandschaft, denn es entscheidet mit darüber, welcher Partei in welchem Maße politische Macht zukommt. 2.) wird auch das Wahlverhalten beeinflusst, denn verschiedene Wahlsysteme gestalten die Aussichten einzelner Parteien auf Wahlerfolg unterschiedlich, wodurch der Wähler jeweils vor eine andere Entscheidungssituation gestellt wird. Das Wahlsystem regelt die Mehrheitsverhältnisse im Parlament und lässt sich somit 3.) auch hinsichtlich seiner Funktionalität bewerten. Zum Beispiel kann man fragen, ob es ein stabiles Regierungssystem ermöglicht. Und man kann untersuchen, wie es die einzelnen Wählerstimmen verwertet, ob es also 4.) gerecht mit ihnen umgeht. Das Wahlsystem ist somit mehr als ein rein technischer Prozess.
Die Zahl der unterschiedlichen Wahlsysteme, die weltweit Bestand haben, beläuft sich auf mehrere hundert. Sie alle einzeln zu bewerten, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Hinsichtlich der grundlegenden klassifikatorischen Unterscheidung der Wahlsystemforschung lassen sie sich jedoch alle Wahlsysteme in Mehrheitswahlsysteme einerseits und Verhältniswahlsysteme andererseits einteilen[1]. Beide Grundsysteme werden sowohl kritisiert als auch positiv bewertet. Ich werde in dieser Arbeit die Kritik und das Lob an beiden Grundsystemen nachzeichnen und damit folgendes Ziel verfolgen: Ich möchte zeigen, dass man beim Vergleich der Grundsysteme keinem von beiden pauschal Vor- oder Nachteile zuschreiben kann. Keines von beiden ist „besser“ oder „schlechter“. Darüber hinaus ist es sehr schwer, ihnen bestimmte Effekte zwangsläufig zu unterstellen.
Ich werde zunächst beide Grundsysteme erklären. Anschließend werde ich sie hinsichtlich der oben angedeuteten Fragestellungen vergleichen. Grundlage für die Ausarbeitung dieser Arbeit ist ausschließlich die Verwendung von Sekundärliteratur.
2 Die beiden Grundtypen der Wahlsysteme
Bei der Erläuterung der Grundzüge von Mehrheits- und Verhältniswahl werde ich mich auf die jeweiligen Grundtypen beschränken, zum einen auf die relative Mehrheitswahl, zum anderen auf die reine Verhältniswahl[2]. Die Darstellung sämtlicher Variationen beider Grundsysteme wäre zu umfangreich. Darüber hinaus wird zu erkennen sein, dass sich Kritik und Lob, die beim Vergleich von Mehrheits- und Verhältniswahl geäußert werden, größtenteils auf diese beiden Grundtypen beziehen. Die Einschränkung hat somit Sinn.
2.1 Die relative Mehrheitswahl
Die Regel der Mehrheitswahl – ein Entscheidungsprinzip, nach dem die Mehrheit der Stimmen entscheiden soll – entstand im 5. Jahrhundert n. Chr. und trat damals an die Stelle der Einstimmigkeit[3].
Der Grundtyp der modernen Mehrheitswahl ist die relative Mehrheitswahl in Einmannwahlkreisen. In ihr wird das gesamte Wahlgebiet in so viele Wahlkreise eingeteilt, wie Abgeordnete in das Parlament zu wählen sind. In der Regel sind es die verschiedenen Parteien, die in jedem Wahlkreis einen eigenen Wahlkreiskandidaten aufstellen. Der Wähler hat eine Stimme, er wählt in direkter Personenwahl einen der Kandidaten, die in seinem Wahlkreis um das Wahlkreismandat wetteifern. Als Sieger gilt, wer im Wahlkreis die meisten Stimmen auf sich vereinen konnte. Zwei Dinge spielen hierbei keine Rolle: 1.) ist es nebensächlich, ob ein Kandidat den Wahlkreis mit großem Abstand oder denkbar knapp gewinnt. 2.) sind die Stimmenanteile, die den einzelnen Parteien im gesamten Wahlgebiet zukommen, unerheblich für die Vergabe der Mandate. Was zählt, sind die Ergebnisse in den einzelnen Wahlkreisen.
Beide Sachverhalte möchte ich anhand eines fiktiven Wahlergebnisses I erklären. Betrachtet wird ein Wahlgebiet mit einer Million wahlberechtigter Einwohner, welches in zehn Wahlkreise mit jeweils 100000 Wahlberechtigten eingeteilt ist. Ich gehe von einer 100%igen Wahlbeteiligung aus. Es gibt vier Parteien, die in jedem Wahlkreis jeweils einen Kandidaten aufstellen. Fett gedruckt sind die Stimmenzahlen, die im jeweiligen Wahlkreis zum Sieg geführt haben.
Wahlergebnis I
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Es ist deutlich zu sehen: 1.) sind die knappen Wahlerfolge der Kandidaten der Partei A in den Wahlkreisen 2 und 9, in Mandaten ausgedrückt, genauso viel wert wie die deutlichen Siege der Kandidaten der Partei B in den Wahlkreisen 4 und 8. 2.) kommt Partei A trotz ihres knappen Stimmenvorsprungs vor Partei B im gesamten Wahlgebiet von gerade einmal 0,2% bei der Mandatsvergabe deutlich besser davon als ihre schärfste Mitkonkurrentin.
Beides veranschaulicht recht deutlich, wie sich die Vorstellung von parlamentarischer Repräsentation im Mehrheitswahlsystem am Mehrheitsprinzip orientiert. Die Mehrheitswahl ähnelt einem sportlichen Wettkampf: Gewonnen hat, wer als Erster durchs Ziel kommt, unabhängig vom Abstand zum Zweitplazierten. Die Intension der Mehrheitswahl ist es, „eine Partei mittels parlamentarischer Mehrheitsbildung zur Regierungsbildung zu befähigen“[4]. In dem hier gewählten Beispiel wird ein 0,2%iger Stimmenvorsprung im gesamten Wahlgebiet in einen 40%igen Mandatsvorsprung umgewandelt, was eine stabile Regierungsmehrheit bedeutet. Liegt ein solcher Fall vor, in dem eine Partei ohne absolute Stimmenmehrheit nach der Mandatszuteilung über eine absolute Parlamentsmehrheit verfügt, spricht man von einer „manufactured majority“, von einer durch das Wahlsystem erzeugten Mehrheit – von einer „earned majority“ wird gesprochen, wenn eine Partei bereits vor der Mandatszuteilung über eine absolute Stimmenmehrheit verfügt[5]. Dass also Stimmenanteil und Mandatsanteil stark auseinander gehen können, wird im Mehrheitswahlsystem in Kauf genommen. Diese Disproportion zwischen Stimmen und Mandaten ist ein „natürlicher Effekt“[6] der Mehrheitswahl.
2.2 Die reine Verhältniswahl
Der Gedanke der Verhältniswahl hat seine Wurzeln im Rationalismus und in der Aufklärung[7], entstand also historisch nach der Regel der Mehrheitswahl. Er ist eng verbunden mit dem Wunsch, dass das Verhältnis der politischen Strömungen im Parlament dem Verhältnis der politischen Strömungen im ganzen Land entsprechen solle.
Der Grundtyp der Verhältniswahl ist die reine Verhältniswahl. Bei ihr wird das gesamte Wahlgebiet in möglichst wenig Wahlkreise eingeteilt – im Extremfall wird es gar nicht unterteilt –, in denen Parteilisten zu Abstimmung stehen. Jede Partei erstellt im Vorfeld der Wahl eine Liste, auf der Parteimitglieder, die für ein Mandat in Frage kommen, in einer bestimmten Reihenfolge nominiert sind. Der Wähler hat eine Stimme, die er einer gesamten Liste und nicht einem einzelnen Kandidaten gibt, er wählt eine geschlossene Liste. Gewinnt eine Partei bei einer Wahl zum Beispiel 75 Mandate, so ziehen die Parteimitglieder in das Parlament ein, die auf den Listenplätzen 1 bis 75 platziert waren.
Die Mandatszuteilung im reinen Verhältniswahlsystem verläuft nach dem automatischen Zuteilungsverfahren. Vor der Wahl wird eine Anzahl an Stimmen festgelegt, die für ein Mandat benötigt wird. Die Stimmenanzahl, die jede Partei auf sich vereinen konnte, wird dann durch diese festgelegte Zahl geteilt, der Quotient ergibt die Anzahl der der jeweiligen Partei zustehenden Mandate.
Dies möchte ich anhand eines fiktiven Wahlergebnisses II verdeutlichen. Betrachtet wird ein Wahlgebiet mit einer Million wahlberechtigter Einwohner. Das Wahlgebiet ist nicht unterteilt, auf 10 000 Stimmen entfällt ein Mandat. Ich gehe von einer 100%igen Wahlbeteiligung aus. Es stehen fünf Parteienlisten zur Wahl.
Wahlergebnis II
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
An diesem stark vereinfachten Beispiel ist der Unterschied zwischen Verhältniswahl und Mehrheitswahl gut zu erkennen. Während im Beispiel der Mehrheitswahl eine relativ starke Partei wie Partei C bei der Mandatsvergabe leer ausgeht – sie kommt nicht an die Stärke der beiden dominierenden Parteien A und B heran –, ziehen bei der Verhältniswahl neben den starken Parteien E und F auch die schwächeren Parteien G, H sowie I ins Parlament ein. Sie alle konnten die Mindeststimmenanzahl von 10 000 Wählerstimmen auf sich vereinen. Deutlich zu erkennen ist, dass bei einer Verhältniswahl der Disproportionseffekt zwischen Stimmenanteil einer Partei und ihrem Mandatsanteil sehr gering ist – im oben aufgeführten Beispiel ist der Unterschied sogar gleich Null. Die Repräsentationsvorstellung in einem Verhältniswahlsystem orientiert sich am Prinzip der Proportionalität. Ziel der Verhältniswahl ist es, „im Parlament ein getreues (partei-)politisches Abbild der Wählerschaft hervorzubringen“[8].
Da nach einer Verhältniswahl in der Regel eher selten eine einzige Partei über eine absolute parlamentarische Mehrheit verfügt[9], schließen sich in solchen Wahlsystemen meistens mehrere Parlamentsfraktionen ähnlicher politischer Orientierung zu einer Koalition zusammen, um so eine Regierungsmehrheit zu bilden.
Das automatische Zuteilungsverfahren sorgt für eine fast uneingeschränkte Anwendung des Proportionalitätsgedanken. Es bewirkt jedoch, dass sich die Gesamtzahl der zu vergebenden Mandate abhängig von der Anzahl der abgegebenen Stimmen verändert. Wären im Wahlergebnis II 100 000 Menschen mehr wahlberechtigt und würden das nächste Mal zur Wahl gehen, dann würde sich die Gesamtzahl der Mandate um zehn erhöhen – 100 000 Stimmen dividiert durch 10 000 Stimmen, die für eine Mandat benötigt werden, ergibt zehn Mandate mehr. Heutzutage werden daher in der Regel verschiedene mathematische Verrechnungsverfahren verwandt, mit denen eine feste Zahl von Parlamentsmandaten nach den Stimmenanteilen der Parteien verteilt wird. Diese Verfahren wahren zwar annäherungsweise das Verhältnis von Stimmenanteil zu Mandatsanteil einer Partei, sie haben jedoch unterschiedliche Auswirkungen auf die Mandatsverteilung[10].
3 Die beiden Wahlsystemgrundtypen im Vergleich
Der Vergleich beider Grundtypen wird sich an vier Fragestellungen orientieren: 1.) Welche Auswirkung hat das Wahlsystem auf die Parteienlandschaft eines Landes? 2.) Welche Auswirkungen hat es auf das Wahlverhalten der Bevölkerung? 3.) Trägt das Wahlsystem zur Funktionsfähigkeit des Staates bei? 4.) Ist das Wahlsystem gerecht?
3.1 Das Wahlsystem und die Parteienlandschaft
Eine Auswirkung auf die Parteienlandschaft, die mit der Mehrheitswahl in Verbindung steht, kann anhand des oben aufgeführten fiktiven Wahlergebnisses I gut erklärt werden: Mehrheitswahlsystemen wird nachgesagt, dass sie zu einem Zweiparteiensystem führen[11]. Das beachtliche Wahlergebnis von Parteien C – immerhin 21% der Wählerstimmen – ändert nichts an der Tatsache, dass es ihr nicht gelingt, einen Wahlkreis für sich zu entscheiden. Auch bei der nächsten Wahl dürfte es ihr schwer fallen, ein Mandat zu gewinnen. In Wahlkreis 10, dem Wahlkreis, in dem Partei C einem Mandatsgewinn am nähsten gekommen ist, trennen sie 12 000 Stimmen vom Wahlerfolg. Allein hier müsste sie ihren Stimmenanteil um fast 50% steigern – ein unwahrscheinliches Unterfangen. Die Aussichten für Partei D, bei einer späteren Wahl ein Mandat zu gewinnen, müssen ebenso als nicht erfolgsversprechend angesehen werden. Emil Hübner schreibt hierzu: „[…] eine Partei, die in einem Wahlkreis nicht mindestens 30 bis 40% der Stimmen auf sich vereinigen kann, hat keine Chance, vertreten zu werden […]“[12]. Dies kann als ein „mechanischer Faktor“[13] der Mehrheitswahl bezeichnet werden.
Eine positive Konsequenz dieses Effektes auf die Parteienlandschaft ist seine hemmende Wirkung gegenüber der Spaltung einer Partei. Partei A gewinnt im Wahlergebnis I ihre Wahlkreise größtenteils mit knappem Stimmenvorsprung. Zerbräche sie in zwei Splitterparteien, die sich die Wählerschaft von Partei A dann aufteilen würden, wäre sehr wahrscheinlich keine der beiden neuen Gruppierungen in der Lage sein, gegen Partei B zu bestehen. Die Spaltung hätte also machtpolitisch mehr Nachteile als Vorteile für die Nachfolgeparteien von Partei A. Die Mehrheitswahl macht Spaltungen somit nicht nur zu unattraktiven Alternativen, sie ermutigt umgekehrt eher zur Zusammenarbeit.
Die Tendenz, Parteien mit einem geringeren Stimmenanteil von der parlamentarischen Repräsentation auszuschließen, ist in einem System der Verhältniswahl nicht zu erkennen. Parteien bestimmter Interessengruppen – so genannte Interessensparteien –, die flächen-deckend einen zwar verhältnismäßig geringen, aber konstanten Stimmenanteil auf sich vereinen können, werden bei der Verhältniswahl davor geschützt, in die politische Bedeutungslosigkeit zu versinken. Im Wahlergebnis II ist dies gut an den Parteien G und H zu erkennen. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass sich in einem Verhältniswahlsystem dominierende Parteien herausbilden, auf die sich dann das Wählerinteresse konzentriert[14].
Zu sagen, dass kleine Parteien in der Verhältniswahl generell geschützt und in der Mehrheitswahl grundsätzlich ausgeschlossen werden, ist jedoch zu voreilig. Dies wird anhand von Regional- oder Lokalparteien deutlich. Diese Parteien sind eher in überschaubaren Gebieten politisch aktiv, haben dort unter Umständen einen relativ starken Zulauf an Wählern, sind aber für das sonstige Wahlgebiet kaum von Bedeutung. Während solche Parteien in der Verhältniswahl auf Grund ihres geringen Stimmenanteils im gesamten Wahlgebiet bei der Mandatsvergabe leer ausgehen können, kann ihnen ihre regionale Stärke dazu verhelfen, einen oder zwei Wahlkreise im Mehrheitswahlsystem zu gewinnen, womit sie im Parlament vertreten wären. Es lässt sich also sagen: „die Verhältniswahl schützt eher Interessensparteien, die Mehrheitswahl eher Lokalparteien“[15].
Aus einem Mehrheitswahlsystem lässt sich jedoch nicht zwangsläufig der Trend zum Zweiparteiensystem schließen, ebenso wie die Verhältniswahl nicht zwangsläufig zum Mehrparteiensystem führen muss. Vielmehr schwankt die Bedeutung des Wahlsystems auf die Strukturierung der Parteienlandschaft, das Wahlsystem ist einer von vielen sozialen und politischen Faktoren, die Einfluss auf die Parteienlandschaft haben[16].
3.2 Das Wahlsystem und das Wahlverhalten
Die sich auf zwei Parteien konzentrierende Wirkung der Mehrheitswahl kann durch das Wählerverhalten zusätzlich verstärkt werden. Es ist möglich, dass Wähler schwächerer Parteien aufgrund der sich andeutenden Chancenlosigkeit ihrer Partei im eigenen Wahlkreis, als Kompromisslösung eine der stärkeren Parteien wählen, um damit ihrer Wählerstimme einen Anteil am politischen Entscheidungsprozess zu erhalten. Diese Auswirkung, die Maurice Duverger als „psychologischen Effekt“[17] bezeichnet, kann als eine wahltechnische Reduktion der Entscheidungsalternativen auf zwei gesehen werden. Ihre möglichen Nebeneffekte erscheinen für das politische System kaum wünschenswert: Ein Zweiparteien-system tendiert stark dazu, dass sich für die Parteien „sichere Wahlkreise“[18], so genannte Parteihochburgen, herausbilden. In ihnen ist es möglich, dass ein Großteil der Wähler der schwächeren Partei aufgrund von Wahlverdrossenheit der Wahl fernbleibt. Parteien würden dann in Gebieten, in denen sie nur auf eine kleine Wählerschaft bauen können, „verprovinzialisieren“[19], was die Verödung der politischen Landschaft bewirken würde.
Die Tendenz zum Zweiparteiensystem wird der Mehrheitswahl von ihren Befürwortern wahltechnisch gesehen jedoch zu Gute gehalten. Zunächst sorge sie für eine politische Mäßigung beider großen Parteien, da nur so vor allem die zwischen den Parteien stehenden Wechselwähler zu gewinnen seien[20]. Die Mehrheitswahl begünstigt demnach die politische Integration – dies kann jedoch dazu führen, dass die beiden großen Parteien in ihrer jeweiligen Regierungsweise kaum mehr zu unterscheiden sind. Der Wähler muss sich zwischen diesen beiden Alternativen entscheiden, was eine politische Willensbildung zur Folge hätte. Anders sei es bei der Verhältniswahl, die hinsichtlich ihrer Auswirkung auf das Wahlverhalten als ein Wahlsystem „[passiver] Natur“[21] bezeichnet wird, welches die Meinung der Wähler zwar messe, sie aber nicht bilde. Wie gezeigt wurde, haben in der Verhältniswahl Parteien, die nur einen geringen Teil der Wähler hinter sich bringen können, gute Chancen, im Parlament vertreten zu sein. Somit hat auch jeder Wähler die Möglichkeit, sich die Partei zu suchen, die seine Interessen am ehesten in uneingeschränkter Form vertritt. Dies, so die Kritik, fördere die politische Desintegration der Parteienlandschaft und unterstütze die Parteienzersplitterung.
Der letzte Kritikpunkt greift jedoch ein wenig zu kurz. Er bezieht sich stark auf die reine Verhältniswahl, in der selbst Parteien mit einem minimalen Stimmenanteil ins Parlament einziehen können, was gut an Partei I aus dem Wahlergebnis II zu sehen ist. Dies liegt daran, dass die reine Verhältniswahl außer einer Mindeststimmenanzahl, die für ein Mandat benötigt wird, keine weiteren Schranken setzt, um den Parlamentseinzug einer Partei zu erschweren. Diese Form der Verhältniswahl wird jedoch heutzutage in den wenigsten dominanten Verhältniswahlsystemen angewendet[22]. Üblich ist, dass in Verhältniswahlsystemen so genannte Sperrklauseln angesetzt werden, welche den Parlamentseinzug davon abhängig machen, ob eine Partei einen bestimmten Prozentsatz der insgesamt abgegebenen gültigen Wählerstimmen erreichen konnte. In der Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel liegt diese Sperrklausel auf Bundesebene seit 1956 bei 5% der abgegeben gültigen Zweitstimmen[23]. Partei I wäre mit einer solchen Sperrklausel bei der Mandatsvergabe nicht berücksichtigt worden. Diese Tatsache verschiebt zwar das Prinzip der reinen Proportionalität von Stimmen und Mandaten entscheidend. Gerechtfertigt werden solche Klausel jedoch mit der Begründung, dass sie der Wahl von Splitterparteien vorbeugen und damit zur Arbeits- und Funktionsfähigkeit eines Parlamentes beitragen.
In der Verhältniswahl, so ein weiterer Kritikpunkt, hätte der Wähler nicht die Möglichkeit, eine verantwortliche Wahl darüber zu treffen, welche Partei zu regieren und welche Parteien die Opposition zu bilden habe, da Regierung und Opposition gar nicht wirklich zu unterscheiden seien. Vielmehr müssten sehr häufig Koalitionen geschmiedet werden, bei denen es im Voraus oft schwer abzuschätzen sei, welche Rolle die von einem selbst gewählte Partei im Parlament in Endeffekt tatsächlich einnehmen wird und welcher Anteil an der politischen Verantwortlichkeit ihr tatsächlich zukommt. Dem kann jedoch entgegengehalten werden, dass das Spektrum an Koalitionsmöglichkeiten nicht willkürlich ist, da es durch frühere Politik und auch durch Koalitionsaussagen im Wahlkampf eingegrenzt wird.
Dennoch kann sich der Gedanke aufdrängen, dass die Wahl im Mehrheitswahlsystem bewusster geschieht, da es sich bei der Mehrheitswahl um eine direkte Wahl von Persönlichkeiten, die im Wahlkreis gegeneinander antreten, handelt. Der Kontakt zwischen Wählern und Kandidaten sei hier enger als bei der Verhältniswahl, bei der die „anonyme Liste“[24] den Wahlprozess dominiere. Hier sollten jedoch drei Dinge betont werde: 1.) enthält die direkte Personenwahl auch anonyme Elemente, da der Wähler auf die Nominierung der Wahlkreiskandidaten im Mehrheitswahlsystem in der Regel ebenso wenig Einfluss hat, wie im Verhältniswahlsystem auf die Zusammenstellung der Parteiliste[25]. 2.) kann eine enge Bindung zwischen Wahlkreiskandidaten und Wählern auch negative Folgen haben. Man kann von einer Art „Entfremdung“[26] sprechen, wenn die Interessen eines Wählers bei der Niederlage des von ihm bevorzugten Kandidaten vom Kandidaten einer anderen Partei im Parlament vertreten werden. Dies ist vor allem ein Problem in Parteihochburgen für Wähler der schwächeren Partei. Und 3.) ist zu erkennen, dass sich der Wähler bei der Entscheidung im Wahlkreis schon seit längerem eher an der Partei und ihrem Parteichef orientiert als an der Persönlichkeit des Wahlkreisabgeordneten[27].
Es lässt sich somit zwar durchaus sagen, dass die Mehrheitswahl die Entscheidungs-möglichkeiten für den Wähler tendenziell einschränkt, während die Auswirkung der eigenen Wahlentscheidung auf die Regierungs- beziehungsweise die Oppositionszusammensetzung bei der Verhältniswahl schwerer abzuschätzen ist. Dass eine Wahlentscheidung bei der direkten Personenwahl im Mehrheitswahlsystem bewusster ist als die Wahl einer anonymen Liste im Verhältniswahlsystem, lässt sich dagegen nicht behaupten. Bezüglich des Grades an politischer Integration kann zwar gesagt werden, dass er im Zweiparteiensystem der Mehrheitswahl tendenziell höher liegt als bei der reinen Verhältniswahl. Die Verhältniswahl mit Sperrklausel muss dem jedoch in nichts nachstehen. Darüber hinaus ist es generell eher schwer, von der Anzahl der verschiedenen Parteien auf den Grad der politischen Desintegration beziehungsweise der Polarisierung zu schließen[28].
3.3 Das Wahlsystem und die Funktionalität
Ein Wahlsystem kann hinsichtlich seiner Funktionalität danach beurteilt werden, „ob es dem Staate das gibt, was der Staat braucht“[29], also zum Beispiel, ob es die Chance eines Regierungswechsels erleichtert oder diese zumindest nicht erschwert. Dies muss vor allem der Mehrheitswahl positiv angerechnet werden. Wie in Wahlergebnis I gezeigt wurde, tendiert die Mehrheitswahl dazu, bei der Umwandlung von Stimmenanteilen in Mandatsanteile deutliche Mehrheiten und damit die Grundlage für eine stabile Regierungsbildung zu erzeugen. „Manufactured majorities“ kommen in Mehrheitswahlsystemen deutlich öfter vor, als in Verhältniswahlsystemen[30]. Gleichzeitig ist festzustellen, dass ein Mehrheitswahlsystem auf geringe Verschiebungen von Wählerstimmen sehr sensibel mit großen Veränderungen der Sitzanteile im Parlament reagieren kann. Betrachtet man das Wahlergebnis I, so ist zu sehen, dass Partei A all ihre Wahlkreismandate mit knappem Vorsprung gewinnen konnte. Der Abstand zu Partei B ist in den Wahlkreisen 1 und 5 mit 5 000 Stimmen am deutlichsten. Bei der nächsten Wahl würde eine Verschiebung von 2 000 Stimmen – also eine Verschiebung von 2% der Wählerstimmen – von Partei A zu Partei B dafür sorgen, dass Partei B neben den bisherigen Wahlkreisen 3, 4 und 8 auch die Wahlkreise 2, 6, 7 und 9 für sich entscheiden könnte, während Partei A nur die Wahlkreise 1 und 5 blieben – Wahlkreis 10 würde sich sehr knapp entscheiden. Im Extremfall würde eine 2%ige Stimmenverschiebung dafür sorgen können, dass sich die Mehrheitsverhältnisse in Parlament von 7:3 für Partei A zu 8:2 für Partei B umdrehen.
Diese Sensibilität der Mehrheitswahl kann sehr positive Effekte nach sich ziehen. Zum einen nimmt sie die Regierung eher in die Pflicht. Diese muss sich bei ihrer Arbeit am wirklichen Willen des Volkes orientieren und vor allem in unsicheren Wahlkreisen in engen Kontakt mit den Wählern treten, da politische Fehlhandlungen durch geringe Wählerwanderung, wie gezeigt, hart bestraft werden können – dem kann entgegengehalten werden, dass die Regierung in einem solchen Wahlsystem eher dazu tendiert, populäre Politik zu machen und heikle Themen zu meiden. Zum anderen wird die Opposition dazu angehalten, nicht in unverantwortlichen Radikalismus zu verfallen und eine wählbare Alternative zur Regierung zu bilden, da sie jederzeit mit der Übernahme der politischen Verantwortung rechnen muss. Die Mehrheitswahl kann also entscheidend dazu beitragen, dass parlamentarisches Regieren und Kontrollieren mittels der Chance des Machtwechsels optimal verwirklicht werden können. Verfechter der Mehrheitswahl behaupten, „sie entspreche in parlamentarischen Regierungssystemen den institutionellen Bedingungen“[31].
Es muss jedoch bedacht werden, dass dies größtenteils für ein Parteiensystem gilt, in dem sich zwei in etwa gleichstarke Parteien gegenüber stehen und in dem die Bindung der Wähler an die jeweilige Partei so gering ist, dass umfangreiche Wählerwanderungen möglich sind – obwohl auch hier kritisch gefragt werden kann, wie lange ein „Hoffnung-Frustration-Hoffnung-Mechanismus“[32], der die Wähler von einer großen Partei zu anderen treibt, auf Dauer zufrieden stellend sein kann. Als äußerst bedenklich muss dagegen angesehen werden, wenn sich in einem Mehrheitswahlsystem ein Parteiensystem mit einer dominierenden Partei herausbildet, die dann in den Wahlkreisen in der Lage sein kann, eine Quasi-Monopolstellung einzunehmen. Gelingt es einer anderen Partei dann nicht, sich stimmenmäßig anzunähern, kann ein Wechsel der Mehrheitsverhältnisse und damit ein Regierungswechsel in solchen Systemen beinahe unmöglich werden[33].
Nichtsdestotrotz wird der Mehrheitswahl zu Gute gehalten, dass sie in der Regel die Regierung und die Opposition klar trennt – dies tut sie insbesondere dann, wenn sich ein Zweiparteiensystem herausbildet –, was das Parlament handlungsfähiger macht. Der Verhältniswahl hingegen wird vorgeworfen, dass sie tendenziell Minderheiten stärke und dadurch die Regierungsbildung und den parlamentarischen Entscheidungsprozess erschwere. Der Wunsch nach einem Parlament, das „eine verkleinerte Landkarte der Schichten des Volkes“[34] darstellt, wurde schon früh kritisch betrachtet. 1918 äußerte sich der britische Abgeordnete Sir Austin Chamberlain in einer Unterhausrede abfällig über die Forderung, die Wahl solle „ein Unterhaus zustande bringen […], das ein Mikrokosmos der Nation ist“[35]. Ein solcher Mikrokosmos sei machtlos, so Chamberlain weiter, das Parlament würde durch ihn nicht zum Ort einer entscheidungsfähigen Versammlung, sondern zu einem Marktplatz, in dem gehandelt und gefeilscht würde. Dies ist sicher zugespitzt ausgedrückt. Der Verhältniswahl wird jedoch durchaus vorgeworfen, dass sie die Bildung und Zusammenarbeit einer Mehrheitsregierung erschwert, denn gerade die Koalitionsbildungen werden von Gegnern der Verhältniswahl als disfunktional für die politische Arbeit betrachtet. In Koalitionen müssten die beteiligten Parteien auf wesentliche Teile ihrer Wahlkampfforderungen verzichten[36] – dies kann aber auch als Ausdruck einer kompromissbereiten politischen Kultur gesehen werden – und Koalitionen führten zur Verwischung der politischen Verantwortlichkeit[37]. Vor allem auf die bevorzugte Position der kleineren Parteien wird hingewiesen. Da diese benötigt würden, um eine Mehrheit zu erzeugen, käme ihnen mehr politischer Einfluss zu, als es der Stärke ihres Wähleranhangs entspräche.
Auch die Rolle der in der Regel aus mehreren Parteien bestehenden Opposition im Verhältniswahlsystem wird kritisch gesehen. Durch den Versuch, sich zu profilieren, neigten die Oppositionsparteien dazu, sich gegenseitig in Kritik und Versprechungen zu überbieten, wodurch sie sich politisch voneinander entfernen würden. Vor allem gemäßigte Oppositionsparteien, die noch am ehesten koalitionsfähig sind, würden sich hierbei gegenseitig Wählerstimmen streitig machen[38], während radikale Parteien, die seltener mit der Regierungsverantwortung zu rechnen haben, sich dadurch mehr und mehr in ihrer oppositionellen Haltung versteifen würden. Die Konsequenz wäre somit eine uneinheitliche und radikalisierte Opposition.
Es ist sicherlich ein unschöner Effekt der Verhältniswahl, dass radikale Parteien, die im Verhältnis zu den dominierenden Parteien einen relativ geringen Stimmenanteil auf sich vereinen können, ins Parlament einziehen können, um dieses als Propagandaforum zu benutzen. In einem Mehrheitswahlsystem würden diese sicher nicht so einfach ins Parlament einziehen, da es zu bezweifeln ist, dass sie in der Lage wären, ganze Wahlkreis für sich zu entscheiden. Andererseits kann nicht geleugnet werden, dass die parlamentarische Konfrontation mit radikalen Kräften auch den positiven Effekt haben kann, dass diese ihre Anziehungskraft verlieren. Auf jeden Fall sind die etablierten Parteien in einer solchen Situation dazu gezwungen, sich mit radikalen Parteien auseinander zu setzen und sich ihnen gegenüber zu positionieren. Im Mehrheitswahlsystem besteht jedoch nicht unbedingt der Druck, sich „durch 10% radikale Wähler […] aus der Ruhe bringen zu lassen“[39]. Die hemmende Wirkung der Mehrheitswahl gegenüber Parteien, die Krisensituationen zur Profilierung ausnutzen wollen, kann somit auch problematische Effekte haben, zum Beispiel wenn sich in den aus dem Parlament ausgeschlossenen Interessenklubs „ein Märtyrerbewusstsein“[40] entwickeln. Das Problem der zur Starrheit tendierenden Unempfindlichkeit der Mehrheitswahl gegenüber radikalen Strömungen beschreibt Hans Meyer treffend: „[Der] Damm hält entweder, oder er bricht; dann aber sind die Folgen verheerend“[41].
Dennoch drängt sich die Meinung auf, dass ein Mehrheitswahlsystem hinsichtlich seiner Funktionalität gewisse Vorteile gegenüber der Verhältniswahl aufweist. Es scheint die Regierungsbildung und den Machtwechsel zu erleichtern, trennt Regierung und Opposition in der Regel klar voneinander ab und mäßigt diese in der Ausübung ihrer jeweiligen politischen Aufgabe. Vor allem die hemmende, verlangsamende Schaffung von Mehrheiten mittels Koalitionsbildung und die Tendenz zur Radikalisierung der Opposition können der Verhältniswahl von einer funktionalistischen Betrachtungsweise her gesehen vorgeworfen werden.
3.4 Das Wahlsystem und die Gerechtigkeit
Die Frage, ob ein Wahlsystem einem Staat auch das gibt, was er braucht, muss jedoch nicht nur hinsichtlich der Funktionalität des Wahlsystems gestellt werden. Es kann auch gefragt werden, ob ein Wahlsystem für eine gerechte Repräsentation der Bevölkerung im Parlament sorgt, indem es auf eine gerechte Art und Weise die Stimmenanteile der gewählten Parteien in Mandate umwandelt. Diesbezüglich wird die Mehrheitswahl stark kritisiert. In ihr sei die politische Repräsentation verzerrt, da sie vor allem bei der Ausbildung eines Parteiensystems mit zwei dominierenden Parteien Drittparteien konstant, sowie die Oppositionspartei teilweise unter-, die Regierungspartei dagegen notwendigerweise überrepräsentiere[42]. Der in Abschnitt 3.3 aufgezeigte stabilisierende Effekt der Mehrheitswahl wird demnach auf Kosten kleinerer Parteien erzielt. Dies, so die Kritiker der Mehrheitswahl, führe durch die übermäßige politische Integration und Konzentration der Macht zu „oligarchischen Verhältnissen“[43], in denen neue politische Strömungen hinsichtlich der parlamentarischen Repräsentation benachteiligt und traditionelle Führungsgruppen abgestützt werden.
Die bedenklichste Verzerrung der politischen Repräsentation ist im Mehrheitswahlsystem dann erreicht, wenn bei der Mandatsverteilung das Ergebnis nach Stimmenanteilen umgedreht wird. Gemeint ist der Moment, in dem eine Partei, die nicht die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen konnte, die Mehrheit der Mandate erhält; eine Situation, die den Vorwurf an die Mehrheitswahl, sie gleiche einer „Wahllotterie“[44], als nicht unberechtigt erscheinen lässt.
Diesen möglichen Wahlausgang möchte ich mit Blick auf Wahlergebnis I verdeutlichen. Es wird die Situation angenommen, dass Partei A bei der nächsten Wahl in den Wahlkreisen 1, 5, 6 und 10 etwas schlechter abschneidet und jeweils 1 000 Wählerstimmen an Partei B verliert – das restliche Ergebnis soll der Einfachheit halber unverändert bleiben. Partei A wäre nach wie vor in der Lage, ihre sieben Wahlkreismandate zu verteidigen, käme im gesamten Wahlgebiet diesmal jedoch nur auf 37,1% der Wählerstimmen, während Partei B, die unverändert 3 Wahlkreismandate gewinnt, diesmal 37,7% der Wählerstimmen auf sich vereinen könnte. Die Parlamentsmehrheit von Partei A würde somit einer Wählerminderheit vertreten. Ein Zustand, der ungerecht erscheint und die Irrationalität des Wahlergebnisses verdeutlicht, die sich aus den abgeschlossenen Einzelwahlkreisen ergibt.
Die Umkehrung der Kräfteverhältnisse zwischen den Parteien bei der Umwandlung von Stimmen in Mandaten ist bei der Verhältniswahl nicht möglich. Doch nicht nur deshalb gilt sie für viele als gerechter. Ihr wird darüber hinaus zu Gute gehalten, dass sie durch die Senkung der Repräsentationsschwelle dafür sorgt, dass bei der Mandatsvergabe keine abgegebene gültige Stimme verloren geht, solange noch Mandate zu vergeben sind. Bei Mehrheitswahl wird nämlich vor allem als kritisch angesehen, dass die Stimmen, die für die unterlegenen Wahlkreiskandidaten abgegeben werden, bei der Mandatsvergabe gänzlich unberücksichtigt bleiben. Der Erfolgswert jeder einzelnen Stimme ist somit nicht gewährleistet, selbst wenn alle Stimmen den gleichen Zählwert besitzen, also nicht unterschiedlich stark gewichtet würden. Die Tatsache, dass die Stimmenanteile der Unterlegenen als verloren gelten können, wird von vielen als mit dem Verständnis von Demokratie unvereinbar angesehen. Die Verhältniswahl dagegen wird als das Wahlsystem angesehen, das der demokratischen Entwicklung am ehesten entspricht, da in ihr jede Stimme nicht nur den gleichen Zählwert hat, sondern auch den gleichen Erfolgswert haben soll.
Doch auch in der Verhältniswahl ist die Gleichheit des Erfolgswertes jeder einzelnen Stimme nicht unbedingt gewährleistet. Dies ist gut am Wahlergebnis II zu sehen. Partei E hat einen 8%igen Stimmenvorsprung von Partei F, was nicht ausreicht, um alleine zu regieren. Zusammen mit Partei G kann Partei E eine stabile Regierungskoalition bilden, vorausgesetzt natürlich, beide Parteien sind zueinander koalitionsfähig – zu beachten ist, dass auch Partei F mit Partei G eine Regierungsmehrheit bilden kann. Die Position von Partei E gegenüber Partei F wäre aber nicht sonderlich besser, wenn das Stimmenverhältnis nicht 42% zu 34%, sondern 49% zu 27% betragen würde und auch nicht viel schlechter, wenn es bei 39% zu 37% läge. In beiden Fällen bräuchte Partei E nach wie vor einen Koalitionspartner, um eine Mandatsmehrheit im Parlament zu erzeugen. Somit haben ungefähr 10% der Wählerstimmen keinen wesentlichen Einfluss auf die parlamentarische Mehrheitsbildung, womit in diesem Beispiel 100 000 Wähler im Endeffekt keine Rolle für die Regierungsbildung spielen.
Damit ist gezeigt, dass beide Wahlsysteme Ungerechtigkeiten hinsichtlich des Wertes einer Stimme in sich tragen. Doch was ist bezüglich der parlamentarischen Repräsentation und der Gestaltung der Mehrheitsverhältnisse überhaupt gerecht? Welcher Maßstab ist bei der politischen Konfliktschlichtung als gerecht anzusehen? Ist es die demokratietheoretische Position des „majority rule“, das übliche Konfliktschlichtungsmuster des Rechts der Mehrheit, an dem sich die Mehrheitswahl orientiert? So gesehen scheint es berechtigt, wenn Carl Joachim Friedrich fragte: „Warum soll die Gerechtigkeit der Minderheit gegenüber vor [sic!] der Gerechtigkeit der Mehrheit Vorrang haben? Die Mehrheit verlangt, daß die Regierung handelt; das aber wird durch die Verhältniswahl verzögert oder überhaupt verhindert“[45]. Oder soll es ein Wahlsystem kleinen Bevölkerungsgruppen ermöglichen, parlamentarisch vertreten zu sein? Sind die Strategien der Verhältniswahl, der Proporz und das Aushandeln, der richtige Weg zur Beilegung von Konflikten? Gerade bei Gesellschaften, die sich aus verschiedenen ethnischen Gruppen zusammensetzen, birgt die Mehrheitswahl zum Beispiel eher Nachteile, da diese bei Dominanz einer ethnischen Gruppe wahrscheinlich zur Vorherrschaft einer Partei führen würde. Von der Verhältniswahl kann eine Minderung der Konflikte in ethnisch heterogenen Staaten erhofft werden[46], während die Mehrheitswahl zur Verschärfung von Minderheitenkonflikten beitragen kann[47].
Doch bereits technische Elemente der Wahlsysteme können zu großen Ungerechtigkeiten führen. Im Mehrheitswahlsystem spielt die Wahlkreiseinteilung – die so genannte Wahlkreisgeometrie – eine große Rolle für den gerechten Ausgang einer Wahl. Größe, Einwohnerzahl und soziale Zusammensetzung der Wahlbevölkerung der einzelnen Wahlkreise haben einen erheblichen Einfluss auf das Ergebnis einer Wahl und können sogar manipulierenden Charakter haben. Wenn zum Beispiel in Stadtgebieten im Vergleich mit ländlichen Gebieten durch eine mangelhafte Wahlkreiseinteilung die Anzahl der Wahlberechtigten pro Wahlkreis erheblich höher liegt, so kann das zu einer Verzerrung der politischen Repräsentation zu Gunsten der Landbevölkerung führen. Auch die Verhältniswahl ist gegen solche Ungerechtigkeiten im technischen Detail nicht immun. In ihr spielt das Verrechnungsverfahren zur Umwandlung von Stimmen in Mandate eine entscheidende Rolle und kann je nach Gestaltung sowohl größeren als auch kleineren Parteien zum Vorteil sein[48]. Es kann behauptet werden, dass für alle Wahlsysteme gilt, dass sie die Zahl der zur Wahl stehenden Parteien auf Parlamentsebene verringern und tendenziell die stärkeren Parteien bevorzugen – natürlich in unterschiedlichem Ausmaß[49].
Daher ist es zweifelhaft, ob behauptet werden kann, die Verhältniswahl sei generell gerechter als die Mehrheitswahl. Historisch gesehen muss jedoch betont werden, dass die Etablierung der Verhältniswahl in enger Verbindung zur Demokratisierung der politischen Systeme stand, die Hand in Hand ging mit der „[wachsenden] Einsicht in die Begrenzung der Anwendbarkeit des Mehrheitsprinzips“[50]. Die Tendenz zur Ablösung der Mehrheitswahl durch die Verhältniswahl zu Beginn des 20. Jahrhunderts lässt sich historisch erkennen, oft war die erste Verhältniswahl eines Landes auch die erste Wahl nach allgemeinem Wahlrecht[51]. Insofern erscheint es nicht ungerechtfertigt, das Verhältniswahlsystem als das gerechtere der beiden Wahlsystemtypen zu bezeichnen, denn es entspricht eher dem heutigen Verständnis von Demokratie, zu dessen Wesensmerkmalen die Berücksichtigung von Minderheiten gehört. Gegen die Forderung nach der möglichst getreuen Repräsentation der verschiedenen Gruppierungen der Bevölkerung im Parlament argumentiert jedoch Heiko Kaack: „Gegen diese Vorstellung läßt sich einwenden, daß der so verstandene Repräsentationsbegriff seine Basis verlosen hat […]. Über [dem Parlament] steht keine vom Vertrauen des Monarchen getragene Regierung mehr, sondern es bildet die Regierung aus den eigenen Reihen. Im Vordergrund steht daher für die Parlamente die Funktion der Regierungsbildung und –kontrolle“[52]. Ähnlich argumentiert Ignaz Seipel, wenn er sagt: „Das erste und einzige wesentliche Ziel des Wählers ist, dem Staat den möglichst besten, daher auch möglichst aktionsfähigen Gesetzgebungskörper zu geben und in diesem eine regierungsfähige Mehrheit zu schaffen. Das Wahlrecht ist gar nicht primär danach zu beurteilen, ob es … für den einzelnen Wähler ‚gerecht ist’ […]“[53].
4 Fazit
In dieser Arbeit wollte ich zeigen, dass man keinem der beiden Wahlsystemgrundtypen pauschal Vor- beziehungsweise Nachteile zuschreiben kann. Dies ist deutlich geworden. Die möglichen positiven Effekte eines Wahlsystems – zum Beispiel die politisch integrierende Tendenz der Mehrheitswahl oder die Senkung der Repräsentationsschwelle in der Verhältniswahl – können unter bestimmten Umständen sehr negative Züge annehmen – übermäßige Konzentration der politischen Macht einerseits, Parteienzersplitterung andererseits. Die möglichen negativen Aspekte – zum Beispiel die Beschränkung der Entscheidungsmöglichkeit auf zwei, beziehungsweise die mühselige Koalitionsbildung – können auch positiv bewertet werden – echte politische Willensbildung einerseits, kompromissbereite politische Kultur andererseits. Ob man ein Wahlsystem positiv oder negativ bewertet, ist sehr abhängig vom Standpunkt, von dem aus man es betrachtet. Dieter Nohlen formuliert: „Da die Befürwortung der […] Mehrheitswahl in aller Regel von einem pluralistischen, dem Marktmodell analogen Gesellschaftsverständnis abgeleitet wird, ist dieses Wahlsystem neuerdings von Vertretern eines emanzipatorischen Erkenntnisinteresses und antagonistischen Gesellschaftsverständnisses scharf kritisiert worden“[54]. Die Bewertung möglicher Auswirkungen der Wahlsysteme hängt demnach stark mit den Erwartungen zusammen, die man an den Staat, an das Regierungssystem und an die parlamentarische Repräsentation stellt, vor allem hinsichtlich Stabilität und Gerechtigkeit.
Es kann jedoch bezweifelt werden, ob „ein Wahlsystem zu etwas [führt], es sei denn, es werden die näheren Bedingungen angegeben, also wenn-dann-Sätze gebildet“[55]. Außerdem muss bedacht werden, dass sich ein Großteil der oben angeführten Auswirkungen der Wahlsysteme einerseits in Mehrheitswahlsystemen mit zwei ungefähr gleichstarken Parteien und andererseits in Systemen reiner Verhältniswahl erkennen lassen. Mehrheitswahlsysteme mit mehr oder weniger als zwei dominierenden Parteien oder Verhältniswahlsysteme mit Sperrklausel sind nicht so leicht anzugreifen beziehungsweise zu loben, wie dies im Abschnitt 3 den Anschein erwecken mag. Man darf nicht den Fehler machen, bestimmte Erscheinungen monokausal als Auswirkung des Wahlsystems zu sehen und sie daher als notwendige Folgen zu betrachten.
„So viel Stabilität, wie nötig – so viel Chancengleichheit, wie möglich. Oder auch umgekehrt, ganz wie man die Werteskala setzen will“[56]. Diese Formel schlägt Heiko Kaack vor, um im Konflikt zwischen der Forderung nach Stabilität für das Regierungssystem einerseits und der nach Chancengleichheit für alle gesellschaftlichen Gruppen andererseits eine Lösung zu finden. Wichtig ist, dass man bei der Bewertung des Wahlsystems stets das politische System und die Gesellschaft betrachtet, in denen es angewandt wird. Und so formuliert Emil Hübner treffend: „Vor- und Nachteile der verschiedenen Wahlsysteme im luftleeren Raum zu erörtern, ist unmöglich. Daß es ein Wahlsystem gäbe, das allen Anforderungen entspräche, das nur Vorteile besitze – ein Wahlsystem, das man als das bestmögliche überall und zu jeder Zeit bezeichnen könnte –, wird nur von wenigen Autoren behauptet“[57].
5 Literaturverzeichnis
Bredthauer, Rüdiger: Das Wahlsystem als Objekt von Politik und Wissenschaft. Die Wahlsystemdiskussion in der BRD 1967/68 als politische und wissenschaftliche Auseinandersetzung [= Studien zum politischen System der Bundesrepublik Deutschland, hg. von Heino Kaack, Bd. 2], Meisenheim am Glan 1973.
Hübner, Emil: Wahlsysteme und ihre möglichen Wirkungen unter spezieller Berücksichtigung der Bundesrepublik Deutschland, 4., überarbeit. Aufl., München 1976.
Kaack, Heino: Zwischen Verhältniswahl und Mehrheitswahl. Zur Diskussion der Wahlrechtsreform: in der Bundesrepublik Deutschland, Opladen 1976.
Meyer, Hans: Wahlsystem und Verfassungsordnung. Bedeutung und Grenzen wahlsystematischer Gestaltung nach dem Grundgesetz, Frankfurt am Main 1973.
Nohlen, Dieter: Wahlrecht und Parteiensystem, Opladen 2000.
Nohlen, Dieter: Wahlsysteme, in: Hans H. Röhring/Kurt Sontheimer (Hrsg.): Handbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, München 1977, S. 654 - 661.
Nohlen, Dieter: Wahlsysteme, in: Manfred G. Schmidt (Hrsg.): Westliche Industriegesellschaften. Wirtschaft – Gesellschaft – Politik [= Pipers Wörterbuch zur Politik, hg. von Dieter Nohlen, Bd. 2], München 1983, S. 489 - 497.
Nohlen, Dieter: Wahlsysteme der Welt. Daten und Analysen. Ein Handbuch. Unter Mitarbeit von Rainer-Olaf Schultze, München 1978.
Raschke, Joachim: Mehrheitswahlrecht – Mittel zur Demokratisierung oder Formierung der Gesellschaft?, in: Winfried Steffani (Hrsg.): Parlamentarismus ohne Transparenz [= Kritik, hg. vom Westdeutschen Verlag, Bd. 3], Opladen 1973, S. 191 – 215.
Unkelbach, Helmut: Grundlagen der Wahlsystematik. Stabilitätsbedingungen der parlamentarischen Demokratie, Göttingen 1956.
[...]
[1] Nohlen, Dieter: Wahlsysteme, in: Manfred G. Schmidt (Hrsg.): Westliche Industriegesellschaften. Wirtschaft – Gesellschaft – Politik [= Pipers Wörterbuch zur Politik, hg. von Dieter Nohlen, Bd. 2], München 1983, S. 489 - 497, hier: S. 489.
[2] Hübner, Emil: Wahlsysteme und ihre möglichen Wirkungen unter spezieller Berücksichtigung der Bundesrepublik Deutschland, 4., überarbeit. Aufl., München 1976, S. 21.
[3] Nohlen, Dieter: Wahlsysteme, in: Hans H. Röhring/Kurt Sontheimer (Hrsg.): Handbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, München 1977, S. 654 – 661, hier: S. 656.
[4] Nohlen: Wahlsysteme, 1977, S. 654 f.
[5] Nohlen, Dieter: Wahlsysteme der Welt. Daten und Analysen. Ein Handbuch. Unter Mitarbeit von Rainer-Olaf Schultze, München 1978, S. 370.
[6] Ebenda, S. 93.
[7] Hübner: Wahlsysteme und ihre Wirkungen, S. 21.
[8] Nohlen: Wahlsysteme, 1977, S. 656.
[9] Nohlen: Wahlsysteme, 1983, S. 496.
[10] Nohlen: Wahlsysteme der Welt, S. 78.
[11] Kaack, Heino: Zwischen Verhältniswahl und Mehrheitswahl. Zur Diskussion der Wahlrechtsreform: in der Bundesrepublik Deutschland, Opladen 1976, S. 15.
[12] Hübner: Wahlsysteme und ihre Wirkungen, S. 58.
[13] Ebenda, S. 56.
[14] Nohlen: Wahlsysteme der Welt, S. 368 f.
[15] Hübner: Wahlsysteme und ihre Wirkungen, S. 58.
[16] Nohlen: Wahlsysteme der Welt, S. 366.
[17] Duverger, Maurice, zitiert nach Hübner: Wahlsysteme und ihre Wirkungen, S. 56.
[18] Nohlen: Wahlsysteme, 1977, S. 655.
[19] Kaack: Verhältniswahl und Mehrheitswahl, S. 49.
[20] Hermens, Ferdinand A., zitiert nach Hans Meyer: Wahlsystem und Verfassungsordnung. Bedeutung und Grenzen wahlsystematischer Gestaltung nach dem Grundgesetz, Frankfurt am Main 1973, S. 213.
[21] Duverger, Maurice, zitiert nach Hübner: Wahlsysteme und ihre Wirkungen, S. 77.
[22] Nohlen: Wahlsysteme, 1977, S. 656.
[23] Bredthauer, Rüdiger: Das Wahlsystem als Objekt von Politik und Wissenschaft. Die Wahlsystemdiskussion in der BRD 1967/68 als politische und wissenschaftliche Auseinandersetzung [= Studien zum politischen System der Bundesrepublik Deutschland, hg. von Heino Kaack, Bd. 2], Meisenheim am Glan 1973, S. 24
[24] Nohlen: Wahlsysteme, 1977, S. 656.
[25] Hübner: Wahlsysteme und ihre Wirkungen, S. 25.
[26] Kaack: Verhältniswahl und Mehrheitswahl, S. 46.
[27] Hübner: Wahlsysteme und ihre Wirkungen, S. 84 f.
[28] Nohlen: Wahlsysteme, 1983, S. 496.
[29] Seipel, Ignaz, zitiert nach Hübner: Wahlsysteme und ihre Wirkungen, S. 52.
[30] Nohlen: Wahlsysteme der Welt, S. 371.
[31] Nohlen: Wahlsysteme, 1977, S. 655.
[32] Raschke, Joachim: Mehrheitswahlrecht – Mittel zur Demokratisierung oder Formierung der Gesellschaft?, in: Winfried Steffani (Hrsg.): Parlamentarismus ohne Transparenz [= Kritik, hg. vom Westdeutschen Verlag, Bd. 3], Opladen 1973, S. 191– 215, hier: S. 206.
[33] Nohlen: Wahlsysteme der Welt, S. 374.
[34] Burke, Edmund/Wilson, James, zitiert nach Hübner: Wahlsysteme und ihre Wirkungen, S. 15
[35] Chamberlain, Sir Austin, zitiert nach ebenda, S. 55.
[36] Unkelbach, Helmut: Grundlagen der Wahlsystematik. Stabilitätsbedingungen der parlamentarischen Demokratie, Göttingen 1956, S. 57.
[37] Nohlen: Wahlsysteme, 1977, S. 656.
[38] Unkelbach: Wahlsystematik, S. 59 ff.
[39] Meyer: Wahlsystem und Verfassungsordnung, S. 215.
[40] Kaack: Verhältniswahl und Mehrheitswahl, S. 35.
[41] Ebenda, S. 214.
[42] Hübner: Wahlsysteme und ihre Wirkungen, S. 61.
[43] Kaack: Verhältniswahl und Mehrheitswahl, S. 58 f.
[44] Loewenstein, Karl, zitiert nach Hübner: Wahlsysteme und ihre Wirkungen, S. 63.
[45] Friedrich, Carl Joachim, zitiert nach Hübner: Wahlsysteme und ihre Wirkungen, S. 53.
[46] Raschke: Mehrheitswahl, S. 192 f.
[47] Hübner: Wahlsysteme und ihre Wirkungen, S. 55.
[48] Nohlen, Dieter: Wahlrecht und Parteiensystem, Opladen 2000, S. 307.
[49] Nohlen: Wahlsysteme, 1983, S. 493.
[50] Nohlen: Wahlsysteme der Welt, S. 54.
[51] Ebenda, S. 367.
[52] Kaack: Verhältniswahl und Mehrheitswahl, S. 26.
[53] Seipel, Ignaz, zitiert nach Hübner, Wahlsysteme und ihre Wirkungen, S. 52.
[54] Nohlen: Wahlsysteme, 1977, S. 655.
[55] Nohlen: Wahlsysteme der Welt, S. 369.
[56] Kaack: Verhältniswahl und Mehrheitswahl, S. 34.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Arbeit über Wahlsysteme?
Diese Arbeit vergleicht die beiden grundlegenden Arten von Wahlsystemen: das Mehrheitswahlsystem und das Verhältniswahlsystem. Es wird untersucht, wie sich diese Systeme auf die Parteienlandschaft, das Wahlverhalten, die Funktionalität des Staates und die Gerechtigkeit auswirken.
Welche zwei Haupttypen von Wahlsystemen werden in der Arbeit verglichen?
Die Arbeit konzentriert sich auf die relative Mehrheitswahl als Beispiel für das Mehrheitswahlsystem und die reine Verhältniswahl als Beispiel für das Verhältniswahlsystem.
Was sind die potenziellen Auswirkungen eines Mehrheitswahlsystems auf die Parteienlandschaft?
Mehrheitswahlsysteme haben tendenziell die Auswirkung, dass sich ein Zweiparteiensystem herausbildet, da kleinere Parteien kaum Chancen haben, Mandate zu gewinnen.
Wie beeinflusst das Wahlsystem das Wahlverhalten der Wähler?
Im Mehrheitswahlsystem kann es zu einem "psychologischen Effekt" kommen, bei dem Wähler schwächerer Parteien strategisch eine der stärkeren Parteien wählen, um ihre Stimme nicht zu verlieren. Im Verhältniswahlsystem haben Wähler eher die Möglichkeit, eine Partei zu wählen, die ihre Interessen am besten vertritt, was zu einer stärkeren Parteienvielfalt führen kann.
Welche Auswirkungen hat das Wahlsystem auf die Funktionalität des Staates?
Mehrheitswahlsysteme können stabile Regierungsmehrheiten hervorbringen und somit die Regierungsbildung erleichtern. Verhältniswahlsysteme erfordern oft Koalitionen, die den Entscheidungsprozess verlangsamen können.
Wie gerecht sind die verschiedenen Wahlsysteme?
Mehrheitswahlsysteme können zu einer verzerrten Repräsentation führen, da Stimmen für unterlegene Kandidaten verloren gehen. Verhältniswahlsysteme streben eine proportionale Repräsentation an, aber auch hier kann es zu Ungerechtigkeiten kommen, wenn bestimmte Parteien nicht an der Regierungsbildung beteiligt sind.
Was ist eine "manufactured majority"?
Eine "manufactured majority" entsteht, wenn eine Partei ohne absolute Stimmenmehrheit durch das Wahlsystem eine absolute Parlamentsmehrheit erhält. Dies tritt häufiger in Mehrheitswahlsystemen auf.
Welche Rolle spielen Sperrklauseln in Verhältniswahlsystemen?
Sperrklauseln legen eine Mindestprozentzahl an Stimmen fest, die eine Partei erreichen muss, um ins Parlament einzuziehen. Sie sollen die Zersplitterung der Parteienlandschaft verhindern und die Funktionsfähigkeit des Parlaments gewährleisten.
Warum wird die Wahlkreiseinteilung im Mehrheitswahlsystem kritisiert?
Die Wahlkreiseinteilung kann das Wahlergebnis erheblich beeinflussen und sogar manipulierend wirken, wenn die Größe, Einwohnerzahl und soziale Zusammensetzung der Wahlkreise ungleichmäßig verteilt sind.
Was ist das Fazit der Arbeit bezüglich der Bewertung von Wahlsystemen?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass kein Wahlsystem pauschal als besser oder schlechter bezeichnet werden kann. Die Bewertung hängt stark von den spezifischen Umständen und den Zielen ab, die man mit dem Wahlsystem erreichen möchte (z.B. Stabilität oder Chancengleichheit).
- Quote paper
- Manuel Vesely Fernandez (Author), 2005, Mehrheitswahl und Verhältniswahl - Ein Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109747