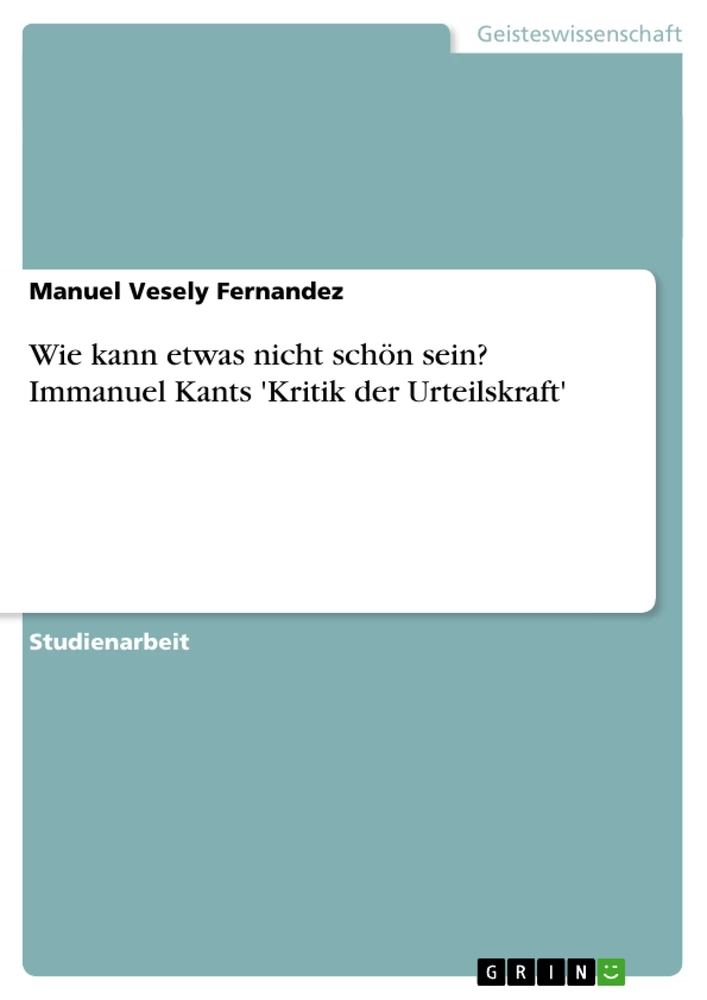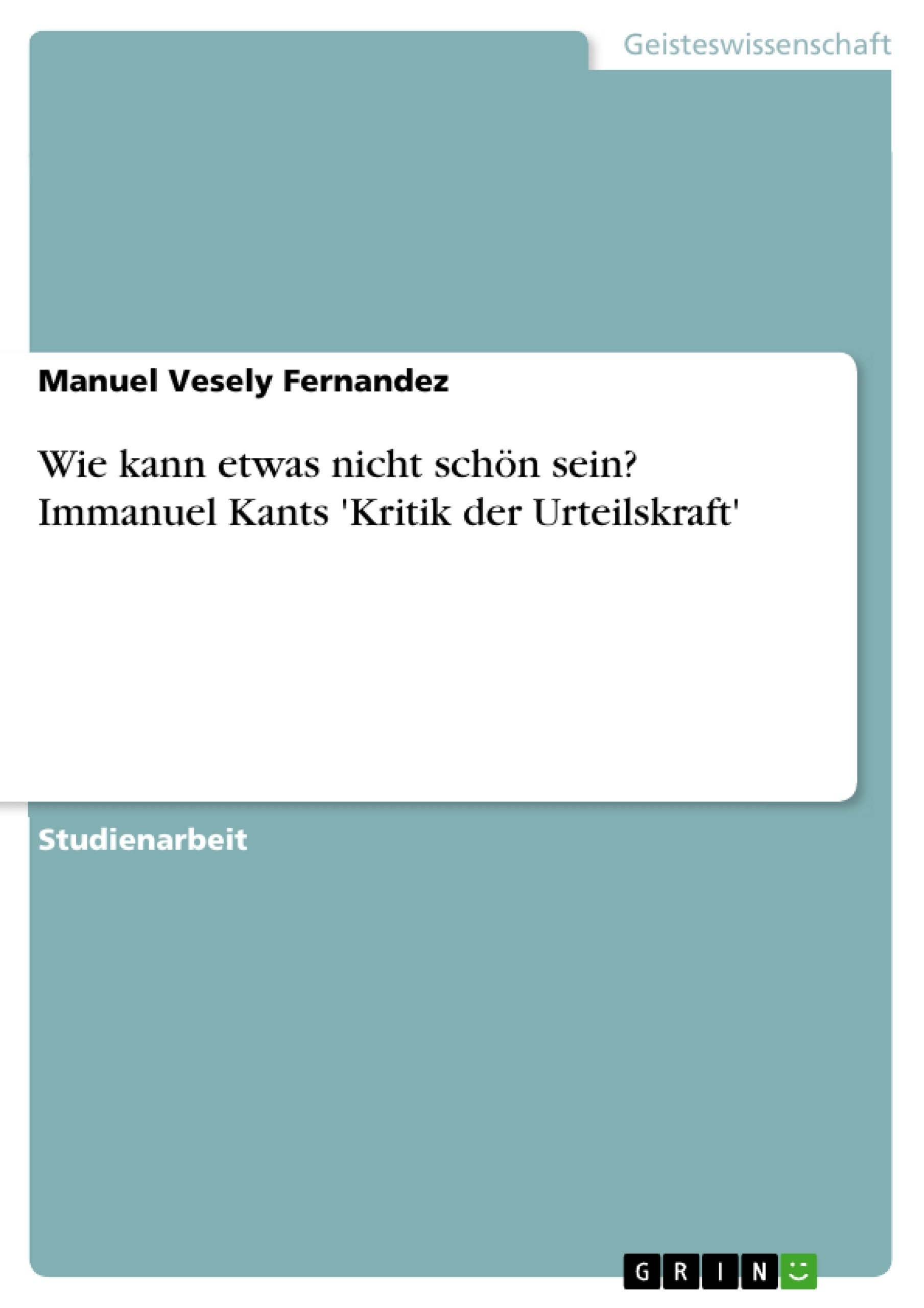Was macht etwas wirklich hässlich? Entdecken Sie in dieser tiefgründigen Analyse eine überraschende Antwort, die weit über bloße Geschmacksfragen hinausgeht. Immanuel Kants „Kritik der Urteilskraft“ dient als Ausgangspunkt für eine faszinierende Untersuchung darüber, was passiert, wenn unsere Wahrnehmung ins Stocken gerät. Diese Arbeit seziert Kants Theorie des Geschmacksurteils und enthüllt, wie wir Schönheit beurteilen, bevor sie sich der dunklen Seite der Ästhetik zuwendet: dem Urteil „X ist nicht schön“. Erfahren Sie, wie das negative Geschmacksurteil nicht einfach nur das Gegenteil von Wohlgefallen ist, sondern ein komplexes Zusammenspiel unserer Erkenntnisfähigkeiten offenbart. Tauchen Sie ein in die Welt der Einbildungskraft, des Verstandes und der Urteilskraft, um zu verstehen, wie ein Mangel an Harmonie zwischen diesen Fähigkeiten zu einem Gefühl der Unlust führt. Ist Hässlichkeit objektiv messbar oder lediglich eine subjektive Empfindung? Diese Untersuchung wirft ein neues Licht auf die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen und bewerten, indem sie aufzeigt, dass das Hässliche nicht nur eine Frage des Geschmacks, sondern ein Spiegelbild unserer kognitiven Prozesse ist. Untersuchen Sie die Verbindung zwischen subjektiver Allgemeingültigkeit und notwendiger Harmonie, während argumentiert wird, dass das negative Geschmacksurteil auf einer Form des Objekts basiert, die den freien Fluss der Erkenntnis behindert. Diese Lektüre ist ein Muss für jeden, der sich für Philosophie, Ästhetik oder die Funktionsweise unseres Geistes interessiert. Entdecken Sie, wie die Ablehnung des Hässlichen uns letztendlich mehr über uns selbst verrät als die Akzeptanz des Schönen. Wagen Sie einen Blick in den Abgrund der Nicht-Schönheit und erleben Sie, wie sich Ihr Verständnis von Ästhetik für immer verändern wird. Eine provokante Reise durch die Abgründe der Wahrnehmung, die den Leser dazu anregt, seine eigenen ästhetischen Überzeugungen zu hinterfragen und die tieferen Schichten des Urteilens zu ergründen. Lassen Sie sich von Kants philosophischem Rahmen inspirieren, um die verborgenen Mechanismen zu entschlüsseln, die unsere ästhetischen Präferenzen steuern. Erweitern Sie Ihren Horizont und gewinnen Sie neue Einblicke in die Natur des Schönen und des Hässlichen, die unser Leben bereichern und uns die Welt mit anderen Augen sehen lassen. Ein unverzichtbarer Beitrag zur zeitgenössischen Ästhetik, der zum Nachdenken anregt und die Leser dazu auffordert, ihre eigene Perspektive auf die Welt zu überdenken.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 „X ist schön“ – Erläuterung des positiven Geschmacksurteils
2.1 Das Wohlgefallen am Schönen
2.2 Die Erkenntnisvermögen
2.3 Das Geschmacksurteil
2.4 Reflexion, freies Spiel und Harmonie
2.5 Gemütszustand, Mitteilbarkeit und Gemeinsinn
2.6 Subjektive Allgemeingültigkeit und subjektive Notwendigkeit
2.7 Zweckmäßigkeit ohne Zweck
3 „X ist nicht schön“ – Erläuterung des positiven Geschmacksurteils
4 Zusammenfassung
5 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Die Untersuchungen über das Geschmacksurteil, die Immanuel Kant in der „Kritik der Urteilskraft“[1] anstellt, sind größtenteils geprägt von der Analyse der Frage, was passieren muss, damit wir einen Gegenstand als schön bezeichnen. Dabei vernachlässigt Kant die Analyse der ebenso wichtigen Gegenfrage, nämlich was passieren muss, damit wir einen Gegenstand als nicht schön bezeichnen. Bezüglich dieser Frage besteht in Kants Kritik offensichtlich interpretatorischer Freiraum.
In dieser Arbeit werde ich zunächst Kants Analyse des Geschmacksurteils über das Schöne[2] grundlegend erläutern. In einem zweiten Schritt werde ich die gewonnen Erkenntnisse nutzen, um zu untersuchen, unter welchen Umständen wir ein Geschmacksurteil über das Nichtschöne[3] – ein Urteil der Form „X ist nicht schön“ – fällen. Ziel meiner Arbeit ist es zu zeigen, dass das negative Geschmacksurteil auf einer für die Erkenntnisvermögen zweckwidrigen Form des zu beurteilen Gegenstandes beruht, wodurch eine Harmonie in ihrem freien Spiel der Erkenntnisvermögen verhindert wird.
Grundlage dieser Arbeit ist die Verwendung des Primärtextes sowie ausgewählter Sekundärliteratur.
2 „X ist schön“ – Erläuterung des positiven Geschmacksurteils
2.1 Das Wohlgefallen am Schönen
Was muss passieren, damit wir einen Gegenstand als schön bezeichnen? Zunächst einmal benötigen wir einen Gegenstand, den wir betrachten. Das mag trivial klingen, ist es aber nicht. Man muss sich nämlich klar machen, dass Kant in der KdU zeigen möchte, dass wir nichts über einen Gegenstand aussagen, wenn wir behaupten, etwas sei schön. Wir machen mit einem solchen Urteil vielmehr eine Aussage über das Gefühl, das wir bei seinem Anblick haben. Für Kant ist ein Lustgefühl bzw. ein Wohlgefallen, welches wir bei der Betrachtung eines Gegenstands verspüren, ausschlaggebend dafür, dass wir ein Urteil der Form „X ist schön“ fällen. Worauf gründet dieses Wohlgefallen?
Kant gibt zunächst einmal an, auf was dieses Wohlgefallen nicht gründen darf, nämlich auf Interesse. Wenn wir Interesse an einem Gegenstand haben, so sind wir an seiner Existenz interessiert und empfinden nur aus diesem Grund Wohlgefallen bei seiner Betrachtung. Ein auf Interesse gründendes Wohlgefallen deutet darauf hin, dass wir einen Gegenstand entweder als angenehm empfinden, weil er unseren „Sinnen in der Empfindung“ (KdU, § 3, 7) oder als gut empfinden, weil er uns „vermittels der Vernunft […] gefällt“ (KdU, § 4, 10). Ich lasse an dieser Stelle bewusst unkommentiert, was es bedeutet, dass uns ein Gegenstand in der Empfindung oder mittels der Vernunft gefällt[4]. Entscheidend ist, dass uns in beiden Fällen ein Interesse – das Interesse unserer Sinne an der Existenz des Angenehmen bzw. das Interesse unserer Vernunft an der Existenz des Guten – dazu zwingt, ein Wohlgefallen bei der Betrachtung des Gegenstandes zu verspüren. Für Kant soll jedoch das Wohlgefallen „am Schönen einzig und allein ein uninteressiertes und f r e i e s Wohlgefallen“ (KdU, § 5, 15) sein. Das bedeutet, es muss ohne Interesse sein.
Zur Freiheit des Wohlgefallens gehört für Kant darüber hinaus auch, dass es nicht von Reizen beeinflusst ist. Als Reize gelten für Kant zum Beispiel durch Farbe oder Materie des Gegenstandes hervorgerufene Sinneseindrücke, die wesentlich zum Wohlgefallen an ihm beitragen können. Kant betont jedoch, der Geschmack sei „barbarisch, wo er die Beimischung der R e i z e […] zum Wohlgefallen bedarf“ (KdU, § 13, 38). Für ihn gründet die Bezeichnung eines Gegenstandes als schön allein auf der Beurteilung der Form des Gegenstandes – zum Beispiel die Beurteilung eines Bildes anhand seiner Zeichnung –, die zu einem interesselosen und freien Wohlgefallen führt. Doch was geschieht zwischen der Beurteilung der Form eines Gegenstandes und dem Verspüren des Wohlgefallens?
2.2 Die Erkenntnisvermögen
Zur Klärung dieser Frage bedarf es zunächst einer kurzen Erläuterung dessen, was Kant unter Erkenntnisvermögen versteht. Hierbei handelt es sich um die Einbildungskraft, die Urteilskraft und den Verstand. Durch sie sind wir in der Lage, unsere Umwelt zu erkennen. Wie dies geschieht, beschreibe ich hier nur skizzenhaft[5]. Die Fülle der optischen Eindrücke, die wir bei Betrachtung von Gegenständen erfahren, ordnet (synthetisiert) die Einbildungskraft nach bestimmten Regeln zu konkreten Vorstellungen. Die Regeln, nach denen die Einbildungskraft bei dieser Synthese verfährt, gibt ihr der Verstand. Der Verstand ist darüber hinaus dafür zuständig, aus den gelieferten Vorstellungen Begriffe zu formen. Der Begriff „Fahrrad“ zum Beispiel enthält all das, was wir mit einem Fahrrad verbinden, also Eigenschaften, die Funktion, das Erscheinungsbild usw. Von der Einbildungskraft gelieferte Vorstellungen können so bestehenden Begriffen zugeordnet werden, wodurch wir in der Lage sind, Gegenstände zu erkennen. Wir erkennen zum Beispiel ein Fahrrad, wenn der Gegenstand zwei Räder, einen Lenker, einen Sattel usw. hat. Die Funktion der Zuordnung übernimmt die Urteilskraft, welche „das Besondere [d.h. die Vorstellung, M.V.] als enthalten unter dem Allgemeinen [d.h. den Begriff, M.V.] zu denken“ (KdU, Einleitung IV, XXV) im Stande ist – sie subsumiert die Vorstellungen unter Begriffe. Ein Erkenntnisurteil über einen Gegenstandes erfolgt somit – einfach gesagt – dann, wenn die Urteilskraft in der Lage ist, die von der Einbildungskraft nach bestimmten Verstandesregeln gebildete Vorstellung unter einen vom Verstand gelieferten Begriff zu subsumieren.
Dieser Prozess läuft nach Kant bei allen Menschen in der gleichen Weise ab. Dadurch sind solche Urteile, die sich auf Objekte der Außenwelt beziehen und klaren Regeln folgen, unabhängig von subjektiven Bedingungen, z.B. Gefühlen des Betrachters, und somit beweisbar bzw. nachprüfbar. Sie müssen daher von jedem Menschen, der denselben Gegenstand betrachtet, gewonnen werden (notwendig) bzw. sind für jeden anderen Menschen gültig (allgemeingültig).
2.3 Das Geschmacksurteil
Nun handelt es sich für Kant bei einem Geschmacksurteil nicht um ein Erkenntnis-, sondern um ein ästhetisches Urteil. Kant betont, dass wir uns in einem Geschmacksurteil lediglich auf uns und auf unser „Gefühl der Lust oder Unlust“ (KdU, § 1, 4) beziehen, wodurch „gar nichts im Objekte bezeichnet wird“ (ebenda). Im Gegensatz zum Erkenntnisurteil ist das Geschmacksurteil also subjektiv und gründet daher nicht auf Begriffen und folgt keinen Regeln – täte es dies, wäre es objektiv und damit nachprüfbar bzw. beweisbar. Diesen Unterschied möchte ich an einem Beispiel erklären.
Wenn ich in einen Hof blicke und dort ein Fahrrad stehen sehe, dann hat meine Einbildungskraft die Anschauung der Außenwelt nach bestimmten Regeln so zu einer Vorstellung synthetisiert, dass sie durch meine Urteilskraft unter den Begriff des Fahrrads gebracht werden kann. Für mich besteht kein Zweifel daran, dass jeder, der in diesen Hof blickt, dieses Fahrrad ebenfalls sieht. Mein Urteil folgt klaren Regeln und ist daher notwendig. Deshalb kann ich auch die Zustimmung eines jeden anderen einfordern, wenn ich behaupte: „Da draußen steht ein Fahrrad im Hof.“. Mein Urteil ist allgemeingültig. Würde mir jemand widersprechen und behaupten, im Hof stünde ein Pferd, würde ich seine Aussage nicht akzeptieren und versuchen, ihn eines Besseren zu belehren. Behaupte ich jedoch, dass ich dieses Fahrrad für schön halte, hätte ich zunächst wahrscheinlich weitaus weniger Probleme damit, wenn mir jemand widersprechen und dasselbe Fahrrad als nicht schön bezeichnen würde.
Kant betont jedoch, dass man etwas „nicht s c hön nennen [muss, M.V.], wenn es bloß [einem selbst, M.V.] gefällt“ (KdU, § 7, 19). Damit grenzt er das Urteil „X ist schön“ erneut vom Urteil „X ist angenehm“ ab. Denn für ihn gilt „in Ansehung des Angenehmen […] der Grundsatz: e i n j e d e r h a t s e i n e n e i g e n e n G e s c h m a c k (der Sinne)“ (ebenda). Für Kant unterscheidet sich der Sinnen-Geschmack („X ist angenehm“), bei dem man „jeglichem seinen Kopf für sich haben läßt“ (KdU, § 8, 22), vom Reflexions-Geschmack („X ist schön“) somit dadurch, dass die Urteile des Letzteren nicht nur Privaturteile, sondern „vorgebliche gemeingültige (publike)“ (ebenda) Urteile sein sollen. Beim Verspüren des Wohlgefallens bei der Betrachtung eines schönen Gegenstandes fühlen wir uns „völlig f r e i […] [und, M.V.] glauben Grund zu haben, jedermann ein ähnliches Wohlgefallen zuzumuten“ (KdU, § 6, 17). Fällen wir ein Urteil der Form „X ist schön“, erheben wir nach Kant damit Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Und nicht nur das. Kant behauptet darüber hinaus auch, dass wir davon ausgehen, dass zwischen dem Gegenstand, den wir als schön bezeichnen, und dem Wohlgefallen, das wir bei seiner Betrachtung verspüren, eine „notwendigen Beziehung“ (KdU, § 18, 62) bestehen muss. Wie sollen der Anspruch auf Allgemeingültigkeit und Notwendigkeit des positiven Geschmacksurteils gerechtfertigt werden, wenn es doch gänzlich ohne Begriffe und ohne Regeln auskommt und somit nicht objektiv sein kann?
2.4 Reflexion, freies Spiel und Harmonie
Um diese Frage zu beantworten, empfiehlt es sich zu betrachten, warum Kant bezüglich des positiven Geschmacksurteils den Begriff des Reflexions-Geschmacks einführt. Reflexion deutet auf psychische Tätigkeit hin und in der Tat behauptet Kant, dass unserem Wohlgefallen am Schönen geistige Prozesse vorgeschaltet sind, während dagegen das Wohlgefallen am Angenehmen quasi über uns kommt, ohne das wir – salopp gesagt – etwas dafür tun müssen. Dieter Teichert formuliert treffend: „Dieser Gegensatz von kognitiver Passivität beim Genuß des Angenehmen und kognitiver Aktivität bei der Beurteilung des Schönen ist für Kant von ausschlaggebender Bedeutung“[6]. Worin besteht für Kant diese kognitive Aktivität?
Wie beim Erkenntnisurteil bildet die Einbildungskraft die erste Instanz des positiven Geschmacksurteils. Die Anschauung des zu beurteilenden Gegenstandes wird durch sie in eine bestimmte Ordnung gebracht. Kant betont jedoch, dass die Einbildungskraft im Gegensatz zum Erkenntnisurteil beim positiven Geschmacksurteil bei der Synthese vom Verstand keine Regeln vorgesetzt bekommt, nach denen sie zu verfahren hat. Sie muss eher „als produktiv und selbstständig (als Urheberin willkürlicher Formen möglicher Anschauungen)“ (KdU, Allgemeine Anmerkungen zum ersten Abschnitt der Analytik, 69) angenommen werden. Es ist jedoch nachvollziehbar, dass die Freiheit, die die Einbildungskraft nach Kant im positiven Geschmacksurteil genießt, nicht grenzenlos sein kann. Würde sie die gewonnene Anschauung tatsächlich völlig willkürlich synthetisieren, entstünde eine Vorstellung, mit der wir nichts anfangen könnten. Der zu beurteilende Gegenstand muss der Einbildungskraft demnach „eine solche Form an die Hand geben […], die eine Zusammensetzung des Mannigfaltigen enthält, wie sie die Einbildungskraft […] in Einstimmung mit der V e r s t a n d e s g e s e t z mäß i g k e i t überhaupt entwerfen würde“ (ebenda). Kant behauptet also, dass die Form des schönen Gegenstandes die Einbildungskraft dazu veranlasst, eine Vorstellung zu synthetisieren, die der Vorstellung in einem Erkenntnisurteils entspricht. Damit ist nicht gemeint, dass sich die Einbildungskraft in diesem Fall selber Regeln gibt, nach denen sie verfährt. Dadurch würde sie nämlich zeigen, „daß sie eine Autonomie bei sich“ führt, was nicht geht, denn der „Verstand allein gibt das Gesetz [d.h. die Regel, M.V.]“ (ebenda). Vielmehr bedeutet es, dass sich die Einbildungskraft beim Urteil des Reflexions-Geschmacks nicht durch den Zwang, sondern eher durch ein „glückliches Zusammentreffen“[7] nach den Gesetzen des Verstandes verfährt. Kant bezeichnet dies als „freie Gesetzmäßigkeit“ bzw. „Gesetzmäßigkeit ohne Gesetz“, während Gerhard Seel dies treffend als eine „Als-ob-Freiheit“[8] der Einbildungskraft bezeichnet.
Da die synthetisierte Vorstellung somit bereits ohne Zutun des Verstandes den Regeln genügt, „im Geschmacksurteile [jedoch, M.V.] immer noch eine Beziehung auf den Verstand enthalten“ (KdU, § 1, 4 in Fußnote) ist, bleibt zu klären, welche Rolle dieser jetzt übernimmt. Kant sagt hierzu, dass die „Einbildungskraft in ihrer Freiheit den Verstand erweckt, und dieser ohne Begriffe [Hervorh. M.V.] die Einbildungskraft in ein regelmäßiges Spiel versetzt“ (KdU, § 40, 161). Einerseits wird der Verstand also durch die von der Einbildungskraft gelieferte Vorstellung zu der ihm eigenen Tätigkeit – Begriffe zu produzieren bzw. zu suchen – angeregt, ohne hierbei zum Erfolg zu kommen. Heinz Spremberg umschreibt dies als „die (eingeschränkte) Funktion des Verstandes […], einen Begriff zu suchen, ohne jedoch einen adäquaten finden zu können“[9]. Andererseits regt diese Tätigkeit wiederum die Einbildungskraft an, sich weiterhin mit der Anschauung des Gegenstandes zu beschäftigen, also weiteres Vorstellungsmaterial zu liefern, wodurch ein Kreislauf zwischen Einbildungskraft und Verstand entsteht. Kant umschreibt dies mit den Worten: „Wir w e i l e n bei der Betrachtung des Schönen, weil diese Betrachtung sich selbst stärkt und reproduziert“ (KdU, § 12, 37). Er bezeichnet diesen Zustand als den „Zustand eines f r e i e n S p i e l s der Erkenntnisvermögen bei einer Vorstellung“ (KdU, § 9, 27), Gerhard Seel umschreibt ihn als „einen inneren Zustand stimulierter Leistungs- und Kooperations-bereitschaft der Erkenntniskräfte“[10].
Die Rolle der Vermittlerin zwischen Einbildungskraft und Verstand kommt auch im freien Spiel der Erkenntnisvermögen der Urteilskraft zu. Anders als bei einem Erkenntnisurteil tritt sie beim Geschmacksurteil jedoch nicht bestimmend, sondern reflektierend in Erscheinung, denn: „Ist das Allgemeine (die Regel, das Prinzip, das Gesetz) gegeben, so ist die Urteilskraft, welche das Besondere darunter subsumiert […] b e s t i m m e n d. Ist aber nur das Besondere gegeben, wozu sie das Allgemeine finden soll, so ist die Urteilskraft bloß r e f l e k t i e r e n d“ (KdU, Einleitung IV, XXVI). Kant merkt an, dass dieser Vorgang – analog zum Erkenntnisurteil – als Subsumtion gesehen werden kann, „aber nicht [als eine Subsumtion, M.V.] der Anschauung unter B e g r i f f e, sondern des V e r mög e n s der Anschauung […] unter das V e r mög e n der Begriffe“ (KdU, § 35, 146). Das heißt, dass die zufällig regelkonforme Entstehung einer Vorstellung einerseits und der Versuch, einen passenden Begriff dazu zu finden andererseits, so zusammengebracht werden, dass eine „Proportion [ein Verhältnis zwischen den Erkenntnisvermögen, M.V.], welche sich für eine Vorstellung […] gebührt, um daraus eine Erkenntnis zu machen“ (KdU, § 21, 65), entsteht. Die Erkenntnisvermögen verhalten sich somit so zueinander, „wie es zu einem E r k e n n t n i s s eüb e r h a u p t erforderlich ist“ (KdU, § 9, 29). Kant bezeichnet dieses Verhältnis als „Harmonie der Erkenntnisvermögen“ (ebenda).
2.5 Gemütszustand, Mitteilbarkeit und Gemeinsinn
Dieser Harmonie werden wir uns wiederum nicht durch Erkenntnis bewusst. Es ist ein Gefühl, das uns vermittelt, dass sich unsere Erkenntnisvermögen in harmonischer Weise zueinander verhalten, und zwar ein Gefühl der Lust. Diese Lust verspüren wir aus zwei Gründen: Zum einen, weil unser Gemütszustand – also das innere Gefühl, das wir wahrnehmen, wenn wir selbstreflexiv unsere Erkenntnisvermögen betrachten – im harmonischen Spiel dem Gemütszustand entspricht, der „angetroffen wird, sofern [unsere Erkenntnisvermögen, M.V.] eine gegebene Vorstellung auf E r k e n n t n i süb e r h a u p t beziehen“ (KdU, § 9, 28). Das bedeutet, dass wir uns innerlich bei der Betrachtung eines schönen Gegenstandes so fühlen, als würden wir etwas erkennen. Wir verspüren demnach eine „Lust an unserer eigenen Erkenntnisfähigkeit“[11]. Zum anderen, weil wir uns nach Kant darüber bewusst sind, dass wir diesen Gemütszustand anderen Menschen vermitteln können, dieser Gemütszustand also „allgemein mitteilbar sein müsse“ (KdU, § 9, 29). Warum wir dieser Meinung sind, erklärt Kant auf folgende Weise: „Erkenntnisse […] müssen sich […] allgemein mitteilen lassen; denn sonst käme ihnen keine Übereinstimmung mit dem Objekt zu: sie wären insgesamt ein bloß subjektives Spiel der Vorstellungskräfte […]. Sollen sich aber Erkenntnisse mitteilen lassen, so muß sich auch der Gemütszustand, d. i. die Stimmung der Erkenntniskräfte zu einer Erkenntnis überhaupt […] allgemein mitteilen lassen: weil ohne diese, als subjektive Bedingung des Erkennens, das Erkenntnis, als Wirkung, nicht entspringen könnte“ (KdU, § 21, 65)[12]. Weil wir uns also beim positiven Geschmacksurteil innerlich genauso fühlen wie bei einem Erkenntnisurteil und weil der Gemütszustand beim Erkenntnisurteil allgemein mitteilbar sein muss, muss auch der Gemütszustand beim Geschmacksurteil allgemein mitteilbar sein.
Damit Gemütszustände jedoch allgemein mitgeteilt werden können, bedarf es für Kant einer Instanz, die in allen Menschen angetroffen werden muss und die uns somit alle in gleicher Art und Weise für derartige Gefühle zugänglich macht. Kant nennt diese Instanz den Gemeinsinn. Für Kant ist er das „Prinzip […], welches nur durch Gefühl und nicht durch Begriffe […] bestimme, was gefalle oder mißfalle“ (KdU, § 20, 64). Die Existenz dieses Gemeinsinns und die Tatsache, dass „[b]ei allen Menschen […] die subjektiven Bedingungen dieses Vermögens [zur Erkenntnis, M.V.] […] einerlei“ (KdU, § 38, 151 in Fußnote) sind, erlaubt es Kant nun zu behaupten, dass wir beim Verspüren der Lust am Schönen davon ausgehen, dass diese von jedem Menschen notwendig verspürt werden und damit allgemeingültig sein muss. Dies ist nahe liegend, wenn der Erkenntnisapparat bei uns allen gleich funktioniert und somit in jedem von uns im Moment des harmonischen Zusammenspiels der Erkenntnisvermögen denselben Gemütszustand erzeugt, welcher wiederum auf Grund des Gemeinsinns von uns allen durch dasselbe Gefühl der Lust wahrgenommen werden muss.
2.6 Subjektive Allgemeingültigkeit und subjektive Notwendigkeit
Es kann sich, so Kant, beim positiven Geschmacksurteil jedoch nicht um Allgemeingültigkeit und Notwendigkeit im Sinne eines Erkenntnisurteils handeln, denn das positive Geschmacksurteil subsumiert „gar nicht unter einen Begriff […], weil sonst der notwendige allgemeine Beifall durch Beweise würde erzwungen werden können“ (KdU, § 35, 145). In der Tat scheint es schwer vorstellbar, jemanden durch Argumentation dazu zu bringen, einen Gegenstand aus Überzeugung als schön zu bezeichnen. Immerhin soll beim Betrachten eines schönen Gegenstandes ein Lustgefühl empfunden werden, welches schwerlich herbeigeredet werden kann. Um dies deutlich zu machen, betont Kant zweierlei: Erstens, dass das positive Geschmacksurteil die Einstimmung eines jeden nicht „ p o s t u l i e r t […]; es s i n n e t nur jedermann diese Einstimmung a n“ (KdU, § 8, 26). Kant bezeichnet dies als das Gefühl subjektiver Allgemeingültigkeit, d. h. als das subjektive Gefühl, jeder sollte bei der Betrachtung dieses Gegenstandes so empfinden, wie man selber. Zweitens, dass die ästhetische Beurteilung nicht durch Regeln geleitet ist, durch die man auf das Ergebnis des Beurteilung zwingend schließen kann. Dennoch ist man auf Grund des harmonischen Zustands der Erkenntnisvermögen der Meinung, beim Geschmacksurteil handle es sich um ein „Beispiel einer allgemeinen Regel“ (KdU, § 18, 63). Daher könne das Geschmacksurteil nur „e x e m p l a r i s c h genannt werden“ (KdU, § 18, 62), weshalb es sich hierbei, so Kant, um ein Gefühl subjektiver Notwendigkeit handelt.
2.7 Zweckmäßigkeit ohne Zweck
Kehren wir nun an den Anfang der vorangegangenen Erläuterungen zurück. Ausgangspunkt der beschriebenen Ereigniskette war die Form des zu beurteilenden Gegenstandes. Dieser regte die Einbildungskraft an, eine brauchbare Vorstellung zu synthetisieren, was wiederum den Verstand zur Begriffsuche veranlasste. Die gelungene Subsumtion des Anschauungs-vermögens unter das Begriffsvermögen durch die Urteilskraft führte zur Harmonie im freien Spiel der Erkenntnisvermögen, welche ein Lustgefühl erzeugte. Die allgemeine Mitteilbarkeit dieser Lust bildete die Grundlage für das Gefühl der subjektiven Allgemeingültigkeit unserer Lust einerseits und dem Gefühl der subjektiven Notwendigkeit unserer Lust andererseits. Beide Gefühle gründeten zum einen auf der Existenz eines einheitlichen Erkenntnisapparates, zum anderen auf der Existenz eines Gemeinsinns. Die Form des Gegenstandes ist somit Ursache für unser Lustgefühl. Dadurch erfüllt sie in gewisser Weise einen Zweck, nämlich den, uns in einen Zustand der Erkenntnisfähigkeit zu versetzen, den wir „ohne weitere Absicht […] e r h a l t e n“ (KdU, § 12, 37) wollen. Gerhard Seel bezeichnet dies als „quasi-ontologisch in dessen [des Menschen, M.V.] intelligibler Natur“[13] angelegter Zweck, nämlich eine Zusammenstimmung der Erkenntnisvermögen zu erreichen, also zu erkennen. Es liegt daher nahe zu behaupten, dass sich die Form des beurteilten Gegenstandes zweckmäßig verhält, dass sie also so konstituiert ist, dass sie als Mittel zur Erreichung des Zwecks dient.
Zwecke müssen nach Kant jedoch immer bewusst gesetzt werden – z.B. dass ich einen Nagel in die Wand schlagen will. Um die dazu benötigten Mittel als zweckmäßig zu bezeichnen, bedarf es stets eines Begriffs des Mittels – z.B. den Begriff des Hammers mit allen seinen Eigenschaften. Es ist fragwürdig, ob beim positiven Geschmacksurteil ein bewusst gesetzter Zweck unerstellt werden kann. Sicher ist jedoch, dass die Form des beurteilten Gegenstandes nicht ohne weiteres als zweckmäßig bezeichnet werden kann, da das positive Geschmacksurteil ohne Begriffe auskommt. Für Kant liegt daher im Geschmacksurteil ein „Bewußtsein der bloß formalen Zweckmäßigkeit“ (KdU, § 12, 36) vor, also ein Bewusstsein einer Zweckmäßigkeit ohne Zweck. Wir haben das Gefühl, dass die Form des Gegenstandes zweckmäßig für die Erreichung eines Zwecks wäre, wenn es diesen konkreten Zweck denn gäbe. Die Form des Gegenstandes ist somit subjektiv zweckmäßig für uns bzw. für unsere Erkenntnisvermögen, weil sie diese in ein harmonisches Spiel zu versetzen vermag.
Auf dieser Erkenntnis aufbauend, möchte ich meine weiteren Untersuchungen über das negative Geschmacksurteil „X ist nicht schön“ anstellen.
3 „X ist nicht schön “ – Erläuterung des negativen Geschmacksurteils
Nach Kant beziehen wir uns sowohl bei der Beurteilung eines Gegenstandes als schön wie auch bei der Beurteilung eines Gegenstandes als nicht schön stets „auf das Subjekt [auf uns selbst, M.V.] und das Gefühl der Lust oder Unlust desselben“ (KdU, § 1, 4). Urteile der Form „X ist schön“ und Urteile der Form „X ist nicht schön“ gehören somit – salopp gesagt – in dieselbe Schublade. Bei beiden handelt es sich um Geschmacksurteile. Also ist das Unlustgefühl, das dem negativen Geschmacksurteil zu Grunde liegt, ebenso ohne Interesse, wie das Lustgefühl beim positiven Geschmacksurteil. Darüber hinaus kommt das negative Geschmacksurteil, ebenso wie das positive Geschmacksurteil, ohne Begriffe aus. Das negative Geschmacksurteil ist also unterschieden vom Urteil über das Nichtangenehme bzw. über das Nichtgute wie auch vom Erkenntnisurteil. Doch wie kommt es zum Unlustgefühl?
Durch die Abgrenzung vom Urteil über das Nichtangenehme, ist es nahe liegend, das negative Geschmacksurteil analog zum positiven Geschmacksurteil als Urteil des Reflexions-Geschmacks zu sehen. Also geht dem negativen Geschmacksurteil ebenfalls die Betrachtung eines Gegenstandes voran, der nur seiner Form nach beurteilt wird. Wie beim positiven Geschmacksurteil synthetisiert die Einbildungskraft beim negativen Geschmacksurteil die Anschauung des Gegenstandes in freier Gesetzmäßigkeit, also ohne Rückgriff auf Verstandesregeln, zu einer Vorstellung. Und zwar so, dass auch hierbei der Verstand angeregt wird, einen Begriff zur gelieferten Vorstellung zu suchen. Beim negativen Geschmacksurteil wird somit, wie beim positiven Geschmacksurteil, ein freies Spiel der Erkenntnisvermögen angetroffen. Anschließend versucht die Urteilskraft, das Vermögen der Anschauung unter das Vermögen der Begriffe zu subsumieren, sie tritt also auch hier reflektierend in Erscheinung. Bis hierhin unterscheiden sich positives wie negatives Geschmacksurteil nicht. Wann kommt die Weggabelung?
Christel Fricke betont, dass ein freies Spiel nicht nur dann vorherrscht, „wenn [die Erkenntnisvermögen, M.V.] harmonisch zusammenstimmen“[14]. Dies scheint der Punkt zu sein, an dem sich negatives und positives Geschmacksurteil voneinander abtrennen lassen, nachdem sie bisher offensichtlich identisch verlaufen sind. Wo wir nämlich beim positiven Geschmacksurteil ein Lustgefühl an der Harmonie unserer Erkenntnisvermögen verspüren, müssen wir beim negativen Geschmacksurteil ein Unlustgefühl verspüren, da „kein harmonisches Verhältnis der Erkenntniskräfte […] und daher auch keine Empfindung interesselosen Wohlgefallens“[15] zustande gekommen ist. Der Moment, in dem es beim positiven Geschmacksurteil zur Harmonie kommt, ist der Moment, in dem wir zum ersten Mal Lust am beurteilten Gegenstand empfinden. Also muss dieser Moment auch derjenige sein, in dem wir beim negativen Geschmacksurteil zum ersten Mal Unlust verspüren. Dass dies mit der fehlenden Harmonie zusammenhängt, ist nahe liegend.
Dass keine Harmonie zustande kommt, liegt daran, dass die Urteilskraft nicht in der Lage ist, die von der Einbildungskraft gelieferte Vorstellung unter den Versuch des Verstandes, einen passenden Begriff zu finden, zu subsumieren. Warum scheitert die Urteilskraft beim Versuch der Subsumtion? Der Grund hierfür scheint am ehesten in der von der Einbildungskraft gelieferten Vorstellung zu finden zu sein. Nur die Einbildungskraft erzeugt im Prozess der ästhetischen Beurteilung etwas mehr oder weniger Konkretes – eine Vorstellung, die durch freie Gesetzmäßigkeit entsteht –, während der Verstand einerseits lediglich versucht einen Begriff zu finden und die Urteilskraft andererseits versucht, zwei Vermögen untereinander zu subsumieren.
Damit ein positives Geschmacksurteil zustande kommen kann, soll die Einbildungskraft, wie bereits erwähnt, beim Hervorbringen der Vorstellung so agieren, als würde sie sie „in Einstimmung mit der V e r s t a n d e s g e s e t z mäß i g k e i t überhaupt entwerfen“ (KdU, Allgemeine Anmerkungen zum ersten Abschnitt der Analytik, 69). Dies ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Harmonie im freien Spiel der Erkenntnisvermögen, also für den Gemütszustand, der dem Gemütszustand eines Erkenntnisurteils gleicht. Während der Verstand nämlich nur auf der Suche nach einem Begriff ist, muss zumindest die gelieferte Vorstellung so beschaffen sein, als wäre sie nach Verstandesregeln gewonnen und brauchbar für den Erkenntnisprozess. Ist die Einbildungskraft nicht in der Lage, eine brauchbare Vorstellung ohne Anleitung durch den Verstand zu synthetisieren, so ist der Weg zu einer möglichen Erkenntnis von Beginn an versperrt. Der Verstand – so könnte man sagen – muss sich dann nicht einmal bemühen, einen adäquaten Begriff zu finden.
Die Beschaffenheit der Vorstellung ist abhängig vom betrachteten Gegenstand, der bei der ästhetischen Beurteilung nur nach seiner Form beurteilt werden soll. Eine unbrauchbare Vorstellung ist somit auf eine mangelhafte Form des Gegenstandes zurückzuführen. Während also bei beim positiven Geschmacksurteil die Form des Gegenstandes die Einbildungskraft dazu befähigt, eine Vorstellung zu synthetisieren, die von der Urteilskraft unter den Versuch des Verstandes, einen Begriff zu finden, subsumiert werden kann, ist dies beim negativen Geschmacksurteil nicht der Fall. Beim negativen Geschmacksurteil ist die Form des beurteilten Gegenstandes somit zweckwidrig für die Erkenntnisvermögen, da auf ihr keine Vorstellung beruhen kann, die ein harmonisches, Lust bringendes Verhältnis zwischen Einbildungskraft, Verstand und Urteilskraft ermöglicht. Heinz Spremberg drückt dies mit folgenden Worten aus: „Im ästhetischen Urteil wird schließlich ein Wohlgefallen oder Mißfallen an der Form des [beurteilten Gegenstandes, M.V.] ausgedrückt“[16].
Aus den vorangegangenen Ausführungen ergibt sich folgende, paradox wirkende Situation: Einerseits ist das Unlustgefühl beim negativen Geschmacksurteil unter Annahme eines bei allen Menschen gleich funktionierenden Erkenntnisapparats und eines Gemeinsinns ebenso subjektiv notwendig und subjektiv allgemeingültig, wie es das bei der Betrachtung eines schönen Gegenstandes verspürte Lustgefühl ist. Beide beruhen auf erfahrungsunabhängigen Grundlagen – auf Grundlagen a priori – die bei jedem Menschen zum selben Ergebnis führen müssen. Andererseits kann nach der Logik Kants der Gemütszustand, der sich beim negativen Geschmacksurteil einstellt, nicht allgemein mitteilbar sein. Denn für Kant lassen sich – wie bereits erwähnt – nur Erkenntnisurteile und die mit ihnen verbundenen Gemütszustände allgemein mitteilen. Wie oben ausgeführt, ist dies die Bedingung dafür, dass sich der Gemütszustand beim harmonischen Spiel der Erkenntniskräfte allgemein mitteilen lässt. Beim negativen Geschmacksurteil liegt eine solche Harmonie jedoch nicht vor. Daher kann auch kein Gemütszustand vorherrschen, der dem Gemütszustand beim Erkenntnisurteil gleicht. Folglich können wir diesen Gemütszustand nicht als allgemein mitteilbar annehmen. Was folgt daraus?
Ich bin mir darüber nicht ganz im Klaren. Zu Beginn der Ausführungen Kants in der KdU erscheint es so, als sei die allgemeine Mitteilbarkeit die Grundlage für die subjektive Allgemeingültigkeit. Wäre dies so, würde dies bedeuten, dass das Unlustgefühl beim negativen Geschmacksurteil basierend auf dem Gemeinsinn subjektiv notwendig wäre, ohne – auf Grund fehlender allgemeiner Mitteilbarkeit – allgemeingültig zu sein. Und in der Tat dürfte das Unlustgefühl des negativen Geschmacksurteils nicht begleitet sein von einem Gefühl subjektiver Allgemeingültigkeit, da, wie bereits gezeigt, kein Gemütszustand vorherrscht, der allgemein mitteilbar wäre. Die subjektive Allgemeingültigkeit des Unlustgefühls lässt sich jedoch über die Annahme des Gemeinsinns rechtfertigen. Da jeder Mensch in seiner Erkenntnisfähigkeit gleich funktioniert, muss der Gemütszustand, der durch die Belebung der Erkenntnisvermögen hervorgerufen wird, in jedem Menschen entstehen. Beim negativen Geschmacksurteil kann uns dieser Gemütszustand aus besagten Gründen jedoch nicht als allgemeingültig erscheinen. Insofern behält Dieter Teichert Recht, wenn er sagt: „Angesichts des Schönen [und, wie gezeigt, auch angesichts des Hässlichen, M.V.] wird verbunden, was sich sonst gegenseitig ausschließt“[17].
4 Zusammenfassung
Nicht schön ist ein Gegenstand, dessen Form zweckwidrig für unsere Erkenntnisvermögen ist, d.h. dass die aus seiner Anschauung durch die Einbildungskraft in freier Gesetzmäßigkeit synthetisierte Vorstellung durch die reflektierende Urteilskraft nicht unter das Vermögen der Begriffe subsumiert werden kann. Dadurch entsteht keine Harmonie im freien Spiel der Erkenntnisvermögen, was ein Unlustgefühl erzeugt. Dieses Unlustgefühl kann zwar nicht als allgemein mitteilbar wahrgenommen werden, muss aber unter der Annahme eines einheitlichen Erkenntnisapparates und eines Gemeinsinns als subjektiv allgemeingültig und subjektiv notwendig gelten.
5 Literaturverzeichnis
Fricke, Christel: Kants Theorie des reinen Geschmacksurteils [= Quellen und Studien zur
Philosophie, hrsg. von Patzig, Günther/Scheibe, Erhard/Wieland, Wolfgang, Bd. 26], Berlin: de Gruyter 1990.
Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft, Stuttgart: Philipp Reclam jun. 1963.
Seel, Gerhard: Über den Grund der Lust an schönen Gegenständen. Kritische Fragen an die Ästhetik Kants, in: Oberer, Hariolf/Seel, Gerhard [Hrsg.]: Kant. Analysen – Probleme – Kritik, Würzburg: Königshausen & Neumann 1988, S. 317 – 356.
Spremberg, Heinz: Zur Aktualität der Ästhetik Immanuel Kants. Ein Versuch zu Kants ästhetischer Urteilstheorie mit Blick auf Wittgenstein und Sibley, Frankfurt am Main: Peter Lang 1999.
Teichert, Dieter: Immanuel Kant: „Kritik der Urteilskraft. Ein einführender Kommentar, Paderborn: Schöningh 1992
[...]
[1] Ich beziehe mich in dieser Arbeit auf die Einleitung und den ersten Teil „Die Kritik der ästhetischen Urteilskraft“ der „Kritik der Urteilskraft“. Im Folgenden verwende ich bei Verweisen auf diese Teile der „Kritik der Urteilskraft“ die Abkürzung KdU mit Angabe des jeweiligen Paragraphen und der jeweiligen Seitenzahl der Originalausgabe.
[2] Im Folgenden verwende ich für den Ausdruck „Geschmacksurteil über das Schöne“ den Ausdruck „positives Geschmacksurteil“.
[3] Im Folgenden verwende ich für den Ausdruck „Geschmacksurteil über das Hässliche“ den Ausdruck „negatives Geschmacksurteil“.
[4] Vor allem die Klärung der Frage, warum etwas, was wir als gut bezeichnen, vermittels der Vernunft gefällt, bedarf einer Auseinandersetzung mit Kants „Kritik der praktischen Vernunft“, die ich in dieser Arbeit nicht leisten werde.
[5] Eine genaue Analyse des Erkenntnisprozesses bedarf einer Auseinadersetzung mit Kants „Kritik der reinen Vernunft“, die ich in dieser Arbeit nicht leisten werde.
[6] Teichert, Dieter: Immanuel Kant: „Kritik der Urteilskraft. Ein einführender Kommentar, Paderborn: Schöningh 1992, S. 29.
[7] Teichert: Kritik der Urteilskraft, S. 55.
[8] Seel, Gerhard: Über den Grund der Lust an schönen Gegenständen. Kritische Fragen an die Ästhetik Kants, in: Oberer, Hariolf/Seel, Gerhard [Hrsg.]: Kant. Analysen – Probleme – Kritik, Würzburg: Königshausen & Neumann 1988, S. 317 – 356, hier: S. 331.
[9] Spremberg, Heinz: Zur Aktualität der Ästhetik Immanuel Kants. Ein Versuch zu Kants ästhetischer Urteilstheorie mit Blick auf Wittgenstein und Sibley, Frankfurt am Main: Peter Lang 1999, S. 55.
[10] Seel: Grund der Lust, S. 329.
[11] Teichert: Kritik der Urteilskraft, S. 31.
[12] Die Begründung Kants, warum wir auf Grund der allgemeinen Mitteilbarkeit unseres lustvollen Gemütszustandes zusätzlich Lust verspüren, fällt mit dem Verweis auf den „natürlichen Hange des Menschen zu Geselligkeit“ (KdU, § 9, 29f) eher unbefriedigend aus. Kant betont zwar im selben Abschnitt, dass er eine bessere Begründung dieser Frage im weiteren Verlauf der KdU liefern wird, tut es jedoch nicht.
[13] Seel: Grund der Lust, S. 341.
[14] Fricke, Christel: Kants Theorie des reinen Geschmacksurteils [= Quellen und Studien zur Philosophie, hrsg. von Patzig, Günther/Scheibe, Erhard/Wieland, Wolfgang, Bd. 26], Berlin: de Gruyter 1990, S. 50.
[15] ebenda, S. 49.
[16] Spremberg: Aktualität der Ästhetik, S. 73.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Einleitung des Textes?
Die Einleitung umreißt die Untersuchung von Geschmacksurteilen nach Immanuel Kant, insbesondere in Bezug auf die "Kritik der Urteilskraft". Der Fokus liegt darauf, dass Kant die Analyse der Frage vernachlässigt, was passieren muss, damit wir einen Gegenstand als "nicht schön" bezeichnen. Die Arbeit zielt darauf ab, diese Lücke zu füllen.
Was wird unter dem positiven Geschmacksurteil „X ist schön“ erläutert?
Dieser Abschnitt erläutert Kants Analyse des positiven Geschmacksurteils. Es wird erklärt, dass das Wohlgefallen am Schönen uninteressiert und frei sein muss. Es wird auf die Rolle der Erkenntnisvermögen (Einbildungskraft, Urteilskraft, Verstand) eingegangen und das Konzept des freien Spiels dieser Vermögen dargelegt. Auch die Harmonie der Erkenntnisvermögen, der Gemütszustand, die Mitteilbarkeit und der Gemeinsinn werden thematisiert.
Was ist die Rolle des Wohlgefallens am Schönen?
Das Wohlgefallen am Schönen ist laut Kant ausschlaggebend dafür, dass wir ein Urteil der Form „X ist schön“ fällen. Es darf nicht auf Interesse gründen, sondern muss ein uninteressiertes und freies Wohlgefallen sein.
Was versteht Kant unter Erkenntnisvermögen?
Kant versteht unter Erkenntnisvermögen die Einbildungskraft, die Urteilskraft und den Verstand. Durch sie sind wir in der Lage, unsere Umwelt zu erkennen. Die Einbildungskraft ordnet optische Eindrücke zu Vorstellungen, der Verstand formt Begriffe, und die Urteilskraft ordnet Vorstellungen unter Begriffe zu.
Was ist der Unterschied zwischen einem Erkenntnisurteil und einem Geschmacksurteil?
Ein Erkenntnisurteil bezieht sich auf Objekte der Außenwelt und folgt klaren Regeln, wodurch es notwendig und allgemeingültig ist. Ein Geschmacksurteil hingegen ist subjektiv und gründet nicht auf Begriffen oder Regeln. Es bezieht sich lediglich auf das Gefühl der Lust oder Unlust des Subjekts.
Was bedeutet Reflexion im Zusammenhang mit Geschmacksurteilen?
Reflexion deutet auf eine psychische Tätigkeit hin. Im Gegensatz zum Wohlgefallen am Angenehmen, bei dem wir kognitiv passiv sind, sind beim Wohlgefallen am Schönen kognitive Prozesse vorgeschaltet.
Was ist das "freie Spiel der Erkenntnisvermögen"?
Das freie Spiel der Erkenntnisvermögen beschreibt einen Zustand, in dem die Einbildungskraft den Verstand erweckt, und dieser ohne Begriffe die Einbildungskraft in ein regelmäßiges Spiel versetzt. Es entsteht ein Kreislauf zwischen Einbildungskraft und Verstand, der als ein Zustand stimulierter Leistungs- und Kooperationsbereitschaft der Erkenntniskräfte beschrieben werden kann.
Was ist Zweckmäßigkeit ohne Zweck?
Zweckmäßigkeit ohne Zweck bedeutet, dass die Form des beurteilten Gegenstandes zweckmäßig für die Erreichung eines Zwecks wäre, wenn es diesen konkreten Zweck denn gäbe. Die Form des Gegenstandes ist subjektiv zweckmäßig für uns bzw. für unsere Erkenntnisvermögen, weil sie diese in ein harmonisches Spiel zu versetzen vermag.
Was wird unter dem negativen Geschmacksurteil „X ist nicht schön“ erläutert?
Dieser Abschnitt untersucht, unter welchen Bedingungen wir ein Urteil der Form „X ist nicht schön“ fällen. Es wird argumentiert, dass das negative Geschmacksurteil auf einer zweckwidrigen Form des zu beurteilenden Gegenstandes beruht, wodurch eine Harmonie im freien Spiel der Erkenntnisvermögen verhindert wird.
Was ist die Ursache für das Unlustgefühl beim negativen Geschmacksurteil?
Das Unlustgefühl entsteht, weil die Urteilskraft nicht in der Lage ist, die von der Einbildungskraft gelieferte Vorstellung unter den Versuch des Verstandes, einen passenden Begriff zu finden, zu subsumieren. Die Form des beurteilten Gegenstandes ist zweckwidrig für die Erkenntnisvermögen, da auf ihr keine Vorstellung beruhen kann, die ein harmonisches Verhältnis ermöglicht.
Kann der Gemütszustand beim negativen Geschmacksurteil allgemein mitteilbar sein?
Nach Kants Logik kann der Gemütszustand, der sich beim negativen Geschmacksurteil einstellt, nicht allgemein mitteilbar sein, da beim negativen Geschmacksurteil keine Harmonie vorliegt, daher kein Gemütszustand dem eines Erkenntnisurteils gleicht, und somit keine allgemeine Mitteilbarkeit gegeben ist.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Ein Gegenstand ist "nicht schön", wenn seine Form zweckwidrig für unsere Erkenntnisvermögen ist. Dies führt zu keiner Harmonie im freien Spiel der Erkenntnisvermögen, was ein Unlustgefühl erzeugt. Dieses Unlustgefühl kann nicht als allgemein mitteilbar wahrgenommen werden, muss aber als subjektiv allgemeingültig und subjektiv notwendig gelten.
- Quote paper
- Manuel Vesely Fernandez (Author), 2005, Wie kann etwas nicht schön sein? Immanuel Kants 'Kritik der Urteilskraft' , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109749