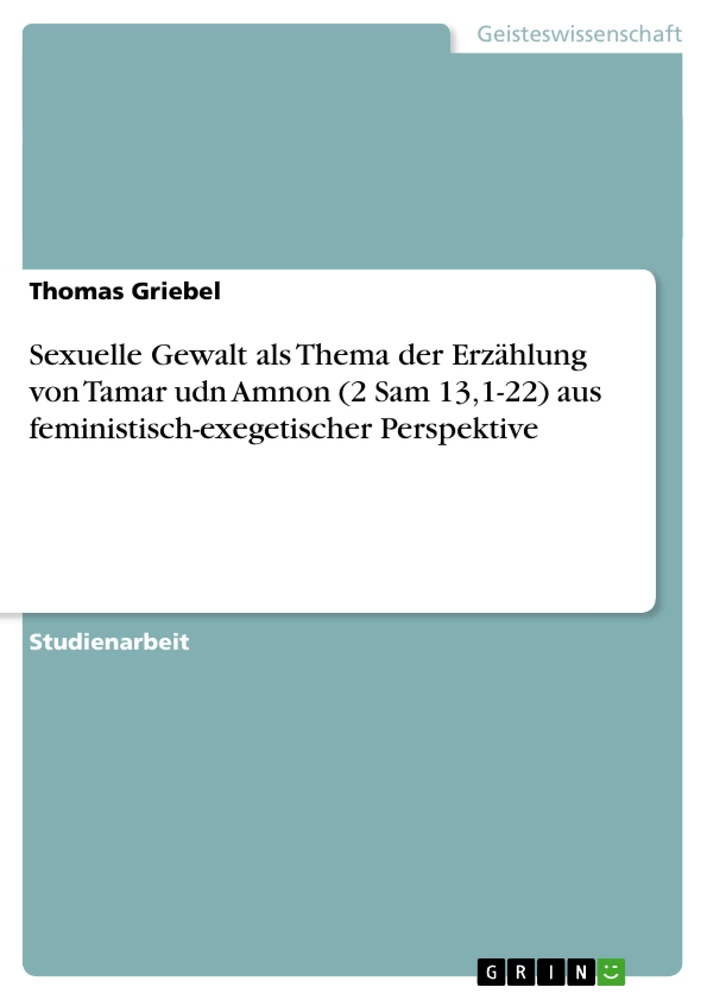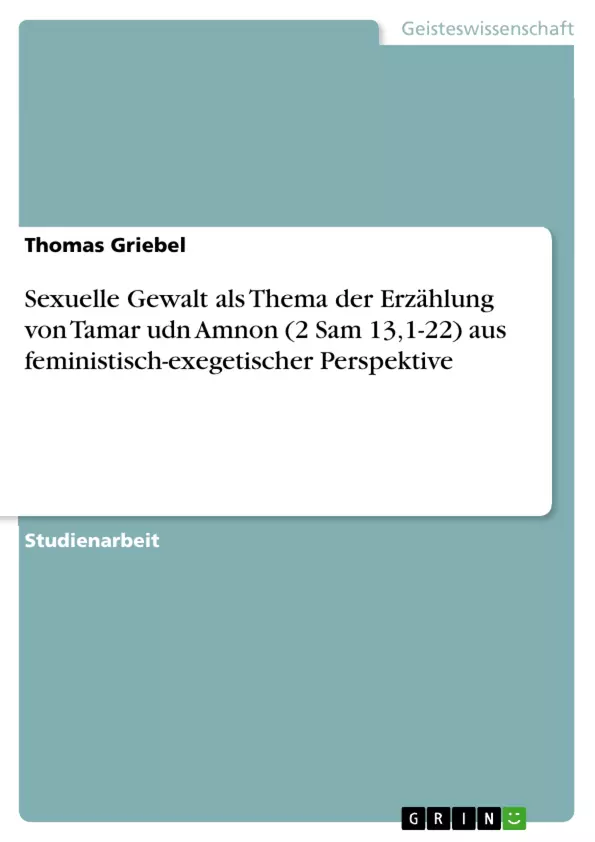Was geschieht, wenn Begehren zur Besessenheit, Liebe zum Hass und Machtmissbrauch zur Norm wird? Diese Frage durchdringt die erschütternde Erzählung von Amnon und Tamar, eine Geschichte, die tief in den dunklen Abgründen menschlicher Natur und gesellschaftlicher Ungerechtigkeit wurzelt. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der familiäre Bande zerbrechen, Unschuld verloren geht und das Schweigen der Gesellschaft lauter schreit als der Schmerz des Opfers. Diese tiefgründige Analyse beleuchtet nicht nur die biblische Erzählung aus feministischer und kriminologischer Sicht, sondern zieht auch beunruhigende Parallelen zu heutigen Formen sexueller Gewalt und deren verheerenden Auswirkungen. Erfahren Sie, wie die Mechanismen von Täterschaft, Opferrolle und sozialer Verantwortung damals wie heute wirken und inwieweit Tamars Schicksal als Spiegelbild für das Leid unzähliger Betroffener stehen kann. Untersucht werden die psychologischen Motive Amnons, die Täterstrategien und die fehlende Schuldeinsicht, sowie die Rolle Davids und Absaloms. Das Buch analysiert Tamars Widerstand, ihr viktimtypisches Verhalten nach der Tat und die langfristigen Folgen für ihr Leben. Es werden intertextuelle Verweise zur Dina-Erzählung und zur Geschichte von Bathseba und David hergestellt. Es wird auch untersucht, wie sexuelle Gewalt in der Familie und im sozialen Umfeld stattfindet, und wie die Gesellschaft Opfer stigmatisiert und Täter schützt. Die Verharmlosung und Tabuisierung sexueller Gewalt, sowie die täterfokussierte Berichterstattung werden kritisch betrachtet. Ein Exkurs zu J.M. Coetzees "Schande" verdeutlicht die universelle Gültigkeit dieser Thematik. Entdecken Sie, wie feministische Exegese und moderne Forschungsergebnisse uns helfen, die Komplexität dieses zeitlosen Dramas zu verstehen und das Schweigen zu brechen, um eine gerechtere Welt zu schaffen. Die Themen sind: sexuelle Gewalt, feministische Theologie, altes Testament, biblische Exegese, Kriminologie, Soziologie, patriarchale Strukturen, Machtmissbrauch, Opferrolle, Täterpsychologie, soziale Verantwortung, Trauma, Vergewaltigung, Davidgeschichte, Thronfolgegeschichte, Amnon, Tamar, Abschalom, Tabuisierung, Schuldzuweisung, Dunkelziffer, Medienberichterstattung, viktimtypisches Verhalten, posttraumatische Belastungsstörung, familiäre Gewalt, Täterstrategien, Schuldeinsicht, soziale Isolation, Coetzee, Schande. Dieses Buch ist ein aufrüttelnder Beitrag zur Debatte um sexuelle Gewalt und ein wichtiges Werkzeug für alle, die sich für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung einsetzen. Eine unverzichtbare Lektüre für Theologen, Sozialarbeiter, Psychologen und alle, die sich mit den dunklen Seiten der menschlichen Natur auseinandersetzen wollen.
Inhalt
1. Einleitung
2. Die Erzählung von Amnon und Tamar
2.1 Einordnung in die Samuelbücher und die Jerusalemer Hofgeschichte
2.2 Struktur und Gliederung
2.3 Auslegung der Szenen I - IV
2.3.1 Szene I
2.3.2 Szene II
2.3.3 Szene III
2.3.4 Szene IV
2.3.5 Szene V
2.4 Weitere Handlung
2.5 Text und Identifikation
2.6 Text und Widerstand
2.7 Intertextuelle Verweise
2.7.1 Parallelen zur Erzählung von Dina
2.7.2 Parallelen zur Erzählung von Bathseba und David
3. Sexuelle Gewalt als Thema der Erzählung von Amnon und Tamar aus kriminologischer und feministisch-soziologischer Perspektive
3.1 Das Opfer
3.1.1 Widerstand
3.1.2 Viktimotypisches Nach-Tat-Verhalten des Opfers
3.1.3 Physische und psychische Folgen sexueller Gewalt
3.2 Der Täter
3.2.1 Sexuelle Gewalt in der Verwandtschaft und im sozialen Nahbereich
3.2.2 Psychologie des Täters: Ursachen und Motive
3.2.3 Täterstrategien
3.2.4 Fehlende Schuldeinsicht des Täters
3.3 Die Gesellschaft
3.3.1 Soziale Folgen sexueller Gewalt für das Opfer
3.3.2 Überleben mit dem Täter
Exkurs: J.M. Coetzee “Schande”
3.3.3 Verharmlosung und Tabuisierung sexueller Gewalt
3.3.4 Täterfokussierte Berichterstattung
4. Zusammenfassung
Übersetzungen (2 Sam 13,1-22)
Anhang
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die Erzählung in 2 Sam 13,1-22 berichtet von Tamar, der Tochter des Königs David, die von ihrem Halbbruder Amnon unter einem Vorwand in seine Kammer gelockt und dort vergewaltigt wird. Während die konventionellen Exegeten in der Regel darum bemüht sind, den Kampf um die Thronnachfolge aufzuhellen und demnach die Erzählung in den Kontext dieses Machtstreits stellen, ist jedoch der Gewaltakt, den Amnon an seiner Halbschwester verübt, an sich kaum Gegenstand dieser Untersuchungen 1. Demgegenüber steht die feministische Exegese, die es sich in Bezug auf die biblischen Texte, die von sexueller Gewalt berichten, zur Aufgabe gemacht hat, die Formen, Funktionen und Auswirkungen sowohl der personalen als auch der strukturellen Gewalt darzustellen 2.
Unter feministischer Exegese versteht man eine in den 1970er Jahren in den USA entstandene und seitdem vor allem dort und in Westeuropa verbreitete Bibelauslegung 3, die biblische Texte auf der Grundlage feministischer Theorie und Praxis betrachtet, wobei Feminismus nach Dorothee Sölle als “Aufbruch von Frauen aus fremdverhängter und selbstverschuldeter Unmündigkeit” 4 zu verstehen ist. Der Begriff “feministische Exegese” bezeichnet dabei keine einheitliche Richtung des Umgangs mit der Bibel, sondern beinhaltet eine Vielzahl verschiedener Modelle sowohl im Hinblick auf hermeneutische Prozesse - von einer “Hermeneutik der Loyalität”, die die Heilige Schrift als Wort Gottes betrachtet und biblisch legitimierte Frauendiskriminierung als ein Problem androzentrischer Auslegung betrachtet, bis hin zu einer radikalen “Hermeneutik der Ablehnung”, die die Bibel als “unrettbar sexistisch” abwertet - als auch in Bezug auf die Methodenvielfalt innerhalb der feministischen Exegese - von historischen und literaturwissenschaftlichen Methoden bis hin zu tiefenpsychologischen Ansätzen 5. Insofern ist, wenn von “der” feministischen Exegese die Rede ist, keine einheitliche Richtung gemeint.
In der vorliegenden Arbeit soll zunächst der Bibeltext analysiert werden. Dabei werden die in der feministischen Exegese gewonnenen Erkenntnisse mit denen der herkömmlichen Bibel-auslegung verglichen. Schließlich werden Forschungsergebnisse sowohl der Kriminologie als auch der feministischen Soziologie zur sexuellen Gewalt auf die Erzählung von Tamar und Amnon angewandt. Ziel der Arbeit ist es somit herauszufinden, ob die in der alttestamentlichen Erzählung festgestellten Mechanismen personaler und struktureller Gewalt mit denen heutiger Formen des sexuellen Missbrauchs übereinstimmen - ob also das Schicksal von Tamar stellvertretend für das heutiger Vergewaltigungsopfer stehen kann.
2. Die Erzählung von Tamar und Amnon
2.1 Einordnung in die Samuelbücher und die Jerusalemer Hofgeschichte
Die Erzählung von Tamar und Amnon ist Teil der Samuelbücher, die als einziges großes Textkorpus gemeinsam mit den Königsbüchern redaktionell zu einer größeren Texteinheit zusammen komponiert wurden. Die Samuelbücher sind das Ergebnis mehrfacher redaktioneller Bearbeitungen. Insofern kann laut Schroer der Name der Samuelbücher, der einen Autor für den Text benennt, kein Hinweis auf die wirkliche Autorschaft sein 6.
Die Jerusalemer Hofgeschichte (auch Thronfolgegeschichte) als Teil des zweiten Samuelbuchs und 1. Könige (2 Sam 11 - 1 Kön 2) erzählt von der Auseinandersetzung um die königliche Macht 7. Sie wurde am Jerusalemer Hof wahrscheinlich von weisheitlich-prophetisch orientierten Gruppen im 9. Jahrhundert vor Christi oder zur Zeit Salomos verfasst 8.
Die Erzählung von Tamar und Amnon ist im Erzählganzen der Davidgeschichte nur wenig verankert 9: Der Gang der Erzählung ist in sich abgerundet, sodass sie sich vom Kontext wenig beeinflusst zeigt 10. Sie ist jedoch nicht im Sinne einer Novelle von Kapitel 15 abzusetzen 11, da sie auf den Tod Amnons als ersten Thronfolger vorbereiten soll 12. Allerdings darf die Erzählung nicht auf ihre Funktion der Verdeutlichung des Grundes Abschaloms, Amnon umzubringen, reduziert werden, da Tamar die Hauptperson und der Zielpunkt der Anteilnahme des Erzählers ist (siehe Kapitel 2.6) 13.
Das 13. Kapitel des zweiten Samuelbuchs ist im Gegensatz zu anderen Teilen der Jerusalemer Hofgeschichte weder im Rahmen der deuteronomistischen Bearbeitung noch danach verändert worden 14.
2.2 Struktur und Gliederung
Lescow erkennt in der Erzählung wie andere ExegetInnen auch (Ridout, Bal, Conroy, Fokkelman u.a., 15) eine konzentrische Struktur: Im Zentrum steht die Handlung in Amnons Bett, umgeben von einem dreifachen Rahmen (1. Amnons Hinterzimmer, 2. Amnons Haus / Straße, 3. Tamars Haus / Abschaloms Haus). Die zentrale Szene in Amnons Bett ist ebenfalls konzentrisch aufgebaut, der Satz Tamars “Und ich, wohin soll ich meine Schmähung tragen?” nimmt hierbei die zentrale Stellung ein, umrahmt von mehreren symmetrisch angeordneten Stufen 16.
Shimon Bar-Efrat macht für die Erzählung hingegen eine kettenförmige Konstruktion aus, wobei die handelnden Personen die die einzelnen Teilabschnitte verbindenden Glieder darstellen: Jonadab - Amnon (V. 3-5), Amnon - David (V. 6), David - Tamar (V. 7), Tamar - Amnon (V. 8-16), Amnon - Diener (V. 17), Diener - Tamar (V. 18), Tamar - Abschalom (V. 19-20). Den strukturellen Höhepunkt erkennt Bar-Efrat in V. 8-16, die übrigen Ebenen sind symmetrisch um das Zentrum angeordnet. Die Eröffnung (V. 1-2) und der Schluss (V. 21-22) sind nicht Teil der vom Erzähler konstruierten Kette 17.
Charakteristisch für den Text sind die mehrfach vorkommenden Ortswechsel, die eine für die Erzählung gliedernde Funktion haben. Auffällig ist dabei das Motiv des Hauses: Während das Haus im Allgemeinen für Schutz und Zuflucht steht, hat keines der im Text vorkommenden Gebäude eine behütende Funktion, da in jedem der Häuser Männer die Hausmacht besitzen. Das erste Haus muss Tamar auf Befehl ihres Vaters verlassen. Im zweiten Haus, dem Amnons, wird Tamar von ihrem Halbbruder vergewaltigt. Hier ist die zunehmende Einengung des Ortes von Amnons Haus über Amnons Kammer bis hin zu seinem Bett markant, die für Tamar paradoxerweiser mit jedem Schritt einen weiteren Verlust an Obhut und Sicherheit bedeutet. Die Straße schließlich ist der einzige Ort, an dem für Tamar eine Befreiung möglich ist, wohingegen der dauerhafte Aufenthalt in Abschaloms Haus den endgültigen Verlust der Würde und Selbstbestimmungsmöglichkeit für Tamar darstellt 18.
Die beschriebenen Ortswechsel sind Grundlage für die szenische Gliederung, die Müllner für den Text entwirft: Sie teilt die Erzählung in fünf Szenen ein, wobei die erste und die letzte Szene die Funktion der Exposition (V. 1a-3c) bzw. der Coda (V. 20f-22c) haben. Szene II (V. 4a-10c) beschreibt die Vorgänge in Amnons Haus, Szene III (V. 10d-18d) die Ereignisse in seiner Kammer und Szene IV (V. 19a-20e) die Geschehnisse, die außerhalb des Hauses stattfinden. 19 20
2.3 Auslegung der Szenen I-V
2.3.1 Szene I
Die erste Szene hat innerhalb der Erzählung von Tamar und Amnon die Funktion der Exposition: Der erste Satz “Und es geschah daraufhin” verweist zum einen darauf, dass hier ein neuer Abschnitt beginnt, indem durch das Wort “Und-es-geschah” das folgende Geschehen substituiert wird, zum anderen bindet er die Erzählung in die Jerusalemer Hofgeschichte ein, indem durch das Wort “daraufhin” auf bereits Erzähltes verwiesen wird 21.
Der Expositionscharakter wird ebenso an der Einführung der handelnden Personen deutlich: Die Geschwister Abschalom und Tamar werden wie ihr gemeinsamer Halbbruder Amnon vorgestellt. Alle drei sind Kinder des Königs David, wobei Abschalom und Tamar Kinder Maachas, der Tochter des Königs Talmar von Gschur, sind, wohingegen Amnon aus der Beziehung Davids zu Achinoam aus Jisreel hervorgegangen ist 22. Sowohl Amnon, der Erstgeborene Davids, als auch Abschalom, der dritte Königssohn, sind in Hebron geboren (2 Sam 3,2-5) 23. Einschließlich Jonadabs, des Neffen Davids, werden alle in der Exposition vorgestellten AktantInnen direkt oder indirekt durch ihre verwandtschaftliche Relation zu David hin konstituiert, der somit als Knotenpunkt der handelnden Personen verstanden werden kann 24.
Amnon ist es “eng bis zum Krankwerden wegen Tamar” (V. 2), in die er verliebt ist. Ilse Müllner weist darauf hin, dass der spätere Umschlag von Liebe in Hass meist so interpretiert wird, als sei die Liebe Amnons nicht existent gewesen und nur auf sein sexuelles Begehren beschränkt; sie fordert jedoch, die Intensität sowohl des Hasses als auch der in Vers 1 benannten Liebe als solcher ernst zu nehmen 25. Die Frage nach der Liebe Amnons zu Tamar ist auch bei der Frage nach dem Motiv des Königssohns von Bedeutung (siehe Kapitel 2.3.3).
Als Hindernis für die Befriedigung von Amnons Verlangen nennt der Text die Jungfräulichkeit Tamars (V. 2). Dieser soziale Status beschreibt gleichzeitig die Zugehörigkeit zu ihrem Vater David. Ein Eindringen Amnons in Tamars Körper ist zugleich ein Eindringen in den Machtbereich Davids, dessen Besitz Tamar ist 26. Unklar ist, ob das halbgeschwisterliche Verhältnis Amnons zu Tamar ebenso ein Hinderungsgrund für eine Beziehung ist: Die Erzählung verschweigt weitgehend den in ihr geltenden Rechtshintergrund 27. Zwar sieht das Gesetz in Lev 20,10.17 für den Geschlechtsverkehr zwischen Bruder und Halbschwester die Todesstrafe vor 28, laut Müllner ist es jedoch historisch ungewiss, ob den überlieferten Rechtstexten eine tatsächliche Rechtspraxis entspricht 29. Nach Hentschels Ansicht ist das in Levitikus und Deuteronomium festgeschriebene Gesetz erst in späterer Zeit entstanden 30.
2.3.2 Szene II
Der Rat Jonadabs, Amnon solle sich krank zeigen und seinen Vater David darum bitten, von Tamar die Krankenkost gereicht zu bekommen (V. 5), zielt nicht darauf, die Vergewaltigung Tamars zu ermöglichen, sondern soll Tamar einzig in die Nähe Amnons bringen 31. Der als sehr klug (V. 3) bezeichnete Cousin Amnons kann sowohl von Tamars Zurückweisung als auch von Amnons Gewalttat nichts ahnen. Er ist damit vom Erzähler nicht, wie es den LeserInnen aufgrund ihres Wissens um den Ausgang der Erzählung erscheinen mag, negativ konnotiert 32.
Amnon befolgt Jonadabs Rat und zeigt sich David krank (V. 6). Im Gegensatz zu den meisten Übersetzungen (Luther, Elberfelder, Steurer u.a.) überträgt Müllner die hebräische Vokabel mit “sich krank zeigen” und verweist darauf, dass eine Übersetzung mit “sich krank stellen” nicht dem Sachverhalt entspricht, da Amnon offensichtlich kein Leiden vortäuscht, sondern seine in Vers 2 benannte Liebeskrankheit (“Amnon war es eng bis zum Krankwerden wegen Tamar”) offen zeigt 33. Auch die Übertragung von Buber und Rosenzweig (“er gebärdete sich krank”) kann in Müllners Sinne gelesen werden.
Die Zubereitung der Krankenkost durch Tamar wird sowohl von Bledstein als auch von Stoebe als heilendes Ritual bezeichnet 34, wohingegen Kunz darauf hinweist, dass ein ritueller Hintergrund hier nicht auszumachen ist und es sich bei der geschilderten Handlung um eine gewöhnliche Zubereitung handelt. 35 Unumstritten ist, dass sowohl das Bereiten der Speise durch Tamar als auch das Essen aus ihrer Hand eine sexuelle Bedeutung implizieren. Schon der Begriff “Herzkuchen” (Müllner) bzw. “Herzkringel” (Buber-Rosenzweig, Steurer) beinhaltet eine erotische Anspielung, wobei nach Müllner das Herz in diesem Fall keine Metapher für ein romantisches Gefühl, sondern für Wille, Leidenschaft und Entscheidung ist. Des Weiteren hat der Begriff “labab” (herzbacken bzw. kringeln) auch die Bedeutung “durch Liebe verzaubern” 36.
Das Essen aus Tamars Hand impliziert demnach körperliche Nähe 37. Nach dem “Sehen” findet dieser erste durch den Blick repräsentierte Zugriff auf Tamars Körper (“damit ich sehe”, V. 5) seine Fortsetzung in der Überwindung der körperlichen Distanz durch das Essen aus Tamars Hand 38. Insofern kann der anschließende Befehl Davids an Tamar, der ohne direkten Kontakt über einen Boten erfolgt, als verantwortungslos gegenüber seiner Tochter bezeichnet werden, da der König aufgrund der erotischen Andeutungen die Intention Amnons hätte erkennen können 39.
Tamar befolgt den Befehl Davids, nicht zuletzt weil es für eine Frau in ihrer Gesellschaft selbstverständlich ist, für das Wohlergehen von Männern zu sorgen 40. Sie bereitet im Haus ihres Halbbruders die Krankenspeise zu, von der Amnon sich jedoch zunächst zu essen weigert. Um keine Zeugen für den von ihm geplanten sexuellen Akt zu haben, schickt er “alle Mann”, seine Bediensteten, hinaus (V. 9) und lässt Tamar in seine Kammer kommen (V. 10).
2.3.3 Szene III
Tamar folgt ihrem Halbbruder Amnon auf dessen Anordnung hin in sein Schlafgemach. Dort fordert er sie auf, mit ihr zu schlafen. Tamar appelliert daraufhin an Amnon, sie nicht zu “entrechten” (V. 12), wobei sie Amnons wertneutrale Rede (“Schlaf mit mir”, V. 11) entlarvt 41. Das hebräische Wort für diesen Vorgang, “innah”, kann nicht mit “Vergewaltigung” wörtlich übersetzt werden, da es die Bedeutung “jemanden ungebührlich behandeln, sodass er erniedrigt oder entehrt wird” hat. Allerdings weist ihre ausdrückliche Verweigerung darauf hin, dass Tamar ihren Bruder bittet, sie nicht zu vergewaltigen 42. Das Wort “innah” bezeichnet dabei nur die soziale Dimension der Tat, ohne dessen gewalttätige Qualität und seine physischen und psychischen Folgen für das Opfer einzuschließen 43.
Tamar begründet ihre Bitte an Amnon, von einer Vergewaltigung abzusehen, mit den gesellschaftlichen Normen, die den Sexualakt außerhalb eines sozialen Rahmens verbieten 44. Dass ihre Angst vor dem Geschlechtsverkehr nicht in der Sorge um ihre körperliche und psychische Integrität begründet liegt, zeigt, dass sie Amnon die Möglichkeit eröffnet, den gemeinsamen Vater David um eine Genehmigung der Heirat zu bitten, damit der sexuelle Akt für Tamar sozial abgesichert stattfinden kann. Tamar zeigt damit die von Jahnow bei Frauengestalten des Alten Testaments häufig festgestellte Bereitschaft, ihre eigene Person für soziale und familiäre Zwecke preiszugeben 45. Die Folgen eines unehelichen Geschlechtsverkehrs für Tamar zeigen sich insbesondere darin, dass Tamar von “meine[r] Schmähung” (V. 13) spricht, sie also für eine Vergewaltigung durch ihren Bruder selbst verantwortlich wäre 46.
Tamars weise und in höchstem Maße verantwortungsvolle Rede 47 ist insofern bedeutsam, als dass es sich um die einzige - wenn auch vergebliche - Widerstandshandlung eines Opfer sexueller Gewalt im Alten Testament handelt. Sie ist auch die einzige der betroffenen Frauen, der das Recht der direkten Rede zugestanden wird. Allerdings findet der Widerstand Tamars nur im Bereich sprachlicher Handlungen statt 48.
Der anschließend folgende sexuelle Akt wird in einer für das Alte Testament nicht ungewöhnlichen Dreigliedrigkeit beschrieben (“Und er war stärker als sie. Er entrechtete sie. Und er beschlief sie”, V. 14), wobei die einzelnen Stufen nicht im Sinne dreier aufeinanderfolgender Handlungen zu verstehen sind, sondern verschiedene Dimensionen der Tat darstellen. Das Zusammenwirken der drei Wörter zur Beschreibung des Aktes zeigt, dass es sich um eine Vergewaltigung handelt, obwohl ein einzelnes Wort für diesen Vorgang im Hebräischen fehlt 49.
Die schwierigste Frage in der Auslegung der Erzählung von Tamar und Amnon ist die nach dem Motiv Amnons für die Vergewaltigung sowie für das anschließende Verstoßen seiner Halbschwester. Die in der feministischen Exegese gängige These besagt, dass Amnons Begehren sich in erster Linie nicht auf Tamar, sondern auf Tamar als Tochter des Königs richtet. Da das Opfer zum Zugehörigkeitsbereich Davids gehört, bedeutet die Vergewaltigung ein Eindringen in dessen Machtbereich. Sexualität wird somit zum herrschaftspolitischen Machtinstrument, wie es auch an anderen Stellen des Alten Testaments deutlich wird (vgl. 2 Sam 16; 1 Kön 1.2) 50. “Der in 2 Sam 13 erzählte Akt sexueller Gewalt erwächst weder aus überschwenglicher Liebe noch aus ungehemmtem Trieb, sondern besteht in dem Versuch, Herrschaft mittels eines sexuellen Akts herzustellen” 51.
Zu kritisieren ist diese an und für sich nachvollziehbare These hinsichtlich der in Vers 1 genannten Liebe Amnons zu Tamar. Wird die Vergewaltigung als ein reiner Machtkampf zwischen Amnon und David interpretiert, so wird die Existenz dieses Gefühls bestritten. Eine streng am Bibeltext orientierte Exegese muss jedoch die Liebe Amnons als existent betrachten. Der katholische Theologe und Psychotherapeut Eugen Drewermann hat sich in einer Predigt zu 2 Sam 13,1-22 mit der Frage beschäftigt, warum Amnon seine Halbschwester vergewaltigt hat, trotzdem sie ihm durch die Möglichkeit der Heirat einen Weg aufgezeigt hat, seinen Wunsch nach Geschlechtsverkehr mit ihr zu stillen, und warum Amnons “Liebe” im Anschluss an die Vergewaltigung in Hass umschlägt. Drewermann sieht den Grund darin, dass Amnon durch das unmoralische Handeln seines Vaters und eigentlichen Vorbilds David (2 Sam 11) stark neurotisiert wird, indem er die widersprüchlichen Gefühle gegenüber seinem Vater auf sich selbst überträgt. Amnon, der unter keinen Umständen derart sündhaft handeln will wie David, ist nicht mehr in der Lage, in der Liebe zu einer Frau etwas “Legitimes, Menschliches und Glückliches” 52 zu sehen: “Wenn es möglich ist, daß die Leidenschaft einen Mann wie David so verbrennt und den eigenen Vater derartig ins Unheimliche stellt, wie stark muß dann diese Leidenschaft im Herzen eines Mannes sein können! Also hüte dich, Amnon, jemals davon etwas zu empfinden! Meide, Amnon, jegliches Gefühl, das einer Frau gelten könnte.” 53 Der Königssohn verliebt sich nun in seine Halbschwester. Obwohl nach Ansicht Drewermanns das Inzestgesetz erst später entstanden ist, kommt für Amnon eine Heirat nicht in Frage, da es ihm nicht möglich ist, Gefühle gegenüber einer Frau zu haben und sie dann zu legalisieren, wie es sein Vater getan hat. Eine mögliche Brücke, die Liebe zu Tamar zu ertragen, ist für Amnon die - nicht in einem sexuellen Sinn verstandene - Pflege durch seine Schwester. Amnon wird jedoch von seinen Gefühlen übermannt und vergewaltigt Tamar. Seinen Selbsthass und seine Schuldgefühle, die ihm eine Heirat unmöglich machen, überträgt er auf das Opfer. Das Verstoßen Tamars ist die logische Konsequenz. - Die psychoanalytische Deutung Drewermanns widerspricht der feministischen Auslegung des Textes nicht nur in Bezug auf die Frage nach dem Motiv - Amnons Tat ist keine Machtdemonstration gegenüber David, sondern die Folge einer neurotischen Störung -, sondern auch in der Art und Weise des Umgangs mit Opfer und Täter der Vergewaltigung. Während Tamar als Opfer kaum erwähnt wird, wird Amnon selbst nicht als Täter, sondern als hilfloses Opfer bezeichnet: “Man [Amnon] hat jemanden zum Opfer gemacht, aber selbst ist man dabei zum Opfer geworden.” 54 Tamar, so Drewermann, sei eine Verwüstete: “Aber ist Amnon etwas anderes?” 55
Im Anschluss an die Tat findet ein auf den ersten Blick erstaunlicher Wandel der Gefühle Amnons zu Tamar statt: “Und Amnon haßte sie mit sehr großem Haß. Ja, größer war der Haß, mit dem er sie haßte, als die Liebe, mit der er sie liebte.” (V. 15) Hier wird den LeserInnen ein für eine hebräische Erzählung außergewöhnlich tiefer Einblick in die emotionale Welt eines Aktanten gestattet 56. Wenn nun die Vergewaltigung eine reine Demonstration der Macht Amnons über den Verfügungsbereich Davids bedeutet, ist die hier beschriebene Wandlung keine eigentliche Wandlung, da die in Vers 1 beschriebene Liebe Amnons zu Tamar als nicht existent betrachtet wird. Wenn man sich bei der Auslegung der Erzählung jedoch streng am Bibeltext orientiert und dementsprechend voraussetzt, dass Amnons Liebe zu seiner Halbschwester vor der Tat vorhanden war, so erscheint die Wandlung Amnons in der Tat unverständlich. Hier weist zum einen Anita Heilig darauf hin, dass Amnon im Anschluss an die Vergewaltigung, da er die Unrechtmäßigkeit des Aktes erkennt, Tamar - insbesondere ihrem Körper und ihrer Schönheit - die Schuld für die Vergewaltigung zuweist 57. Zum anderen ist Müllner der Meinung, dass Liebe und Hass nicht im einem Verhältnis der Vor- und Nachzeitigkeit gesehen werden dürfen, sondern zu der auch nach der Tat bestehenden Liebe der Hass Amnons hinzukommt 58. Schlussendlich hat auch Drewermann in seiner Interpretation eine Möglichkeit aufgezeigt, den Wandel Amnons unter Berücksichtigung einer vorher existenten Liebe zu betrachten (siehe oben).
Amnon befiehlt seinem Diener, Tamar trotz deren letzter vergeblicher Intervention hinauszuwerfen. Tamar (von Amnon abwertend als “diese” bezeichnet) wird ihrem Halbbruder als benutz- und wegwerfbarer Gegenstand überdrüssig. Die Vertreibung bedeutet für Tamar eine erneute Gewalttat, die sie selbst als schwerwiegender als die vorangegangene Vergewaltigung empfindet. Sie hat ihren wichtigsten Wert in sozialer Hinsicht, ihre Jungfräulichkeit verloren, und muss dafür in der patriarchalen Ordnung ihrer Zeit die Folgen allein tragen 59.
2.3.4 Szene IV
Tamar beklagt das ihr angetane Unrecht, indem sie die ritualisierte Verhaltensweise Trauernder der damaligen Zeit annimmt. Allerdings tut sie dies öffentlich, um das ihr angetane Unrecht zu benennen und anzuklagen. Von besonderer Bedeutung ist das Zerreißen ihres sie der Gruppe der jungfräulichen Königstöchter zuordnenden Leibrocks, das den ihr angetanen Gewaltakt symbolisiert, und zwar auf individueller (Zerreißen des Körpers durch gewaltvolles Eindringen) wie auf sozialer Ebene (Verlust des gesellschaftlichen Status) 60.
Abschalom hindert daraufhin Tamar, die an ihr begangene Tat weiter öffentlich zu machen. Tamar kommt ihm gegenüber nicht zu Wort, auf die an sie gerichtete rhetorische Frage lässt Abschalom keine Antwort zu 61. Seine Reaktion ist nicht als Trost oder Hilfe zu verstehen - er verharmlost Tamars Gefühle und spricht von der Vergewaltigung als “Sache” - es geht ihm vielmehr darum, die Tamar und damit der Königsfamilie angetane Schande zu vertuschen, um die Familienehre nicht zu gefährden 62. Insofern ist Abschaloms Intervention als dritter Gewaltakt an Tamar zu verstehen: Nach dem Angriff und der Verstoßung wird Tamar ihrer Handlungsfähigkeit beraubt.
2.3.5 Szene V
Die abschließende Szene hat für die Erzählung von Tamar und Amnon als Coda eine substituierende Funktion. Sowohl die letzten Worte (“wegen der Sache, daß er Tamar, seine Schwester, entrechtet hatte”, V. 22) als auch “all diese Dinge” (V. 21) fassen das Erzählte zusammen und schließen die Erzählung somit ab. Die substituierende Funktion der letzten Szene zeigt sich auch in der Wiederaufnahme aller handelnden Personen mit Ausnahme Jonadabs 63.
Tamars “Verdorren” bzw. “Veröden” im Haus ihres Bruders (V. 20) wird von Müllner als “lebendiger Tod” 64 bezeichnet. Sie trägt somit die Folgen für die an ihr begangene Tat 65. In Bezug auf ihre Frage nach dem “Wohin” der Schmähung ist Abschaloms Haus ein “Nicht-Ort” 66, da es Tamar nicht möglich ist, ihr Unrecht öffentlich zu machen und sich selbst zu rechtfertigen 67.
David (V. 21) ist sowohl als Oberhaupt der Familie als auch als königlicher Richter gezwungen, auf Amnons Vergehen zu reagieren, da Tamar zum Zeitpunkt der Tat als unverheiratete Tochter in seinem Haus gelebt hat 68. Es ist ihm sowohl möglich, die Todesstrafe zu verkündigen, als auch eine Heirat zu befehlen 69. Seine Reaktion auf das Verbrechen beschränkt sich jedoch auf einen folgenlosen Zorn. Zu bezweifeln ist, dass seine Wut in der Vergewaltigung an sich begründet ist, da der biblische Text nicht erwähnt, dass David sich für das Schicksal seiner Tochter interessiert 70. Eher ist anzunehmen, dass David über die Verletzung seines väterlichen Vorrechts über Tamar, deren Besitzer er ist 71 in Wut gerät 72. Davids folgenloser Zorn und somit auch seine fehlende Handlungskompetenz stehen im scharfen Kontrast zu seiner sozialen Position als König 73. Der Grund für seine Zurückhaltung kann zum einen in der erzieherischen Schwäche gegenüber seinen Kindern liegen, zum anderen fehlt ihm durch sein schuldhaftes Verhalten (Ehebruch und Mord in 2 Sam 11) die moralische Autorität, das ähnlich geartete Verbrechen seines Sohnes zu bestrafen 74. Nicht auszuschließen ist auch die Interpretation Astrid Hannappels, David strafe seinen Sohn nicht, da er nicht Amnon, sondern Tamar die Schuld für ihre Entrechtung gebe 75. Davids Zorn würde sich dementsprechend nicht gegen Amnon, sondern gegen den Vorgang an sich richten.
Abschalom (V. 22) hasst seinen Halbbruder Amnon für die Gewalttat an seiner Schwester. Seine Reaktion auf das Verbrechen besteht allerdings in der bloßen Verweigerung der Kommunikation. Abschalom geht der Konfrontation mit seinem Halbbruder somit aus dem Weg 76.
Die Erzählung von Amnon und Tamar wird durch die Coda nicht gänzlich zum Abschluss gebracht, da der Hass Abschaloms auf eine weitere Handlung hindrängt. Sie findet somit erst in der Ermordung Amnons durch Abschalom ihr narratives Ende 77.
2.4 Weitere Handlung
Es ist auffällig, dass Tamar in der Erzählung von der Rache Abschaloms an Amnon keine Rolle mehr spielt 78: Das Schicksal seiner Schwester wird von Abschalom funktionalisiert 79. Die These, er räche Tamar für die psychische und physische Gewalt, die ihr angetan worden ist, erweist sich somit als nicht haltbar, zumal die Verbannung, die Abschalom seiner Schwester auferlegt, ebenfalls dagegen spricht.
Mehrere feministische Exegetinnen (Heilig, Jung u.a.) vertreten die Ansicht, der Mord Abschaloms an Amnon habe politische Gründe: Die Vergewaltigung seiner Schwester berechtige Abschalom, seinen in der Thronfolge vor ihm stehenden Halbbruder zu beseitigen, um selbst die Nachfolge seines Vaters David anzutreten. Tamar diene somit dem Machtinteresse ihres Bruders 80. Müllner erkennt in der Ermordung Amnons ebenso wie in der Vergewaltigung Tamars einen Angriff auf David als Oberhaupt des Hauses, dem die Macht zunehmend entgleitet 81. Gestützt wird diese These durch 2 Sam 13,22 (“Und Abschalom sprach nicht mit Amnon, weder im Bösen, noch im Guten. Denn Abschalom haßte Amnon wegen der Sache, daß er Tamar, seine Schwester, entrechtet hatte.”). Dementsprechend kann das Nicht-Reden mit Amnon als Folge der Vergewaltigung gedeutet werden, während die Thronfolgeambitionen Ursache des Mordes Abschaloms an seinem Halbbruder sind.
Ebenso ist es jedoch möglich, die Tötung Amnons durchaus als Rache für die Tat Amnons zu interpretieren, jedoch nicht aufgrund der psychischen und physischen Gewalt, die Tamar angetan wurde, sondern als Vergeltung für die Verletzung der Familienehre, die Amnon begangen hat, indem er einerseits in den Machtbereich seines Vaters eingedrungen ist, andererseits durch das Verstoßen der Halbschwester deren Heiratsfähigkeit und somit ihren sozialen Wert zerstört hat. Abschaloms Tat wäre demnach nicht als Rache für die Vergewaltigung aufzufassen, sondern für das Verstoßen Tamars. Gestützt wird diese Vermutung durch die bereits angeführte Tatsache, dass das Wegschicken als durchaus schwerwiegender betrachtet wird als die Vergewaltigung selbst (2 Sam 13,16).
2.5 T ext und Identifikation
Die LeserInnen erhalten nicht zu allen AktantInnen den gleichen Zugang: Während der Erzähler Einblick in das emotionale Leben Amnons, Davids und Abschaloms gewährt (Verse 1.2.14.15.16.21.22), werden die Gefühle Tamars nicht kommuniziert, was angesichts des Interesses des Textes am Schicksal Tamars auffällig ist. Vor allem die Einblicke in das Gefühlsleben Amnons fördern die Identifikation gerade des männlichen Lesers mit dem Protagonisten. Der Text verfolgt damit das Ziel, dem Leser durch die Identifikation mit Amnon seine eigenen sexistischen Denk- und Verhaltensweisen bewusst werden zu lassen 82.
2.6 T ext und Widerstand
Das Erzählen der Geschichte von Amnon und Tamar widerspricht dem von Abschalom formulierten Schweigegebot und richtet sich somit gegen die von den Aktanten repräsentierte Strategie, sexuelle Gewalt zu tabuisieren. Zwar findet die Frage Tamars, wohin sie ihre Schmähung tragen soll (V. 13), innerhalb der Geschichte keine Antwort, jedoch kann der Text an sich als ein solcher Ort aufgefasst werden. Die Strategie des Textes, der sich auch sonst auf der Seite Tamars weiß, ist somit eine “Strategie des Widerstands”, sowohl im Hinblick auf die realen ErzählerInnen, die sich dem Schweigegebot Abschaloms widersetzt haben, als auch die LeserInnen betreffend, die durch das Wiederlesen einen “widerspenstigen Akt” vollziehen 83. Die von Petra Heilig entwickelte 84 und von Müllner in Ansätzen aufgenommene 85 These, die Geschichte von Tamar sei einzig als Dramatisierungselement in der Thronfolgegeschichte zu betrachten und diene dazu, Abschalom gegenüber Amnon und David positiv zu kontrastieren, wodurch Tamar vom Text zur Verdeutlichung politischer Machtkämpfe funktionalisiert worden sei, ist demnach abzulehnen.
2.7 Intertextuelle Verweise
2.7.1 Parallelen zur Erzählung von Dina
Das Motiv der sexuellen Gewalt findet sich in mehreren Texten des Alten Testaments, so beispielsweise in Richter 11 (Jeftahs Tochter), Richter 19,15ff (Greueltat der Benjaminiter von Gibea) sowie in der Erzählung von Dina, der Tochter Jakobs (Gen 34). Letzterer Text weist mehrere signifikante Gemeinsamkeiten mit 2 Sam 13 auf: In beiden Erzählungen wird die Tat durch den Blick des Vergewaltigers ausgelöst. Sowohl Dina als auch Tamar, beide die einzig erwähnte Tochter eines berühmten Vaters, werden als starke Persönlichkeiten beschrieben, Tamar aufgrund ihrer verbalen Stärke und Dina, da sie selbstbewusst ausgeht, “die Töchter des Landes zu sehen” (Gen 34,1). Beide Texte schildern die Vergewaltigung als eine emotionale Wende des Täters: Sichem, der Vergewaltiger Dinas, liebt sein Opfer, nachdem er den Verkehr mit ihr vollzogen hat, während Amnon Tamar vor dem sexuellen Akt liebt. Das Motiv, den Vater des Opfers um Heirat zu bitten, kommt in beiden Erzählungen vor. Sowohl Dina als auch Tamar werden durch den Bruder bzw. die Brüder durch eine List gerächt; der Vater steht in beiden Texten der Rache ablehnend gegenüber. Die Handlungsunfähigkeit des Vaters steht in scharfem Kontrast zu dessen sozialer Stellung und seiner Rolle innerhalb der biblischen Erzählungen 86. Schlussendlich kommen beide Figuren, Tamar und Dina, in der Bibel nur als Opfer einer sexuellen Gewalttat vor: “Auch Tamar betritt [wie Dina] die Bühne der erzählten Welt, um Opfer eines Mannes zu werden, und auch sie verlässt diese Bühne zerstört.” 87
2.7.2 Parallelen zur Erzählung von Bathseba und David
Auch im Vergleich zur Erzählung von Davids Ehebruch mit Bathseba gibt es Gemeinsamkeiten mit der Tamar-Erzählung: In beiden Texten schläft ein Mann verbotenerweise mit einer Frau. So wie es sich bei Tamars Vergewaltigung um einen unwiederholten sexuellen Akt handelt, so ist auch Davids Ehebruch ursprünglich als ein einmaliges Abenteuer geplant gewesen. David reagiert in beiden Fällen zornig, in der Erzählung von Amnon und Tamar auf das tatsächliche Geschehen, in seinem eigenen Fall auf ein fingiertes Ereignis. Beide Male bleibt Davids Zorn folgenlos, nicht jedoch das Geschehen, dass jeweils mit dem Tod eines Sohnes Davids endet 88. - Manche Exegetinnen gehen soweit, Parallelen zu ziehen, indem sie den sexuellen Akt zwischen David und Bathseba ebenfalls als eine Vergewaltigung interpretieren 89.
3. Sexuelle Gewalt als Thema der Erzählung von Tamar und Amnon aus kriminologischer und feministisch-soziologischer Perspektive
“Mit der biblischen Erzählung von Tamars Vergewaltigung durch ihren Halbbruder Amnon wird die Situation der von Gewalt betroffenen Frauen und Mädchen sehr treffend beschrieben”, so Astrid Hannappel 90. Ebenso meint die Theologin Petra Heilig: “Tamars Geschichte [...] lehrt uns die Realität von Frauenleben im Patriarchat damals und heute!” 91 Einerseits können die in der feministischen Diskussion um sexuelle Gewalt gewonnen Kategorien zu einem tieferen Verständnis der Erzählung von Tamar und Amnon beitragen, andererseits hilft die Analyse des biblischen Textes, eben jene Kategorien intensiver zu beschreiben 92. Im Folgenden soll untersucht werden, inwieweit kriminologische und feministisch-soziologische Forschungsergebnisse zur sexuellen Gewalt auf die biblische Erzählung von Tamar und Amnon angewandt werden können.
3.1 Das Opfer
3.1.1 Widerstand
Der aktive Widerstand des Opfers gegen die Vergewaltigung ist zumeist abhängig von der sozialen Stellung des Täters. Tamar übt nur verbalen Widerstand, und auch dieser ist in seiner Rhetorik nicht sonderlich aggressiv. Aktiven nonverbalen Widerstand leistet sie nicht. Dies liegt, gemäß der genannten Theorie von der Statusabhängigkeit des Widerstands, in der gehobenen Stellung Amnons zum einen als Thronfolger, zum anderen als Mann in einer patriarchalen Gesellschaft begründet.
3.1.2 Viktimotypisches Nach-Tat-Verhalten des Opfers
Die Viktimologie als der kriminologische Teilbereich, der sich mit dem Verbrechensopfer befasst, definiert als für Opfer von Vergewaltigungen typisches Nach-Tat-Verhalten unter anderem eine starke Beunruhigung und Affektentladung, z.B. durch lautes Schreien oder Weinen 93, sowie Selbstverletzungen als Form der Selbstbestrafung und aufgrund des Gefühls, durch die Vergewaltigung “schmutzig” geworden zu sein 94. Insofern entspricht die in Vers 19 beschriebene Reaktion Tamars auf die Gewalttat durchaus dem typischen Handlungsmuster eines Vergewaltigungsopfers. Unklar ist, ob das an die Öffentlichkeit gerichtete Schreien Tamars als ebenso typisch gelten kann: Während Else Michaelis-Arntzen einen starken Mitteilungsdrang als viktimotypisch angibt 95, stuft Kurt Weis das Bedürfnis des Opfers, unmittelbar nach der Tat über die Vergewaltigung zu sprechen, als im Gegensatz zu anderen Straftaten gering ein 96.
3.1.3 Physische und psychische Folgen sexueller Gewalt
Jede Vergewaltigung bewirkt beim Opfer eine schwere Traumatisierung und vielfältige psychische Verletzungen 97. Das gewalttätige Eindringen in den Körper, wie es bei einer Vergewaltigung geschieht, ist laut Müllner der schwerste denkbare Angriff auf das intime Selbst und die Würde des Menschen; das psychische Syndrom der Überlebenden von Vergewaltigungen ist im Wesentlichen dasselbe wie das Syndrom von Kriegsüberlebenden 98.
Indem Petra Heilig Vergewaltigungsopfer als psychisch und physisch “verwüstet, zerrissen, zerfleischt” 99 bezeichnet, weist sie darauf hin, dass auch Tamar infolge ihrer Vergewaltigung an einer schweren posttraumatischen Störung leidet: Das Zerreißen des Gewandes als Ausdruck der innerlichen Zerrissenheit Tamars sowie ihr “Verdorren” (V. 20) weisen darauf hin.
3.2 Der Täter
3.2.1 Sexuelle Gewalt in der Verwandtschaft und im sozialen Nahbereich
Frauen sind vor allem im sozialen Nahbereich gefährdet 100.. Etwa 71 % der Täter von Vergewaltigungen stammen aus dem sozialen Nahfeld (Freunde, Verwandte und Bekannte) des Opfers 101. Dabei ist vor allem die familiale Gewalt ein sehr häufig auftretendes Phänomen 102.
Die Vergewaltigung Tamars durch ihren Halbbruder Amnon entspricht der These, dass sexuelle Straftaten oftmals im familiären Bereich stattfinden. Auch in anderen biblischen Texten des Alten Testaments werden Gewalttaten von Männern an Frauen im privaten Bereich erzählt (z.B. in Ri 19; Ri 11,30-40; Ex 21,22) 103.
3.2.2 Psychologie des Täters: Ursachen und Motive
Es wurde bereits festgestellt, dass die Frage nach dem Motiv Amnons für die Vergewaltigung und das anschließende Verstoßen seiner Halbschwester schwer zu klären ist (siehe Kapitel 2.3.3). Verschiedene Ansätze lassen sich mit heutigen Erkenntnissen der Täterforschung untermauern.
Zunächst kann die Vergewaltigung schlicht als eine Reaktion auf die Verweigerung Tamars betrachtet werden. Empirische Untersuchungen belegen bei Männern eine hohe Bereitschaft Gewalt einzusetzen, wenn eine Frau auf das sexuelle Bedürfnis des Mannes nicht reagiert 104.
Ein Faktor, der die Gefahr des sexuellen Missbrauchs in der Familie vergrößert, ist ein allgemeines Gewaltklima in der Familie 105. Allerdings ist ein solcher familiärer Einfluss nicht als primäre Ursache, sondern als ein die Tatwahrscheinlichkeit begünstigendes Element zu betrachten. Die These Drewermanns, wonach die Vergewaltigung direkt auf den Ehebruch von Amnons Vater in Zusammenhang mit dem Mord an dessen Rivalen zurückzuführen ist, wird demnach nur in Ansätzen gestützt, aber nicht belegt.
Durch die feministische Theorie am besten belegt ist die These von der Vergewaltigung als Machtausübung. Der Feminismus unterscheidet strikt zwischen Sexualität und sexueller Gewalt 106. Letztere ist zurückzuführen auf das Bedürfnis des Mannes, Macht und Herrschaft zu demonstrieren 107. Sie dient der Erhaltung männlicher Privilegien und hat mit Lust im herkömmlichen Sinne nichts zu tun 108. “Es geht nicht um Sex, sondern um Macht”, so Alice Schwarzer 109. - Kritisiert wird diese These u.a. von Ellis, der aufgrund empirischer Untersuchungen zu dem Ergebnis kommt, dass Sexualität statt Dominanz in den meisten Fällen das Motiv für eine Vergewaltigung ist 110. Müllner schwächt die strikte Entsexualisierung sexueller Gewalt ab, indem sie darauf hinweist, dass das Streben nach Macht und Herrschaft häufig mit Sexualität verknüpft wird 111. Dies belegt die These, dass Amnon den sexuellen Akt als Angriff auf den königlichen Herrschaftsbereich versteht, während eine strikte Trennung von Sexualität und sexueller Gewalt zunächst nur ein Beleg dafür wäre, dass Amnon mit der Vergewaltigung Macht über Tamar und nicht über David demonstrieren will.
3.2.3 Täterstrategien
Ein entscheidendes Merkmal des sexuellen Missbrauchs ist die Absicht des Täters, gezielt und planvoll Situationen zu schaffen, die den sexuellen Verkehr mit dem Opfer ermöglichen 112. Täterstrategien, die ein solches Ziel verfolgen, richten sich nach außen, um ein Eingreifen zu verhindern, gegen das Opfer, um es gefügig und wehrlos zu machen, sowie bei der Vergewaltigung Minderjähriger gegen verwandtschaftliche Bezugspersonen, um diese zu täuschen und zur Duldung des Missbrauchs zu bewegen 113. Die Vorkehrungsmechanismen des Täters finden sich auch bei Amnon wieder: Der Königssohn schickt seine Diener aus dem Zimmer, damit keine Zeugen bei der Tat anwesend sind (Täterstrategie nach außen). Er wendet gegen Tamar ein Täuschungsmanöver an, indem er sie bittet, ihm die Krankenspeise zu reichen, versucht sein Opfer anschließend zum Geschlechtsverkehr zu überreden und wendet zuletzt Gewalt an (Täterstrategien gegen das Opfer). Schließlich bezieht Amnon seinen Vater in die Tat mit ein, indem er David bittet, Tamar in sein Haus zu schicken. Unabhängig davon, ob er den nichtsahnenden König täuscht oder David den von Amnon geplanten Verkehr mit dessen Halbschwester duldet, handelt es sich hierbei um eine Täterstrategie Amnons gegen eine verwandtschaftliche Bezugsperson des Opfers.
3.2.4 Fehlende Schuldeinsicht des Täters
Amnon zeigt in seinem Tun keinerlei Anzeichen von Schuldbewusstsein und Reue. Durch sein Handeln signalisiert er Tamar, sie habe Schuld an der Vergewaltigung, und bestraft sie dafür, indem er sie verstößt 114. Sowohl diese Denkweise Amnons, nicht er, sondern Tamar, ihr Körper und ihre Schönheit seien Schuld an der Vergewaltigung, als auch der Hass auf seine Halbschwester entsprechen dem für Sexualtäter typischen Muster des “blaming the victim” (wörtlich: das Opfer beschuldigen): Der Täter projiziert seinen Selbsthass und seine Schuld auf die vergewaltigte Frau und entgeht somit der Konfrontation mit dem Opfer und damit auch mit sich selbst und der eigenen Schuld 115.
3.3 Die Gesellschaft
3.3.1 Soziale Folgen sexueller Gewalt für das Opfer
Sexuelle Gewalt wird in den biblischen Schriften weniger unter dem Blickwinkel physischer und psychischer Folgen für das Opfer, sondern eher unter sozialem Aspekt betrachtet: Vergewaltigung ist kein Vergehen gegen die Frau als Individuum, sondern gegen die soziale Ordnung. Tamar wird in erster Linie dadurch zum Opfer, dass der an ihr verübte sexuelle Akt sozial nicht abgesichert ist 116. Die Königstochter fällt somit aus ihrer Normalbiografie heraus, die eigentlich durch entsprechende Gesetze geschützt sein sollte 117. Sie lebt als Folge der Tat “einsam, im Hause ihres Bruders” (V. 20). Dies entspricht nach Heilig auch den Erfahrungen heutiger Vergewaltigungsopfer: Sexuelle Gewalt hat oftmals soziale Isolation und Beziehungslosigkeit der betroffenen Frauen und Mädchen zur Folge. Orte und Instanzen, an die sie sich wenden können, existieren heute infolge der praktischen Bemühungen der feministischen Bewegung im Gegensatz zur Zeit Tamars (“Und ich, wohin soll ich meine Schmähung tragen?”, V. 13), werden jedoch zum einen von den Betroffenen selten wahrgenommen um erfahren zum anderen kaum die Anerkennung und Unterstützung der Öffentlichkeit 118.
Die Ursache hierfür liegt in dem Phänomen des “blaming the victim”, das nicht nur beim Täter (siehe Kapitel 3.2.4), sondern ebenso in Bezug auf die Einstellung der Gesellschaft beobachtet werden kann. Den Opfern sexuellen Missbrauchs wird eine Mitschuld oder gar Schuld am Verbrechen zugeschrieben, da der Täter seinem durch die Frau geweckten Trieb erlegen und somit für die Vergewaltigung nicht oder nur bedingt verantwortlich sei 119. Der Frau wird unterstellt, den Täter absichtlich provoziert oder den verdrängten Wunsch gespürt zu haben, vergewaltigt zu werden 120. Solche opferfeindlichen Vorstellungen treten bewusst oder unbewusst sowie in offener oder verdeckter Form bei der allgemeinen und institutionellen Reaktion (Polizei, Gerichte, Medien, Filme u.a.) auf und sind in der Bevölkerung noch immer verbreitet 121. - Das Phänomen des “blaming the victim” zeigt sich auch in der sozialen Isolation Tamars, die letztendlich darin begründet liegt, dass in der patriarchalen Gesellschaft des frühen Israels Frauen die Verantwortung für den Erhalt ihres sozialen Werts trugen und ihnen demnach eine Mitschuld für dessen Minderung zugeschrieben wurde.
3.3.2 Überleben mit dem Täter
Das Angebot Tamars an Amnon, ihren Vater um Heirat zu bitten und somit den sexuellen Akt in einer Tamar nicht entwürdigenden Situation vollziehen zu können, kann zum einen mit der von Michaelis-Arntzen als “nicht viktimountypischer” Verhaltensweise von Vergewaltigungsopfern verglichen werden, dem Täter das Angebot zu unterbreiten, an einem anderen Tag in einer anderen Situation mit ihm zu schlafen 122. Zum anderen jedoch weist Tamars Vorschlag auf das gesellschaftliche Phänomen hin, dass “das Überleben von Mädchen und Frauen im Patriarchat immer ein Überleben mit dem Täter ist.” 123
Exkurs: J.M. Coetzee “Schande”
Das Überleben mit dem Täter in einer patriarchalen Gesellschaft ist auch ein Motiv des 1999 erschienenen Romans “Schande”. Die Erzählung des südafrikanischen Nobelpreisträgers J.M. Coetzee handelt von einem Kapstädter Literaturprofessor, dessen Tochter Lucy auf einer Farm von mehreren schwarzen Männern überfallen und von einem von ihnen vergewaltigt wird. Die junge Frau wird infolge der Tat schwanger. Trotz des erbitterten Drängens ihres Vaters weigert sich Lucy, ihre Farm zu verlassen, obwohl zu befürchten ist, dass die Täter sie erneut heimsuchen werden. Sie sieht die Vergewaltigung als einen Preis an, den sie zahlen muss, um als weiße Frau in einem von schwarzen Männern beherrschten Landstrich leben zu dürfen: “Ich denke, dass ich in ihrem Territorium bin. Sie haben mich gekennzeichnet. Sie werden wieder zu mir kommen. [...] Wenn das nun der Preis ist, den man dafür zahlen muß, um bleiben zu dürfen? Vielleicht sehen sie das so; vielleicht sollte ich das auch so sehen. Sie glauben, daß ich ihnen etwas schulde.” 124 Lucy beschließt, ihren Nachbarn, den Cousin des Vergewaltigers, zu heiraten, damit er das Kind versorgen und ihr Schutz bieten kann. Wie Tamar, die eine Heirat mit ihrem Halbbruder in Erwägung zieht, um den drohenden sozialen Konsequenzen einer Vergewaltigung zu entgehen, fügt sich Lucy den Gesetzen der patriarchalen Gesellschaft, in der sie lebt.
3.3.3 Verharmlosung und Tabuisierung sexueller Gewalt
Abschaloms Reaktion auf das Verbrechen an seiner Schwester sowie die fehlende Intervention Davids entsprechen dem Umgang mit sexueller Gewalt in Familie, Gesellschaft und Kirche heute. Noch immer ist die Rede von Missbrauch und Vergewaltigung mit dem Verharmlosen (“Nimm dir diese Sache nicht zu Herzen”, V. 20) und Tabuisieren (“Und nun, meine Schwester, schweig!”, V. 20) der Tat und der Erfahrung des Opfers verbunden.
So können in den Familien, in denen es zu sexuellem Missbrauch kommt, in den meisten Fällen typische Verhaltensmuster beobachtet werden, die mit denen Abschaloms “annähernd deckungsgleich” sind 125. Das Opfer wird zum Schweigen aufgefordert, um sowohl das familiäre Klima als auch das Ansehen der Familie nach außen nicht zu gefährden. Die Gewaltanwendung wird verharmlost; das Opfer wird dazu gedrängt, die Tat zu vergessen 126.
Die Tabuisierung und Verharmlosung sexueller Gewalt ist ebenso ein gesellschaftliches Phänomen. “Was in patriarchalen Gesellschaften als Gewalt anerkannt und strafrechtlich sanktioniert wird, ist nicht identisch mit dem, was Frauen als Gewalt erleben und empfinden” 127, so Claudia Rakel. Infolgedessen reagieren Institutionen oft unangemessen auf Missbrauchsfälle, indem sie nicht ausreichend intervenieren, um das Opfer zu schützen und den Täter zu strafen 128.
Auch innerhalb der Kirche gibt es nach Meinung von Heilig und Hannappel keinen Ort für von sexueller Gewalt betroffene Frauen und Mädchen, in denen sie ihre Erfahrungen aussprechen und mit ihnen - auch in Bezug auf ihre durch die Tat in welcher Weise auch immer veränderte Gottesbeziehung - umgehen können. Gewalt wird in Gottesdiensten als individuelles Schicksal benannt, ohne auf die Gründe einzugehen, die nach Ansicht der feministischen Theorie in den patriarchalen Machtverhältnissen der Gesellschaft liegen 129.
Die Folge der Verharmlosung und Tabuisierung sexueller Gewalt in Familie, Gesellschaft und Kirche ist eine von Kriminologen als im Vergleich zu anderen Straftaten überdurchschnittlich hoch eingeschätzte Dunkelziffer 130.
3.3.4 Täterfokussierte Berichterstattung
Es wurde festgestellt, dass durch die Einfühlung des Erzählers in den Täter dieser im Gegensatz zu seiner Halbschwester eindeutig bevorzugt wird und sich die LeserInnen somit eher mit Amnon identifizieren (siehe Kapitel 2.5). Unabhängig davon wie dieses Phänomen zu bewerten ist (führt die Identifikation schließlich zu einer durchaus heilsamen Spiegelung vor allem beim männlichen Leser), entspricht es doch der Täterfokussierung sowohl in der Medienberichterstattung als auch in der kriminalhistorischen Sachliteratur. Den psychischen und sozialen Gesichtspunkten, die zu einem Verbrechen führen, wird hier in der Regel größere Aufmerksamkeit geschenkt als den Gefühlen des Opfers.
4. Zusammenfassung
Ziel der vorliegenden Arbeit war es herauszufinden, ob das Schicksal Tamars stellvertretend für das heutiger Vergewaltigungsopfer steht. Diesbezüglich ist festzustellen, dass die in der Erzählung von Tamar und Amnon erkannten Mechanismen personaler und struktureller Gewalt im Wesentlichen mit denen gegenwärtiger Formen des sexuellen Missbrauchs übereinstimmen:
1. Die Vergewaltigung Tamars findet im sozialen Nahbereich, genauer in der Familie des Opfers, statt.
2. Amnon wendet wie die meisten Vergewaltiger gezielt Strategien an, um die Gewalttat zu ermöglichen. Sie richten sich nach außen, gegen das Opfer und gegen verwandtschaftliche Bezugspersonen.
3. Der Vorschlag Tamars an Amnon, David um die Möglichkeit der Heirat zu bitten, zeigt, dass das Überleben von Opfern sexueller Gewalt immer ein Überleben mit dem Täter ist.
4. Der aktive Widerstand des Opfers ist abhängig von der sozialen Stellung des Täters. Tamar leistet nur verbalen Widerstand, was sowohl auf die Position Amnons als Thronfolger als auch auf die im patriarchalen Israel höhere Stellung als Mann zurückzuführen ist.
5. Während der Erzähler den LeserInnen einen tiefgehenden Einblick in die Gefühle Amnons gewährt, werden die Emotionen vor allem des Opfers kaum kommuniziert. Dies gleicht der täterfokussierten Berichterstattung in den Medien bei Fällen sexueller Gewalt.
6. Amnon fehlt als Täter die Einsicht in seine Schuld. Er weist stattdessen Tamar die Verantwortung für die Tat zu und bestraft sie mit seinem Hass, wodurch sein Verhalten dem in der Kriminologie als “blaming the victim” bezeichneten Muster entspricht.
7. Tamars Reaktion auf die an ihr begangene Vergewaltigung kann als eindeutig viktimotypisches Nach-Tat-Verhalten bezeichnet werden.
8. Die Vergewaltigung bewirkt bei Tamar wie bei allen Opfern sexueller Gewalt schwerwiegende physische, vor allem aber psychische Folgen.
9. Die Vergewaltigung hat für Tamar wie auch für heutige Opfer sexueller Gewalt schwerwiegende soziale Folgen: Sie wird in der Gesellschaft und in ihrer Familie isoliert und muss mit den gesellschaftlichen Schuldzuweisungen umgehen.
10. Die Verharmlosung der Vergewaltigung durch Tamars Bruder Abschalom entspricht dem Umgang der Gesellschaft und der Familie des Opfers mit sexueller Gewalt heute.
Die Ergebnisse der modernen Täterforschung können auch auf das Motiv Amnons angewandt werden:
1. Wird die Vergewaltigung Tamars als Reaktion auf die vorhergehende Verweigerung des Geschlechtsverkehrs betrachtet, lässt sich dies mit der empirisch nachgewiesenen hohen Bereitschaft eines Mannes belegen, Gewalt anzuwenden, wenn eine Frau auf das sexuelle Bedürfnis des Mannes nicht reagiert.
2. Die vor allem von Drewermann vertretene These, die Vergewaltigung sei auf eine kindheitsbedingte Neurose Amnons zurückzuführen, wird in Ansätzen durch die Tatsache gestützt, dass sich ein allgemeines Gewaltklima in der Familie des Täters begünstigend für die Tat auswirkt. Drewermanns Ansicht, die Vergewaltigung liege einzig in der ungünstigen Kindheit Amnons begründet, lässt sich jedoch nicht anhand täterpsychologischer Erkenntnisse belegen.
3. Die vor allem in der feministischen Täterforschung verbreitete Ansicht, sexuelle Gewalt habe mit Sexualität nichts zu tun, sondern sei allein auf das männliche Bedürfnis nach Machtausübung zurückzuführen, lässt für die Tat Amnons zwei Schlüsse zu:
a) Amnon will mit der Vergewaltigung Macht über Tamar als Sexualobjekt ausüben.
b) Amnon will mit der Vergewaltigung in den Machtbereich seines Vaters David eindringen, dessen Thronnachfolger er ist. Die Tat ist demnach allein ein herrschaftspolitisches Instrument.
Der Gedanke der feministischen ExegetInnen, das Motiv allein auf das Bedürfnis Amnons nach Machtausübung zu beschränken, muss sich jedoch die Kritik gefallen lassen, am Bibeltext vorbei zu deuten, der die Liebe Amnons zu Tamar als existent ansieht.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die feministische Exegese in Bezug auf die Erzählung von Tamar und Amnon den Blick öffnet für eine Betrachtung des sexuellen Gewaltakts als solchen, anstatt den Text einzig als Element der den Machtkampf um die Nachfolge Davids beschreibenden Thronfolgegeschichte zu interpretieren. Die Ergebnisse kriminologischer und feministisch-soziologischer Forschung helfen dabei, Parallelen zur Situation heutiger Vergewaltigungsopfer zu ziehen, wodurch eine praxisrelevantere Auslegung der Erzählung ermöglicht wird.
Übersetzungen (2 Sam 13,1-22)
Anhang
Literaturverzeichnis
Bibelübersetzungen
Buber-Rosenzweig: Martin Buber, Franz Rosenzweig: Bücher der Geschichte. Köln, Olten: Hegner, 1955
Elberfelder: Die Bibel. Elberfelder Übersetzung, revidierte Fassung. Wuppertal: Brockhaus, 20039
Luther: Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach der Übersetzung Martin Luthers. Revidierter Text 1964. Berlin, Altenburg: Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft, 1983³
Müllner: Ilse Müllner: Übersetzung von 2 Sam 13,1-22. In: dies. (1997), a.a.O., S. 418-420
Steurer: Rita Maria Steurer: Das Alte Testament. Interlinearübersetzung Hebräisch - Deutsch und Transkription des hebräischen Grundtextes nach der Biblia Hebraica Stuttgartensia 1986. Band 2: Josua - Könige. Neuhausen, Stuttgart: Hänssler, 1989
Sekundärliteratur
Breiter, Marion: Vergewaltigung. Ein Verbrechen ohne Folgen? Wien: Verlag für Gesellschaftskritik, 1995
Coetzee, J.M.: Schande. Roman. Frankfurt am Main: Fischer, 2003³
Dietrich, Walter, Thomas Naumann: Die Samuelbücher. (= Erträge der Forschung, Bd. 287). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1995
Drewermann, Eugen: Dann aber faßte Amnon einen tiefen Widerwillen gegen sie. In: ders.: Das Königreich Gottes in unserer Seele. Predigten über die Bücher Samuel und Könige. Hrsg. von Bernd Marz. München, Zürich: Piper, 1996. S. 256-275
Eckmeier, Andrea: Und immer wieder neu: Der Gewalt gegen Frauen widerstehen. Eine Herausforderung für Theologie und Ethik. In: Ulrike Eichler, Ilse Müllner (Hrsg.): Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Frauen als Thema der feministischen Theologie. Gütersloh: Kaiser, 1999. S. 214-242
Ellis, Lee: Theories of Rape. Inquiries into the Causes of Sexual Aggression. New York, Washington, Philadelphia, London: Taylor and Francis, 1989
Gravett, Sandie: Reading ”Rape” in the Hebrew Bible. A Consideration of Language. In: Journal for the Study of the Old Testament, Jg. 28 (2004), Nr. 3. S. 279-299
Hannappel, Astrid: ”Schweig still - nimm dir die Sache nicht so zu Herzen.” Die alltäglichen Gewalterfahrungen von Frauen und ihre Konsequenzen für die liturgische Praxis. In: Ulrike Eichler, Ilse Müllner (Hrsg.): Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Frauen als Thema der feministischen Theologie. Gütersloh: Kaiser, 1999. S. 169-213
Hausmann, Jutta: Feministische Exegese. In: Siegfried Kreuzer, Dieter Vieweger, dies., Wilhelm Pratscher (Hrsg.): Proseminar I Altes Testament. Ein Arbeitsbuch. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer, 1999. S. 169-177
Heilig, Petra: ”Und ich, wohin sollte ich meine Schande tragen?” Tamar (2 Samuel 13). In: Angelika Meissner (Hrsg.): Und sie tanzen aus der Reihe. Frauen im Alten Testament. (= Stuttgarter Taschenbücher, Bd. 10). Stuttgart: Katholisches Bibelwerk, 1992. S. 129-144
Heiliger, Anita: Täterstrategien und Prävention. Sexueller Mißbrauch an Mädchen innerhalb familialer und familienähnlicher Strukturen. München: Frauenoffensive, 2000
Heiliger, Anita, Constanze Engelfried: Sexuelle Gewalt. Männliche Sozialisation und potentielle Täterschaft. Frankfurt, New York. Campus, 1995
Hentschel, Georg: 2 Samuel. (= Die neue Echter Bibel. Kommentar zum Alten Testament mit der Einheitsübersetzung, Bd. 34). Würzburg: Echter, 1994
Hiemke, Michi: Der Ehebruch Davids und Batsebas. Theologische und sozialgeschichtliche Studie des elften und zwölften Kapitels im zweiten Buch Samuel im Hinblick auf das Phänomen des Ehebruchs auch in unserer Zeit. Dresden: Unveröffentl. Hausarbeit, 2005
Jahnow, Hedwig: Die Frau im Alten Testament. In: dies. (u.a.): Feministische Hermeneutik und Erstes Testament. Analysen und Interpretationen. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer, 1994. S. 30-47
Jung, Lisa: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Frauen. Ein Thema für Theologie und Kirche. In: Ulrike Eichler, Ilse Müllner (Hrsg.): Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Frauen als Thema der feministischen Theologie. Gütersloh: Kaiser, 1999. S. 13-39
Kratz, Reinhard G.: Redaktion und Tradition in Samuel und Könige. In: ders.: Die Komposition der erzählenden Bücher des Alten Testaments. Grundwissen der Bibelkritik. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2000. S. 161-193
Kunz, Andreas: Die Frauen und der König David. Studien zur Figuration von Frauen in den Daviderzählungen. (= Arbeiten zur Bibel und ihrer Geschichte, Bd. 8). Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2004
Lescow, Theodor: Die Komposition der Tamar-Erzählung II Sam 13, 1-22. In: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, Jg. 114 (2002), Nr. 1. S. 110-111
Michaelis-Arntzen, Else: Die Vergewaltigung aus kriminologischer, viktimologischer und aussagepsychologischer Sicht. München: Beck, 1994²
Müllner, Ilse: Gewalt im Hause Davids. Die Erzählung von Tamar und Amnon (2 Sam 13,1-22). (= Herders Biblische Studien, Bd. 13). Freiburg, Basel, Wien, Barcelona, Rom, New York: Herder, 1997
Müllner, Ilse: Die Samuelbücher. Frauen im Zentrum der Geschichte Israels. In: Luise Schottroff, Marie-Theres Wacker (Hrsg.): Kompendium Feministische Bibelauslegung. Gütersloh: Kaiser, Gütersloher Verlagshaus, 1998. S. 114-129
Müllner, Ilse: Sexuelle Gewalt im Alten Testament. In: Ulrike Eichler, dies. (Hrsg.): Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Frauen als Thema der feministischen Theologie. Gütersloh: Kaiser, 1999. S. 40-75
Navè Levinson, Pnina: Was wurde aus Saras Töchtern? Frauen im Judentum. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1993³
Rakel, Claudia: Glossar feministischer Grundbegriffe. In: Irene Leicht, dies., Stefanie Rieger-Goertz: Arbeitsbuch Feministische Theologie. Inhalte, Methoden und Materialien für Hochschule, Erwachsenenbildung und Gemeinde (CD-ROM). Gütersloh: Kaiser, Gütersloher Verlagshaus, 2003
Rakel, Claudia: Macht und Gewalt. In: Irene Leicht, dies., Stefanie Rieger-Goertz: Arbeitsbuch Feministische Theologie. Inhalte, Methoden und Materialien für Hochschule, Erwachsenenbildung und Gemeinde. Gütersloh: Kaiser, Gütersloher Verlagshaus, 2003a. S. 263-282
Rentmeister, Cillie: Grenzen setzen! Zehn Hinweise aus feministisch-kulturanthropologischer Sicht. In: Marion Mebes (Hrsg.): Mühsam - aber nicht unmöglich. Reader gegen sexuellen Mißbrauch. Berlin: Donna Vita, 1992. S. 90-101
Schroer, Silvia: Die Samuelbücher. (= Neuer Stuttgarter Kommentar Altes Testament, Bd. 7). Stuttgart: Katholisches Bibelwerk, 1992
Schroer, Silvia: Auf dem Weg zu einer feministischen Rekonstruktion der Geschichte Israels. In: Luise Schottroff, dies., Marie-Theres Wacker: Feministische Exegese. Forschungserträge zur Bibel aus der Perspektive von Frauen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1995. S. 81-172
Steffen, Wiebke: Gewalt von Männern gegenüber Frauen. Befunde und Vorschläge zum polizeilichen Umgang mit weiblichen Opfern von Gewalttaten. München: Bayerisches Landeskriminalamt, 1987
Stoebe, Hans Joachim: Das zweite Buch Samuelis. (= Kommentar zum Alten Testament, Bd. 8,2). Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1994
Wacker, Marie-Theres: Geschichtliche, hermeneutische und methodologische Grundlagen. In: Luise Schottroff, Silvia Schroer, dies.: Feministische Exegese. Forschungserträge zur Bibel aus der Perspektive von Frauen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1995. S. 81-172
Wacker, Marie Theres, Elisabeth Hartlieb: Bibelauslegung. In: Irene Leicht, Claudia Rakel, Stefanie Rieger-Goertz: Arbeitsbuch Feministische Theologie. Inhalte, Methoden und Materialien für Hochschule, Erwachsenenbildung und Gemeinde. Gütersloh: Kaiser, Gütersloher Verlagshaus, 2003. S. 109-131
Weis, Kurt: Die Vergewaltigung und ihre Opfer. Eine viktimologische Untersuchung zur Gesellschaft. Bewertung und individuelle Betroffenheit. Stuttgart: Enke, 1982
[...]
1 Vgl. Hannappel (1999), S. 197
2 Vgl. Schroer (1995), S. 156
3 Vgl. Wacker, Hartlieb (2003), S. 109ff
4 Zit. nach Rakel (2003a), S. 1
5 Vgl. Hausmann (1999), S. 171ff; Wacker (1995), S. 35ff
6 Vgl. Schroer (1992), S. 11
7 Vgl. Müllner (1998), S. 121
8 Vgl. Schroer (1992), S. 15
9 Vgl. Kunz (2004), S. 300
10 Vgl. Kratz (2000), S. 180
11 Vgl. Stoebe (1994), S. 323
12 Vgl. Kunz (2004), S. 300
13 Vgl. Schroer (1995), S. 152
14 Vgl. Kratz (2000), S. 192
15 Vgl. Müllner (1997), S. 143ff
16 Vgl. Lescow (2002), S. 110f
17 Vgl. Müllner (1997), S. 150
18 Vgl. Heilig (1992), S. 143
19 Vgl. Müllner (1997), S. 159
20 Die szenische Einteilung folgt der Gliederung von Ilse Müllner (siehe 2.2).
21 Vgl. Müllner (1997), S. 153f
22 Vgl. Heilig (1992), S. 131
23 Vgl. Schroer (1992), S. 171
24 Vgl. Müllner (1998), S. 121
25 Vgl. dies. (1997), S. 199
26 Vgl. ebd., S. 206
27 Vgl. Dietrich, Naumann (1995), S. 259
28 Vgl. Kunz (2004), S. 306
29 Vgl. Müllner (1999), S. 54
30 Vgl. Hentschel (1994), S. 55
31 Vgl. Kunz (2004), S. 303
32 Vgl. Müllner (1997), S. 196
33 Vgl. ebd., S. 200
34 Vgl. Stoebe (1994), S. 326; Kunz (2004), S. 303
35 Vgl. Kunz (2004), S. 303
36 Vgl. Hentschel (1994), S. 55; Müllner (1998), S. 122
37 Vgl. Müllner (1997), S. 218f
38 Vgl. ebd., S. 218f ; dies. (1998), S. 122
39 Vgl. Heilig (1992), S. 131
40 Vgl. ebd., S. 132
41 Vgl. Müllner (1998), S. 122; dies. (1999), S. 68
42 Vgl. Gravett (2004), S. 281
43 Vgl. Müllner (1997), S. 270
44 Vgl. Dietrich, Naumann (1995), S. 258
45 Vgl. Jahnow (1994), S. 47
46 Vgl. Hannappel (1999), S. 198f
47 Vgl. Heilig (1992), S. 132
48 Vgl. Müllner (1997), S. 347
49 Vgl. ebd., S. 294ff; dies. (1999), S. 46f
50 Vgl. Müllner (1997), S. 361ff; dies. (1999), S. 71f
51 Müllner (1997), S. 382
52 Drewermann (1996), S. 267
53 ebd., S. 267
54 ebd., S. 270
55 ebd., S. 273
56 Vgl. Müllner (1997), S. 298
57 Vgl. Heilig (1992), S. 134
58 Vgl. Müllner (1997), S. 298. Die meisten Übersetzungen schließen durch die Verwendung des Plusquamperfekts “geliebt hatte” (Elberfelder, Buber-Rosenzweig) oder des Wortes “vorher gehaßt” (Luther) diese Interpretationsmöglichkeit aus.
59 Vgl. Heilig (1992), S. 134 ; Hannappel (1999), S. 200
60 Vgl. Müllner (1997), S. 306f ; Heilig (1992), S. 134f
61 Vgl. Müllner (1997), S. 321. Dietrich und Naumann weisen an dieser Stelle auf die Behauptung Hendlmeiers hin, die Tatsache, dass Abschalom von der Vergewaltigung bereits weiß, ohne dass Tamar ihm davon erzählt hat, zeige, dass Abschalom Jonadab als Ratgeber Amnons instruiert habe, um den Thronfolger in Unannehmlichkeiten zu bringen und dessen Beseitigung zu ermöglichen [vgl. Dietrich, Naumann (1995), S. 262]. Die These ist zurückzuweisen, da das Zerreißen des Kleides und die Tatsache, dass Tamar im Hause Amnons war, für Abschalom keinen anderen Schluss zulassen, als dass seine Schwester vergewaltigt wurde.
62 Vgl. Hannappel (1999), S. 202; Müllner (1997), S. 319ff
63 Vgl. Müllner (1997), S. 154
64 ebd., S. 323
65 Vgl. Hannappel (1999), S. 204
66 Müllner (1997), S. 325
67 Vgl. Heilig (1992), S. 135
68 Vgl. Dietrich, Naumann (1995), S. 260
69 Vgl. Stoebe (1994), S. 327
70 Vgl. Navè Levinson (1993³), S. 134
71 Vgl. Jahnow (1994), S. 30f
72 Vgl. Hannappel (1999), S. 204
73 Vgl. Müllner (1999), S. 68
74 Vgl. Dietrich, Naumann (1995), S. 261f; Müllner (1997), S. 329f
75 Vgl. Hannappel (1999), S. 203
76 Vgl. Müllner (1997), S. 330ff
77 Vgl. ebd., S. 334
78 Vgl. Jung (1999), S. 29
79 Vgl. Müllner (1997), S. 334
80 Vgl. Heilig (1992), S. 130
81 Vgl. Müllner (1997), S. 333
82 Vgl. ebd., S. 165 u. 383
83 Vgl. Müllner (1999), S. 73ff
84 Vgl. Heilig (1992), S. 129f
85 Vgl. Müllner (1998), S. 120ff
86 Vgl. Kunz (2004), S. 307ff ; Müllner (1999), S. 67
87 Müllner (1999), S. 67
88 Vgl. Kunz (2004), S. 302f
89 Eine Zusammenfassung der verschiedenen exegetischen Sichtweisen auf den Ehebruch findet sich bei Hiemke (2005), S. 19ff.
90 Hannappel (1999), S. 198
91 Heilig (1992), S. 129
92 Vgl. Müllner (1997), S. 334
93 Vgl. Michaelis-Arntzen (1994²), S. 30
94 Vgl. Hannappel (1999), S. 200
95 Vgl. Michaelis-Arntzen (1994²), S. 30
96 Vgl. Weis (1982), S. 119ff
97 Vgl. Breiter (1995), S. 105
98 Vgl. Müllner (1997), S. 12
99 Heilig (1992), S. 137
100 Vgl. Steffen (1987), S. 6f
101 Vgl. Eckmeier (1999), S. 226
102 Vgl. Steffen (1987), S. 2
103 Vgl. Schroer (1995), S. 152
104 Vgl. Heiliger, Engelfried (1995), S. 82
105 Vgl. Heiliger (2000), S. 160
106 Vgl. Müllner (1997), S. 357
107 Vgl. Eckmeier (1999), S. 228
108 Vgl. Rentmeister (1992), S. 92
109 Zit. nach Müllner (1997), S. 357
110 Vgl. Ellis (1989), S. 21f
111 Vgl. Müllner (1997), S. 358ff
112 Vgl. Heiliger, Engelfried (1995), S. 23
113 Vgl. Heiliger (1992), S. 159
114 Vgl. Hannappel (1999), S. 200
115 Vgl. Heilig (1992), S. 134
116 Vgl. Müllner (1997), S. 311
117 Vgl. Müllner (1999), S. 48f
118 Vgl. Heilig (1992), S. 137ff
119 Vgl. Müllner (1997), S. 342
120 Vgl. Steffen (1987), S. 18
121 Vgl. ebd., S. 8
122 Vgl. Michaelis-Arntzen (1994²), S. 33
123 Heilig (1992), S. 133
124 Coetzee (2003³), S. 206
125 Hannappel (1999), S. 203
126 Vgl. ebd., S. 202f
127 Rakel (2003b), S. 266
128 Vgl. Heiliger (2000), S. 30
129 Vgl. Heilig (1992), S. 139 ; Hannappel (1999), S. 173
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt der Erzählung von Amnon und Tamar (2 Sam 13,1-22)?
Die Erzählung handelt von Tamar, der Tochter König Davids, die von ihrem Halbbruder Amnon unter einem Vorwand in sein Zimmer gelockt und dort vergewaltigt wird. Die Erzählung beleuchtet die Folgen der Tat für Tamar, Amnon und die Gesellschaft.
Wie ist die Erzählung von Amnon und Tamar in die Samuelbücher und die Jerusalemer Hofgeschichte eingeordnet?
Die Erzählung ist Teil der Samuelbücher und der Jerusalemer Hofgeschichte, die die Auseinandersetzung um die königliche Macht beschreibt. Sie ist im Erzählganzen der Davidgeschichte nur wenig verankert, bereitet jedoch auf den Tod Amnons als ersten Thronfolger vor. Die Erzählung verdeutlicht den Grund Abschaloms, Amnon umzubringen, jedoch soll Tamar die Hauptperson und der Zielpunkt der Anteilnahme des Erzählers sein.
Welche Struktur und Gliederung hat die Erzählung von Amnon und Tamar?
Die Erzählung wird oft als konzentrisch strukturiert betrachtet, mit der Handlung in Amnons Bett im Zentrum. Alternativ wird eine kettenförmige Konstruktion gesehen, wobei die handelnden Personen die einzelnen Teilabschnitte verbindenden Glieder darstellen. Ortswechsel, insbesondere das Motiv des Hauses, haben eine gliedernde Funktion.
Was sind die Schlüsselszenen der Erzählung von Amnon und Tamar und welche Bedeutung haben sie?
Die Erzählung lässt sich in fünf Szenen einteilen:
- Szene I (Exposition): Einführung der handelnden Personen und des Konflikts.
- Szene II (Vorgänge in Amnons Haus): Amnons Plan und Tamars Zubereitung der Krankenkost.
- Szene III (Ereignisse in Amnons Kammer): Die Vergewaltigung Tamars.
- Szene IV (Geschehnisse außerhalb des Hauses): Tamars Reaktion und Abschaloms Intervention.
- Szene V (Coda): Tamars Zustand und die Reaktionen Davids und Abschaloms.
Welche Rolle spielt Tamar in der Erzählung?
Tamar ist das Opfer der Vergewaltigung und steht im Mittelpunkt der Erzählung. Ihre Reaktion auf die Tat, ihr Widerstand (wenn auch nur verbal) und ihr Schicksal nach der Vergewaltigung werden thematisiert.
Was ist die Motivation Amnons für die Vergewaltigung Tamars?
Die Motivation Amnons ist komplex und wird unterschiedlich interpretiert. Einige sehen die Vergewaltigung als reinen Machtkampf, während andere betonen, dass auch Liebe (vor der Tat) und Hass (nach der Tat) eine Rolle spielen. Psychoanalytische Deutungen sehen die Ursache in einer neurotischen Störung Amnons, bedingt durch das Verhalten seines Vaters David.
Wie reagieren David und Abschalom auf die Vergewaltigung Tamars?
David reagiert mit Zorn, jedoch ohne Konsequenzen zu ziehen. Abschalom hasst Amnon und plant dessen Ermordung, vermeidet jedoch zunächst die Konfrontation.
Welche Rolle spielt die Gesellschaft in der Erzählung?
Die Gesellschaft wird durch die Reaktion von David, Abschalom und durch Tamars Isolation repräsentiert. Die Tabuisierung sexueller Gewalt und das "Blaming the Victim" sind zentrale Themen.
Gibt es intertextuelle Verweise zu anderen biblischen Erzählungen?
Ja, es gibt Parallelen zur Erzählung von Dina (Gen 34) und zur Erzählung von Davids Ehebruch mit Bathseba (2 Sam 11).
Welche Bedeutung hat die Erzählung von Tamar und Amnon aus kriminologischer und feministisch-soziologischer Perspektive?
Die Erzählung bietet Einblicke in die Dynamik sexueller Gewalt, die Täterstrategien, die Folgen für das Opfer und die gesellschaftlichen Reaktionen. Sie zeigt Parallelen zu heutigen Formen des sexuellen Missbrauchs.
Was sind die Schlussfolgerungen der Analyse der Erzählung von Tamar und Amnon?
Die Mechanismen personaler und struktureller Gewalt in der Erzählung stimmen im Wesentlichen mit denen gegenwärtiger Formen des sexuellen Missbrauchs überein. Die feministische Exegese öffnet den Blick für eine Betrachtung des sexuellen Gewaltakts als solchen. Kriminologische und feministisch-soziologische Forschungsergebnisse helfen dabei, Parallelen zur Situation heutiger Vergewaltigungsopfer zu ziehen.
- Quote paper
- Thomas Griebel (Author), 2005, Sexuelle Gewalt als Thema der Erzählung von Tamar udn Amnon (2 Sam 13,1-22) aus feministisch-exegetischer Perspektive, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109916