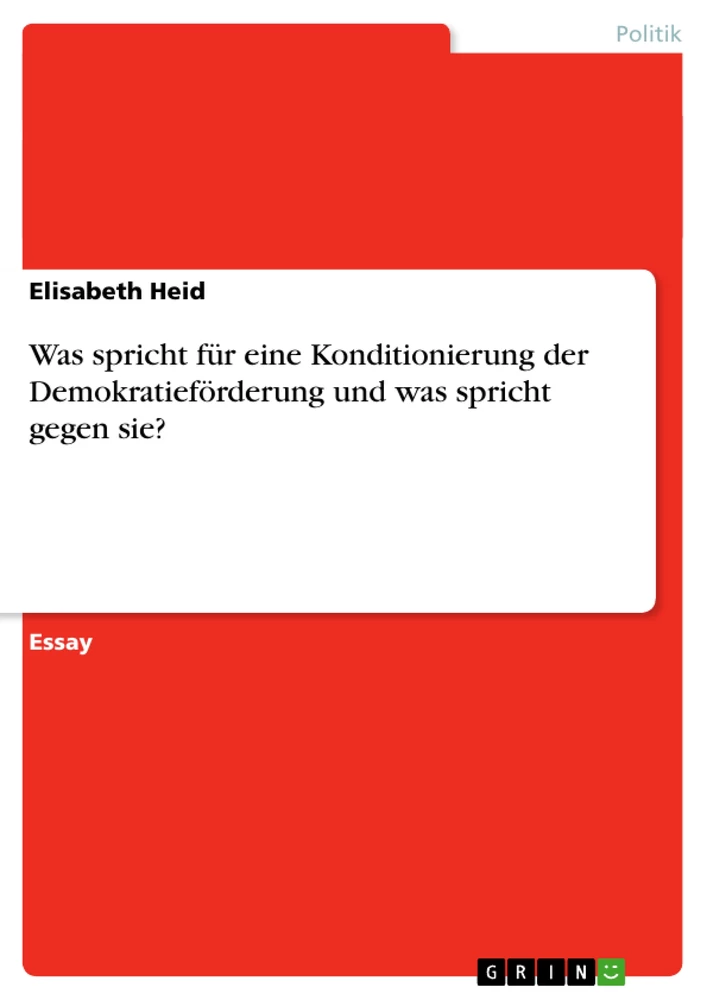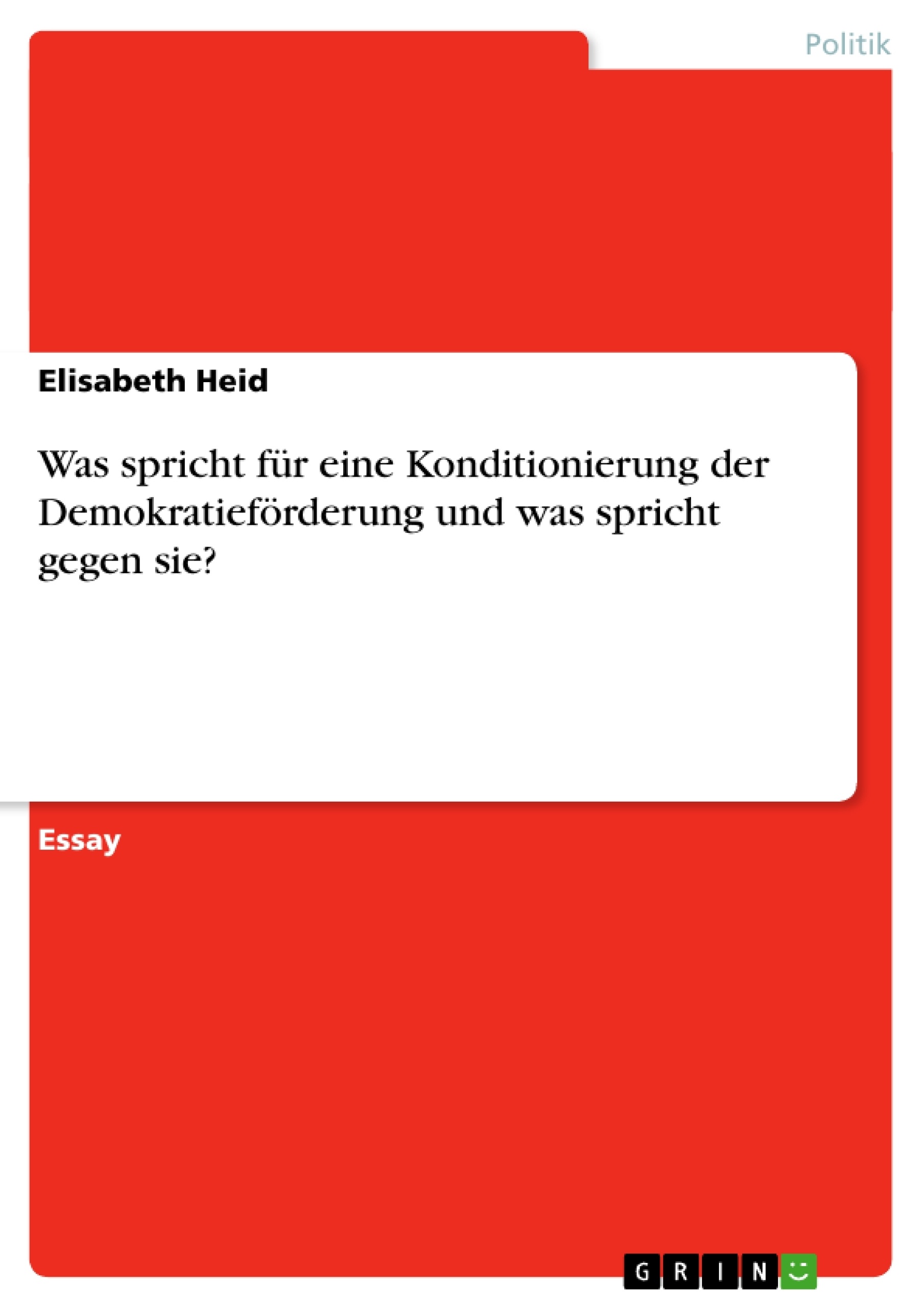Was spricht für eine Konditionierung der Demokratieförderung und was spricht gegen sie?
In der Entwicklungszusammenarbeit bezeichnet Konditionierung bzw. Konditionalität eine Auflagenerteilung, die ein Empfängerstaat erfüllen muss, um Entwicklungshilfe oder andere demokratiefördernde Finanzmittel[1], zu erhalten. Die Auflagen sind die des „ Good Govern ance“ („verantwortungsbewusste Regierungsführung“), einem Begriff der in den 1980er Jahren in den internationalen Finanz- und Entwicklungshilfeorganisationen (Weltbank, OSZE, UNDP, IMF usw.) geprägt wurde. Eine einheitliche Definition von Good Governance gibt es nicht. Breit formuliert bezieht sich der Begriff auf die Anwesenheit von Institutionen, Strukturen und Prinzipien, die (angeblich) Grundstoff funktionierender Demokratien sind. Hierzu gehören u.a. die Kernelemente des so genannten „Washington Consensus“: Transparenz, Effizienz, Partizipation, Verantwortlichkeit, Marktwirtschaft, Rechtsstaat, Demokratie und Gerechtigkeit.
Unterschieden werden kann zwischen indirekter und direkter Konditionalität. Im ersten Fall bestimmt die Anwesen- bzw. Abwesenheit von Good Governance, ob Entwicklungshilfe oder Demokratieförderungsmittel an Staaten ausgezahlt werden. Im letzteren wird die Auszahlung mit bestimmten Auflagen versehen – in der Regel eine „Pflicht“ zur Umsetzung bestimmter Reformen, die Good Governance fördern. Die erfolgreiche Umsetzung dieser Programme kann daraufhin zur Voraussetzung für weitere Zahlungen werden.
Für eine Konditionierung der Demokratieförderung spricht, dass Good Governance notwendig ist um zu versichern, dass Entwicklungshilfe sinnvoll eingesetzt wird und letztendlich zum überragenden Ziel der Armutsbekämpfung beiträgt. So sind z.B. transparente Strukturen notwendig, um Korruption zu verringern. Dass Entwicklungshilfe gerade in nichtdemokratischen Staaten oftmals nicht in die Taschen der bedürftigen fliest, ist kein Geheimnis. Letztendlich profitieren sowohl Geber- wie auch Empfängerländer von der Konditionierung: Empfängerländer, weil die Entwicklungshilfe effizient genutzt wird und demnach, langfristig, die Abhängigkeit von Entwicklungshilfe verringert werden kann; Geberländer, weil eine effektive Nutzung der Zahlungen im Idealfall auch weniger Zahlungen meint.
Ein weiteres Argument der Konditionierungsbefürworter zieht vielmehr auf die Innenpolitik der Empfängerstaaten, als auf die eigentliche Entwicklungshilfe ab. Konditionalität ermöglicht es den Regierungen von Entwicklungsländern, gute Reformen, die gegebenenfalls unpopulär sind, durchzusetzen. Indem das Geberland (oder die Geberinstitution) gewissermaßen als Sündenbock fungiert, können Politiker eine Reformpolitik betreiben, ohne bedrohliche Wahlverluste befürchten zu müssen.
Gegen eine Konditionierung der Demokratieförderung bzw. Entwicklungshilfe spricht, erstens, der Vorwurf eines Neo-Imperialismus: Entwicklungsländern werden Reformen aufgedrängt, die eventuell gar nicht in ihrem Interesse, sondern vielmehr in dem der Geberländer sind. Selbst wenn man von einem „guten Willen“ seitens der Geberländer ausgeht, stellt sich die Frage, inwiefern die Good Governance -Prinzipien wirklich universal gültig und unveränderlich sind. In einigen Fällen wurden, aufgrund einer ideologiegetriebenen Auflagenerteilung, Entwicklungsländer zu „Radikalreformen“ bewegt – mit katastrophalen Auswirkungen. Ein Beispiel ist die Privatisierung der Wasserversorgung, an die die entwickelten Länder „zu Hause“ nur schrittweise herangehen; im Ausland zur Auflage von Entwicklungshilfezahlungen gemacht haben.
Fernerhin steht eine derartige Universalpolitik einem weiteren (wenn auch neuerem) Grundsatz der Entwicklungszusammenarbeit entgegen: Dem des “local ownership”, d.h., dem Gedanke, dass „vor Ort“ am meisten Wissen darüber herrscht, was die Demokratieförderung und Armutsbekämpfung hemmt, und dass deswegen jegliche Entwicklungspolitik auch in Abstimmung mit lokalen Akteuren betrieben werden muss.
Ein zweites Problem bei der Konditionierung von Demokratieförderung ist die Tatsache, dass Geberländer es nicht schaffen, die daraus resultierende Selektivität („nur kooperierende Staaten erhalten Entwicklungshilfe“) konsequent anzuwenden. Vielmehr ist die Vergabe von Entwicklungspolitik weiterhin von anderen, oftmals politischen oder kurzfristigen, Motiven seitens der Geberländer geprägt. In anderen Fällen kann der Verweis auf fehlendes Good Governance zur Begründung von Hilfsmittelkürzungen herangezogen werden.
Drittens spricht gegen das Konditionierungsprinzip die Tatsache, dass sie einen inhärenten Paradox enthält: Einerseits zielt es darauf ab, Good Governance – und daher auch Demokratie – in Entwicklungsländern zu fördern. Andererseits untergräbt eine derartige Auflagenerteilung auch die Demokratie. Indem dem Staat „von außen“ eine Politik aufgedrückt wird, wird der einheimische, demokratische Politikprozess unterlaufen.
Letztendlich kann über die Konditionierung von Demokratieförderung nur Resümee gezogen werden, wenn diese differenziert betrachtet wird. In Osteuropa kann die Konditionalität durchaus als Erfolgsgeschichte betrachtet werden. Anderorts ist das Bild düsterer: In Afrika ist nach zwanzig Jahre Konditionierungspolitik nicht mehr Demokratie oder weniger Armut zu sehen. Deswegen stellt sich die Frage, ob es nicht vielmehr das „Zuckerbrot“ einer EU-Mitgliedschaft, und nicht die Konditionierung, war, der in den osteuropäischen Staaten den gewaltigen Transformationsprozess bewirkte.
Eine differenzierte Betrachtung ist auch in Hinblick auf die zwei Formen der Konditionierung angemessen. Die indirekte Konditionierung von Demokratieförderung scheint mir normativ vertretbarer, vor allem wenn man sich hierbei auf die fundamentalsten Grundsätze von Good Governance, z.B. demokratische Wahlen und Achtung der Menschenrechte, beschränkt. Die Auszahlung von Entwicklungshilfe an zerfallene oder autoritäre Staaten kann nicht sinnvoll sein; hier muss die Entwicklungspolitik gegebenenfalls andere, nicht-staatliche Akteure unterstützen. Schwieriger wird es bei der direkten Konditionalität. Diese lässt sich, meiner Meinung nach, nur rechtfertigen, wenn die Geberländer sie einheitlich und unpolitisch verfolgen, und wenn bei der Formulierung von Auflagen das betroffene Entwicklungsland miteinbezogen wird. Ob dies möglich ist, bleibt fraglich.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist Konditionierung/Konditionalität in der Entwicklungszusammenarbeit?
Konditionierung oder Konditionalität in der Entwicklungszusammenarbeit bezieht sich auf die Auflagenerteilung, die ein Empfängerstaat erfüllen muss, um Entwicklungshilfe oder demokratiefördernde Finanzmittel zu erhalten. Diese Auflagen beziehen sich meist auf "Good Governance".
Was bedeutet "Good Governance"?
Es gibt keine einheitliche Definition, aber im Wesentlichen bezieht sich "Good Governance" auf Institutionen, Strukturen und Prinzipien, die für funktionierende Demokratien wichtig sind. Dazu gehören Transparenz, Effizienz, Partizipation, Verantwortlichkeit, Marktwirtschaft, Rechtsstaat, Demokratie und Gerechtigkeit.
Was ist der Unterschied zwischen indirekter und direkter Konditionalität?
Bei indirekter Konditionalität hängt die Auszahlung von Hilfsgeldern vom Vorhandensein oder Fehlen von "Good Governance" ab. Bei direkter Konditionalität ist die Auszahlung an bestimmte Auflagen geknüpft, wie z.B. die Umsetzung von Reformen, die "Good Governance" fördern.
Welche Argumente sprechen für eine Konditionierung der Demokratieförderung?
Befürworter argumentieren, dass "Good Governance" notwendig ist, um sicherzustellen, dass Entwicklungshilfe sinnvoll eingesetzt wird und zur Armutsbekämpfung beiträgt. Konditionalität kann auch Regierungen von Entwicklungsländern helfen, unpopuläre, aber notwendige Reformen durchzusetzen.
Welche Argumente sprechen gegen eine Konditionierung der Demokratieförderung?
Kritiker werfen Neo-Imperialismus vor, da Reformen aufgedrängt werden, die möglicherweise nicht im Interesse der Empfängerländer sind. Es wird auch die Universalität der "Good Governance"-Prinzipien in Frage gestellt. Zudem widerspricht Konditionalität dem Grundsatz des "local ownership", bei dem lokale Akteure am besten wissen, was Demokratieförderung und Armutsbekämpfung hemmt.
Was ist das Problem mit der Selektivität bei der Konditionierung?
Geberländer wenden die Selektivität (nur kooperierende Staaten erhalten Hilfe) oft nicht konsequent an. Die Vergabe von Entwicklungshilfe ist häufig von politischen oder kurzfristigen Motiven geprägt.
Welches Paradox enthält das Konditionierungsprinzip?
Einerseits soll "Good Governance" und Demokratie gefördert werden. Andererseits untergräbt die Auflagenerteilung die Demokratie, da dem Staat von außen eine Politik aufgedrängt wird.
Kann die Konditionierung von Demokratieförderung als Erfolg gewertet werden?
Das Resümee ist differenziert zu betrachten. In Osteuropa kann Konditionalität als Erfolg betrachtet werden, während in Afrika nach zwanzig Jahren Konditionierungspolitik keine signifikanten Verbesserungen erkennbar sind.
Welche Form der Konditionierung ist vertretbarer?
Die indirekte Konditionierung, die sich auf fundamentale Grundsätze wie demokratische Wahlen und Menschenrechte beschränkt, erscheint normativ vertretbarer. Schwieriger ist die direkte Konditionalität, die nur gerechtfertigt ist, wenn sie einheitlich und unpolitisch verfolgt wird und das betroffene Entwicklungsland in die Formulierung der Auflagen einbezogen wird.
- Citation du texte
- Elisabeth Heid (Auteur), 2005, Was spricht für eine Konditionierung der Demokratieförderung und was spricht gegen sie?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109940