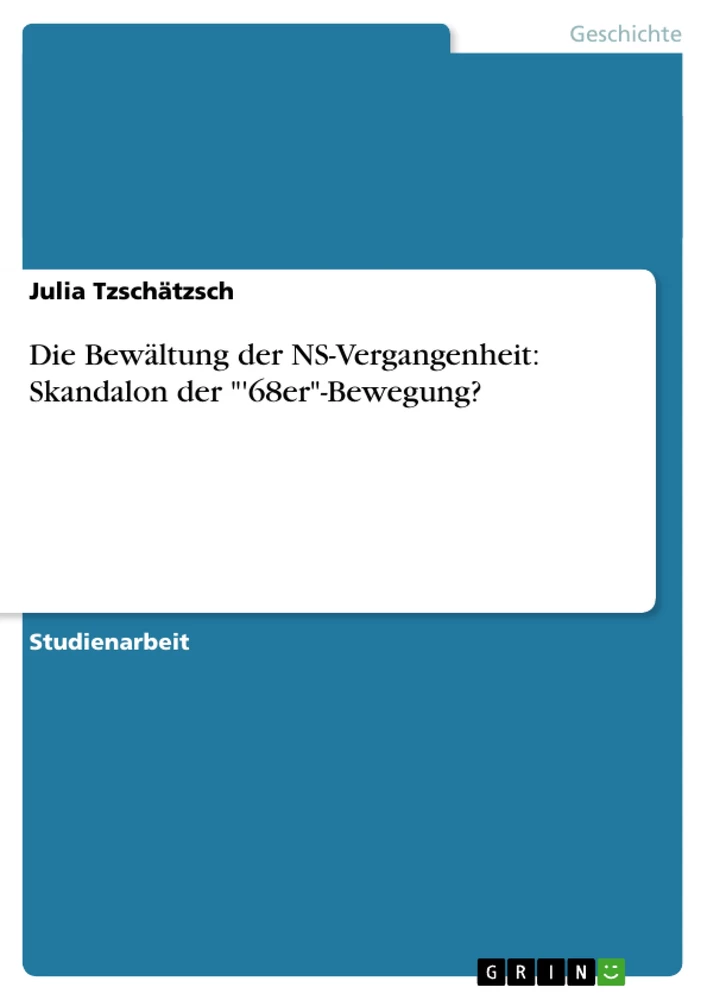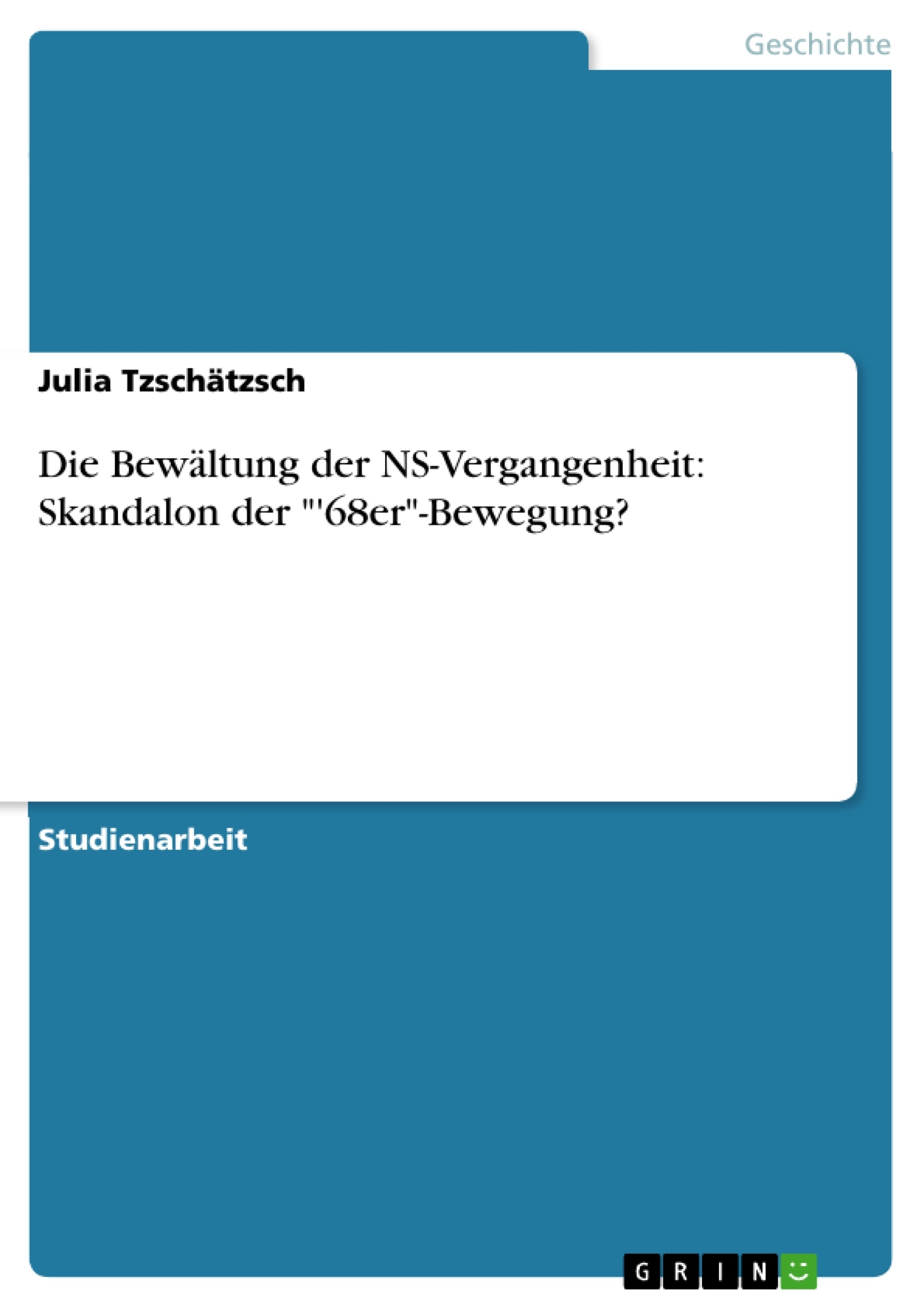Zentrales Anliegen dieser Arbeit ist, nachzuweisen, welche Faktoren die studentische Protestbewegung der 60er Jahre in Westdeutschland maßgeblich beeinflusst haben. Um dem Tenor unseres Proseminars gerecht zu werden, möchte ich ein Hauptaugenmerk meiner Analyse auf die Bewältigung der nationalsozialistischen Vergangenheit legen. Genauer soll meine zentrale These lauten, dass die Vergangenheitsbewältigung in der Studentenbewegung zwar eine große Rolle gespielt hat - das Schweigen über die NS-Zeit sollte gebrochen werden. Aber nur durch das Phänomen der Vergangenheitsbewältigung wäre „1968“ in dieser Form nicht zustande gekommen. Ein komplexes Zusammenspiel zahlreicher Faktoren - teils direkter, teils indirekter Art - haben sich gegenseitig verstärkt und die Proteste der damaligen Zeit geschürt.
Gliederung
Einleitung
II. Hauptteil
1. Die politische Sozialisation als Nährboden für 1968
1.1 Die Sozialisationsagentur Familie und Milieu
1.2 Die Sozialisationsagentur Universität
2. Die Bewältigung der nationalsozialistischen Vergangenheit
3. Die Faschismusdebatte
4. Wirtschaftliche Entwicklung
5. Politik und Parteienlandschaft
6. Einflüsse von Außen
7. Gesinnungs- und Wertewandel
8. Die Rolle der Medien
III. Schlussteil
IV. Literaturverzeichnis
I. Einleitung
1968 ist heute ein fast magisches Jahr. Die Bilder und Originaltöne aus den sechziger Jahren, mit denen Zeitgenossen wie Nachgeborene konfrontiert werden, enden immer noch in kontroversen Wertungen der damaligen Ideen und Ereignisse. Gravierende Differenzen tauchen auch bei der Forschung nach möglichen Ursachen der westdeutschen Protestbewegung auf: War es die Bewältigung der NS-Vergangenheit, die Entlarvung des „hilflosen Antifaschismus“[1], die die erste Nachkriegsgeneration auf die Straßen trieb? War die westdeutsche Protestbewegung von 1968 mehr ein Beispiel der so genannten „globalen Bewegungen, die sich weltweit parallel entwickelten und in verschiedenen Ländern bedeutende Ähnlichkeiten aufwiesen“[2] ? Oder war Auslöser der Revolte schlicht die „ewige Auflehnung Jugendlicher gegen die Eltern, [die] zeittypisch nach links ausgeschlagen war“[3] ?
Zentrales Anliegen dieser Arbeit ist also nachzuweisen, welche Faktoren die studentische Protestbewegung der 60er Jahre in Westdeutschland maßgeblich beeinflusst haben. Um dem Tenor unseres Proseminars gerecht zu werden, möchte ich ein Hauptaugenmerk meiner Analyse auf die Bewältigung der nationalsozialistischen Vergangenheit legen. Genauer soll meine zentrale These lauten, dass die Vergangenheitsbewältigung in der Studentenbewegung zwar eine große Rolle gespielt hat - das Schweigen über die NS-Zeit sollte gebrochen, „Relikte der braunen Vergangenheit“[4] offengelegt und eliminiert werden. Aber nur durch das Phänomen der Vergangenheitsbewältigung wäre „1968“ in dieser Form nicht zustande gekommen. Ein komplexes Zusammenspiel zahlreicher Faktoren - teils direkter, teils indirekter Art - haben sich gegenseitig verstärkt und die Proteste der damaligen Zeit geschürt.
An Literatur habe ich in erster Linie verschiedene Aufsätze aus der „Westfälischen Forschung“ von 1998 (unter anderem von Hans-Ulrich Thamer, Heinrich Ulrich Seidel und Wiebke Güse) herangezogen. Des weiteren beziehe ich mich auf mehrere Aufsätze aus dem Sammelband „Aus Politik und Zeitgeschichte“ aus dem Jahre 1988 (so zum Beispiel von Claus Leggewie und Hermann Lübbe). Der aktuelle Beitrag „Liberalisierung und Radikalisierung. Zwei Gründungsmythen der Bundesrepublik“ des Freiburger Geschichtswissenschaftlers Ulrich Herbert hat mich ebenfalls in meiner Forschungsarbeit weitergebracht, sowie die anschließenden Literaturhinweise auf der Homepage der Freiburger Universität. Besonders hilfreich waren mir davon „1968. Vom Ereignis zum Gegenstand der Geschichtswissenschaft (hg. von Ingrid Gilcher-Holtey), „Die studentische Protestbewegung“ (hg. von Dr. Heinrich Barth) und „Deutschland zwischen Demokratie und Antidemokratie“ von Kurt Sontheimer.
Die Faktoren, die zu „’68“ beigetragen haben, sollen nicht nur enumerativ aufgelistet, sondern zuvor in acht Hauptkategorien eingeteilt werden: An erster Stelle werde ich den Prozess der politischen Sozialisation der „68er“-Generation erläutern, da sie gewissermaßen den „Nährboden“ für die Studentenproteste darstellt. Punkt Nummer Zwei meiner Gliederung ist das Phänomen der Vergangenheitsbewältigung als Beweggrund für „’68“; eng damit verbunden die so genannte „Faschismusdebatte“. Diese ersten drei Punkte - politische Sozialisation, Bewältigung der Nazi-Zeit und Faschismusdebatte - werde ich besonders ausführlich behandeln, da auf diesen Gebieten die neuesten Forschungsergebnisse vorliegen.
Bei der Suche nach Gründen für „’68“ nicht zu vernachlässigen, sind außerdem die wirtschaftliche Entwicklung der Nachkriegszeit, die innen- und außenpolitische Situation und der damit verbundene Gesinnungs- und Wertewandel in der Bundesrepublik, die ich von Punkt vier bis sieben skizzieren werde. Eine ebenfalls nicht zu unterschätzende Rolle spielen bei der Studentenbewegung die Massenmedien, an achter Stelle wieder ausführlicher angeführt.
Die Grenzen zwischen diesen acht Kategorien sind manchmal fließend, doch erfüllen sie ihren Zweck der Orientierung. Wegen der bereits erwähnten Interdepenzenden der einzelnen Faktoren würde mit einer chronologischen Anordnung der rote Faden dieser Arbeit verloren gehen. Ich werde weniger auf Definitionen und Begriffseinordnungen, wie auf die einzelnen Ausrichtungen der Protestbewegungen eingehen. Im Mittelpunkt stehen, wie gesagt, Umstände, Einflüsse und Tatsachen die in den 60er Jahren zu dieser generellen Unruhe beigetragen haben.
II. Hauptteil
1. Die Politische Sozialisation der „’68er“-Generation
1.1 Die Sozialisationsagentur Elternhaus
Um die mentalen Hintergrunde der „’68er“-Auseinandersetzungen zu verstehen, ist eine Untersuchung des familiären Gegenübers der APO-Generation nötig. Dabei soll auch kurz auf die Eltern der Protestler eingegangen werden.
Die so genannte Aufbaugeneration erlebte ihre Kindheit im Kaiserreich und empfand diese zum größten Teil als „sehr idyllisch“[5], wohingegen die folgende Weimarer Republik von vielen als eine „Zeit des Umbruches, der radikalen Veränderungen und als Zeit des persönlichen oder familiären Abstiegs“[6] geschildert wurde. Nach diesem unruhigen Zeitabschnitt ließ man sich auf das Wagnis des Nationalsozialismus ein; Hitler symbolisierte einen neuen großen Aufschwung, man sah die Chance, den Staat aktiv mitzugestalten. Das Gefühl des „Besseren“ verflüchtigte sich zwar schnell, doch aus Angst um die eigene Position wagte man es nicht, sich gegen das Hitler-Regime zu erheben. „Desillusion, Verrat und Missbrauch“[7] sind Schlüsselwörter für die Gefühle der „’68er“ -Eltern im Jahre 1945. In der Nachkriegszeit zog man sich folglich ins Private zurück, gab jegliches politisches Engagement auf. „Die Erwachsenen sprachen nicht über die Jahre zwischen 1933 und 1945 oder sie stellten sich als die schändlichen Betrogenen hin“[8], schildert Michael Sontheimer dieses Phänomen in seinem Erfahrungsbericht.
Es folgte eine historisch ungewöhnlich lange Phase des Friedens – die Zeit, in der die „68er“-Generation ihre Kindheit verlebte. Die hohe Veränderungsdynamik in allen Lebensbereichen während der Kriegs- und Nachkriegsjahre hatte in der Bevölkerung Deutschlands das „Bedürfnis nach kompensierender Stabilität in den Lebensgewohnheiten geradezu übermächtig werden lassen“[9]. Dieses Bedürfnis schlug sich während der 50er Jahre in der Suche nach „sittlicher“ Restabilisierung auf der Grundlage traditioneller Normen und Lebensweisen wieder. Konsequenzen daraus waren unter anderem repressive Formen der Kindererziehung, ein obrigkeitsfixiertes Staatsverhältnis und die Abwehr gegen modern-kulturelle Einflüsse.
Die Behauptung liegt nahe, dass der Generationskonflikt als Auslöser der Revolte zu zählen ist. Schon immer haben sich Jugendlichen gegen ihre Eltern gestellt, die Zeit hätte diese Auflehnung nach links ausgeschlagen lassen und eher private Protestformen (unkonventionelle Moden, Musik und Manieren der Jugend) durch gesellschaftskritisches Engagement aufgeladen. Claus Leggewie relativiert diese Vermutung, er betrachtet die Spannungen zwischen unpolitischer und konsumorientierter Aufbaugeneration und den politisch engagierten Jugendlichen „weniger [als] Auslöser denn [als] Folge politischen Engagements“[10]. Autoritärer oder permissiver Erziehungsstil an sich wären ebenso wenig Ursache oder Verstärker radikalen Protestverhaltens; die Protestbewegung ist „Reflex eines familiensoziologisch diagnostizierbaren Wandels gewesen“[11].
Die Kindheit und Jugend der Protestgeneration war von großem materiellen Wohlstand geprägt, sie lebten inmitten der „glorreichen 30 Jahre“ (Jean Fourastié). Da sie bisher keine instabilen politischen oder wirtschaftlichen Phasen erlebt hatten, fehlte den „’68ern“ die Wertschätzung der Sicherheit, die der neue Staat Bundesrepublik bot. „Aus diesem Gegensatz gespeist – auf der einen Seite das Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität und Ruhe, und auf der anderen Seite das Gefühl, in einem Staat zu leben, der für Veränderungen überhaupt keine Chance bot, weil jede Veränderung als Bedrohung empfunden wurde, staute sich das Konfliktpotential in den 50er und 60er Jahren auf, bis es 1967/68 zu einer eruptiven Entladung kam.“[12]
1.2 Die Sozialisationsagentur Universität
Träger der Protestbewegung in den 60er Jahren waren vorwiegen in vielerlei Beziehung privilegierte Studenten und Oberschüler. Das ausgeprägte Protestpotential innerhalb der Studentenschaft ist vor allem durch „die Statusunsicherheit der Studenten, durch die immer unsicher werdenden Berufschancen in einer mobilen Gesellschaft und durch die Anonymität des Massenstudiums“[13] zu verstehen. Der Prozess der Vermassung des Individuums in jeder modernen Industriegesellschaft nahm immer gravierendere Formen an: „Der junge Mensch fühlt sich vielfach in der industriellen Massengesellschaft nicht geborgen, sondern bestenfalls zu seinem manipulierten Wesen reduziert.“[14]
Die Ruhr-Universität Bochum zum Beispiel verzeichnete in den 60er Jahren einen so drastischen Anstieg an Studenten, dass sich schon bald eine „Überfüllungskrise“[15] abzuzeichnen begann. Ein Wissenschaftsrat aus nicht-studentischen Mitgliedern sollte sich mit dem Überladungsproblem beschäftigen, schlug aber lediglich vor, zu expandieren - „von jeglicher Strukturreform hielt man Abstand“.[16] Genauso wenig wie um die interne Reform der Hochschule kümmerte sich der Wissenschaftsrat um das private Wohl des akademischen Nachwuchses, in seinem Konzept zur Überwindung der Überfüllungskrise wurden die Studierenden „auf ihre Rolle als Mitglieder der Institution [Universität] reduziert“[17].
Die Krise des Hochschulsystems und die anschließende Hochschulreform Ende der 50er Jahre, bildet nach Ansicht von Wiebke Güse, „den spezifischen Entstehungshintergrund der studentischen Bewegung“[18]. Die Hochschule bildete das Aktionszentrum für die Protestbewegung („Das Milieu der Massenuniversität zwar damit ohne Zweifelt der Vermittlungsort zwischen „protestbereiten“ Individuen und gesamtgesellschaftlichen Problemlagen“[19] ), und doch traten Hochschulprobleme mehr und mehr in den Hintergrund. Der Campus wurde zum Exerzierfeld schon bestehender Gesellschaftskritik. Die Studenten, die gerade ihren „Prozess sekundärer Sozialisation“[20] durchmachten, unternahmen einen Rettungsversuch der Universitäten als Forum kritischer Öffentlichkeit und Reflexion.
Gerd Langguth schreibt der universitären Sozialisationsphase einen besonders unruhefördernden Charakter zu: In der Anfangsphase der Protestbewegung in der Bundesrepublik wären zahlreiche studentische Aktionen erst ex post die Ideologisierung in die Unruhe hineingetragen worden: „So ist die Ideologie nicht auslösend, sondern ausrichtend für die [also schon vorher bestandene] Unruhe.“[21]
Die Protestbewegungen, die die Gruppen kanalisierten, vermittelten ihren Mitgliedern durch ausgeprägten Aktionismus vielfach das ersehnte Geborgenheitsgefühl, das weder in Familie noch in Universität ausfindig zu machen war. Ein ständig in diesen Gruppen betontes Solidaritätsbewusstsein wurde dann noch gestärkt durch Fahnenkult und das gemeinsame Absingen von Kampfesliedern. Aktionen, die den emotionalen und spontanen Charakter der Protestbewegung aufzeigen, die die Irrationalismen der Studentenpolitik weitgehend mit begründeten.[22]
In punkto Prostbetbewegung der 60er Jahre nahmen die Studenten weiter eine Art Funktion als Vorauskommando an, da sie auf unbekanntem Gebiet neue Fragen diskutieren und in geschütztem Raume Kritik, Öffentlichkeit und neue Lebensformen übten oder ausprobierten, „ohne dass daraus jeweils schon generalisierbare Modelle entstehen konnten“[23].
2. Die Bewältigung der nationalsozialistischen Vergangenheit
2.1 Dämonisierung und Bagatellisierung
„Es ist unbestritten, dass die nationalsozialistische Vergangenheit und das Niveau ihrer ‚Bewältigung’ ein wesentliches, wenn auch nicht das alleinige Antriebselement für die westdeutsche Protestbewegung von 1968 waren.“[24] Bisher war die Arbeit auf diesem Gebiet der Vergangenheitsbewältigung alles andere als abgeschlossen, ein Rückblick auf den politischen wie öffentlichen Umgang mit der NS-Zeit kann dies bestätigen: Unmittelbar nach 1945 herrschte in der deutschen Bevölkerung zwar eine generelle Ablehnungshaltung gegenüber der NS-Zeit. Doch unternahm man den gleichzeitig den Versuch, die zwölf Jahre des Hitlerregimes zu bagatellisieren, indem man sie als "Bruch mit der deutschen Geschichte bzw. als Entartung deutschen Menschentums“[25] darstellte. Wenn in den 50er Jahren eine Erinnerung an die NS-Zeit stattfand (was relativ selten vorkam, das „kommunikative Beschweigen“ war vorherrschend), dann meist „in der Form der Abstraktion, in dem Bemühen, durch eine weitgehende Amnestie der Millionen von [so eingestuften] Minderbelasteten, deren Integration in die Zivilgesellschaft der Bundesrepublik so geräuschlos wie möglich zu vollziehen“[26]. Ein öffentliches Zurückentsinnen an das Hitler-Regime war des weiteren mit dem leidenschaftlichen Gebrauch von Metaphern verbunden. Man verglich Hitler und seine Gefolge mit Dämonen und unaufhaltsamen Naturgewalten – implizierte also stets die Machtlosigkeit und Unschuld der Bevölkerung zu Entnazifizierungs- und Reintegrationszwecken. Über die aktive Beteiligung in der NSDAP ließ man den Schleier des Vergessens fallen. Es bestimmte also nicht eine „allgemeine Verdrängung [...] den frühen Umgang mit dem Nationalsozialismus, sondern eine eigentümliche Ambivalenz von offizieller und sehr abstrakter Verurteilung einerseits wie von öffentlichem Beschweigen der individuellen Belastungen und Verstrickungen andererseits.“[27] Kurt Sontheimer beklagt die Konsequenz dieser Strategie der Vergangenheitsbewältigung im Jahr 1968 mit den Worten: „Kein Wunder, dass viele Lehrer ihren Schülern nicht plausibel machen konnten, warum sie in den 12 Jahren mitgemacht hatten, da die ganze Nation keine Erklärung darauf wusste [...].“[28]
Auch angesichts der vordringlichen Immunisierung gegen den kommunistischen Totalitarismus der Gegenwart war eine Auseinandersetzung mit den Wurzeln, den Trägern und Folgen des Nationalsozialismus nicht genügend in das öffentliche Bewusstsein gerückt worden. Die historische Erforschung der Vergangenheit hatte bereits frühzeitig begonnen, aber eher im Sinne von Institutionen-Sicherung (Lehren aus dem Scheitern der Weimarer Republik) ausgewertet worden. Die keineswegs forcierte strafrechtliche Verfolgung von nationalsozialistischen Gewaltverbrechern erregte wenig Aufsehen.
2.2 Die Entdeckung der nationalsozialistischen Erblast
Dies sollte sich ändern: Rund fünfzehn Jahre nach Gründung der Bundesrepublik entdeckte eine nachgewachsene Generation die historische Erblast des NS-Regimes neu und bewertete sie mit gesinnungsethischem Rigorismus. Ursachen, Bedingungen und Folgen des nationalsozialistischen Herrschaftssystems wurden leidenschaftlich diskutiert und vielfach die Forderung erhoben, „die Gesellschaft der Bundesrepublik von vermeintlichen Relikten der braunen Vergangenheit zu säubern“.[29] Äußeren Anlass dazu bot nach dem weltweit beachteten Eichmann-Prozess in Jerusalem im Jahre 1961 auch der Beginn des Frankfurter Auschwitz-Prozesses im Dezember 1963. Auch die kulturelle Aufarbeitung durch Filme wie „Die Brücke“ (1959), „Der Stellvertreter“ (1963) und „Die Ermittlung“(1965) beispielsweise, brachten das schwere NS-Erbe wieder auf den Tisch. Besonders die Aufdeckung alter Strukturen und personeller Kontinuitäten von der NS-Zeit bis in die Bundesrepublik erregten öffentliches Aufsehen. Die Biographie hoher Staatsträger und des eigenen Vaters wurden interessant.
Nach Ansicht von Claus Leggewie hat man das Bewältigungsniveau der nationalsozialistischen Vergangenheit in den 60er Jahren „zu Recht als wesentliches Antriebselement der westdeutschen Protestbewegung bezeichnet“[30].
Doch nicht alle Historiker legen den Schwerpunkt ihrer Erklärungen für „’68“ auf die Entlarvung und Bewältigung alter Strukturen. Der Philosoph Hermann Lübbe bestreitet, dass das Phänomen individuell gekennzeichneter biographischer Vergangenheitsaufdeckung hierbei eine große Rolle gespielt habe; die Väter also nicht im Mittelpunkt der Protestbewegung standen. Lübbe bezeichnet diese Behauptung sogar als Mythos: „Das Ende des Dritten Reiches lag gerade erst zwanzig Jahre zurück und in der akademischen Öffentlichkeit einschließlich ihres studentischen Anteils pflegte man doch zu wissen, wer unter den älteren Professoren der nationalsozialistischen Bewegung verbunden gewesen war [...].“[31].
So rückt auch der Freiburger Geschichtswissenschaftler Ulrich Herbert weit von der ausschließlichen Nazivergangenheits-Begründung ab („Betrachtet man [...] die Formen und Rituale der Vergangenheitsbewältigung in den späten 60ern und 70er Jahren im Umfeld der Studentenbewegung und der neuen Linken, so wird deutlich, dass die Auseinandersetzung mit der Geschichte der NS-Herrschaft durchaus keinen Schwerpunkt ihrer öffentlichen und internen Auseinandersetzungen darstellten.“[32] ). Die sich ausbreitende Vorstellung vom NS-Regime war vielmehr durch Faschismustheorien und politische Systemanalysen gekennzeichnet, und es entstand ein abstraktes und synthetisches Bild vom Nationalsozialismus.
3. Die Faschismusdebatte
„Man nahm [...] Theorien, die die wacheren Studenten längst kannte, verblüffenderweise plötzlich ernst und verlangte die Transformation des akademischen Katheders zur politischen Bühne“[33], beschreibt Hermann Lübbe die Wiederbelebung der Faschismusdebatte Mitte der 60er Jahre. Tatsächlich wurde die marxistische Faschismustheorie (vor allem in ihrer sowjetmarxistischen Variante) im Sprachgebrauch der Protestbewegung immer beliebter. Hintergrund war in erster Linie eine Begriffsverlagerung: Die Bezeichnung des „Totalitarismus“ war mittlerweile von der des „Faschismus“ ersetzt worden. „Faschismus“ stand nun als Gattungsbegriff für radikal nationalistische und totalitäre Bewegungen und Regime, der Nationalsozialismus war somit in eine vergleichende Perspektive gerückt.
Bei dieser Diskussion ging es weniger um die Erklärung der nationalsozialistischen Vergangenheit, als vielmehr um die „Anklage der Gesellschaft der Gegenwart“[34]. Die Auseinandersetzung mit den antiautoritären Strukturen hatte in den Partizipationsdefiziten der westdeutschen Gesellschaft der 60er Jahre ein erhebliches Aufgabenfeld - und teilweise auch Berechtigung. Obwohl europäische Nachbarländer zum Teil auch autoritäre Traditionen aufwiesen, wurde das Liberalitätsmanko der Bundesrepublik als „Ausdruck der weiterwirkenden Traditionen des Faschismus“[35] begriffen und somit aussichtslos delegitimiert.
Solche Gleichsetzungen hatten allerdings zur Folge, dass sich die Faschismusdebatte immer mehr von der Wirklichkeit entfernte und zu abenteuerlichen Konstruktionen führte: Zum Leitfaden fast aller faschismustheoretischen Debatten der folgenden Jahre sollte zum Einen der vermeintliche Zusammenhang zwischen Faschismus und Kapitalismus werden. In der Vorstellung der Protestbewegung wurden „das NS-Regime und die Bundesrepublik einander immer ähnlicher“[36]. Weiteres Resultat der begrifflichen Verwilderung war, dass „jeder jedermanns Faschist sein konnte“[37]. So wurde die Hochschulpartei Kölner Studenten Union (KSU), die an der Ruhr Uni Bochum die politische Mitte repräsentierte, von ihren Kommilitonen als „Klerikalfaschisten“[38] bezeichnet. Um die Protestbewegung herum befand sich offenbar „ein Volk von Mitläufern, [...] Nazis in Amt und Würde.“[39]
Es ist offenkundig, dass die damals wiederbelebte Faschismustheorie große Schwächen und Bindestellen aufwies. Sie war mit zweckdienlichen Momenten überladen, so dass der „’68er“ Antifaschismus also selbst eine Menge problematischer Seiten besaß. Und doch hat das leidenschaftliche Debattieren zumindest im Ansatz Früchte getragen – durch den „Gewinn dieser neuerlichen Thematisierung der nationalsozialistischen Vergangenheit“[40].
4. Wirtschaftliche Entwicklung
Der mit dem Korea-Boom von 1950/51 begonnene „zweite Wachstumszyklus der Nachkriegszeit“[41] setzte sich bis 1958 fort. Die westdeutsche Gesellschaft war in dieser Zeit zur Konsumgesellschaft geworden, sie war „gewissermaßen bis auf Gene durchindustrialisiert, technisiert und rationalisiert worden“[42].
Evoziert durch die Kubakrise schlug das Wirtschaftsbarometer Anfang der 60er Jahre um: Sinkende Wachstumsraten und Stagnationstendenzen, wachsende Beschäftigungsprobleme und Finanzierungslücken der öffentlichen Haushalte kündigten bereits Mitte der 60er Jahre das spätere Ende des kurzen Traumes immerwährender Prosperität an. Die Funktionsfähigkeit der Wachstumsökonomien und ihrer politischen Institutionen standen für die Legitimationskrise des Spätkapitalismus. Die „30 glorreichen Jahre“ waren vorzeitig unterbrochen worden. Die Volkswirtschaft der BRD geriet in eine Rezession, deren Zeitpunkt und vor allem Ausmaß von der Regierung nicht vorausgesehen worden war. Eine sich rasch ausweitende Haushaltslücke in Bund, Ländern und Kommunen tat sich auf. Das Bruttosozialprodukt blieb hinter den Schätzungen zurück, die Einnahmen hatten nicht den erwarteten Umfang. Eine Einigung innerhalb der Regierung war wegen der differierenden Interessen nicht möglich.
Bundeskanzler Erhard (CDU), der „personifizierten Verkörperung des Wohlstands für alle“[43], gelang es nicht, die rasch wachsende Unsicherheit zu bannen und die von breiten Kreisen als kritisch empfundene Situation zu meistern. Zwar waren die wirtschaftlichen Schwierigkeiten nach einigen Monaten überwunden - mindestens ebenso folgenschwer war aber zudem der „psychologische Schock, den die Rezession in weiten Teilen der Bevölkerung Westdeutschlands ausgelöst hatte“[44].
5. Politik und Parteienlandschaft
5.1 Die Tendenz zur Mitte
Im Zuge fortschreitender Säkularisierung schwanden christliche und konservative Überzeugungen. Auch dadurch verwischten sich die Fronten zwischen der Union und der SPD „([es] glichen sich deren Profile einander an“[45] ). Dieser Annäherung der Parteiprogrammatik war schon im „Godesberger Grundsatzprogramm“ der SPD vom 15. November 1959 verankert: Die SPD vollzog darin eine „Abwendung von ihrem bisherigen Selbstverständnis als Arbeiterpartei hin zu einer Volkspartei“[46]. Dies bedeutete zwangsläufig einen Bezugsverlust für die Arbeiterschicht, für Sozialisten und linksorientierte Bürger. Mit dem Ausschluss des Verbandes Sozialistischer Deutscher Studentenbund aus der SPD 1961 verstärkte sich diese Tendenz zur Mitte.
Diese parteipolitische Veränderung gewann an Relevanz für die Außerparlamentarische Opposition, die sich aus drei verschiedenen Bewegungen, der Neuen Linken, der Ostermarschbewegung und der Opposition gegen die Notstandsgesetze, formierte. Geprägt nach wie vor durch die kapitalistische Produktionsweise, entferne sich nach Meinung der APO-Anhänger die reale Situation zunehmend von der in der Verfassung festgelegten Ausgangsposition eines sozialen und demokratischen Rechtsstaats. „Aufgrund ihrer Wandlung zu Quasi-Staatsorganen seien die Parteien [...] nicht mehr in der Lage, dies vorhandenen Konflikte im parlamentarischen Rahmen auszutragen“[47]. Gerd Langguth bezeichnet die Protestbewegung der 60er Jahre sogar als „eine Reaktion auf den Pragmatismus der im Bundestag vertretenen Parteien, die sich derzeit wieder in der Phase der Regideologisierung befinden“[48].
5.2 Das Experiment der Großen Koalition
Die Führungsschwäche Erhards, die Zerstrittenheit der CDU und die Abnutzungserscheinungen innerhalb der bürgerlichen Koalition CDU/CSU und FDP, die seit Gründung der Bundesrepublik fast ununterbrochen gemeinsam die Regierung hergestellt hatte, ließ in der Öffentlichkeit den Ruf nach einer Ablösung des Kanzlers und der Kleinen Koalition immer stärker werden. Durch das Wagnis des Regierungsbündnisses aus CDU/CSU und SPD vom Dezember 1966 sollten dringlich gewordene innenpolitische Probleme gelöst werden, „das Experiment der Großen Koalition war als Not- und Zweckbündnis auf Zeit angelegt“[49]. Zudem wuchs seit 1965 unter dem Namen Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NDP) eine rechtsextreme nationalistische und antidemokratische Bewegung heran, die in Landtagswahlen fast zehn Prozent der Wählerstimmen gewann. Die Erfolge des Rechtsextremismus hatten die Bereitschaft gefördert, in Bund und Ländern große Koalitionen zu bilden.
Die Zweidrittel-Mehrheit im Bundestag war der Regierung nun gewiss: CDU/CSU und SPD teilten sich 447 Mandate, die FDP als einzige Oppositionspartei verfügte über 49. Damit war faktisch die parlamentarische Kontrolle ausgeschaltet – Grundlage für die APO-Bewegung.
Ein weiteres Wagnis der Großen Koalition, an dem sich die Protestbewegung ereiferte, war die Zielsetzung der Notstandsverfassung. Mit der Verabschiedung dieser Gesetzte sollte unter anderem sichergestellt werden, dass in Notzeiten die freiheitliche Lebensordnung erhalten bleibt, und dass die in Normalzeiten geltende Verfassungsordnung so schnell wie möglich wieder hergestellt wird. Zwei Faktoren erschienen den Kritikern als besonders gefährlich für die freiheitliche Demokratie: die geplante Einschränkung der Grundrechte und die Entmachtung des Parlaments im Krisenfall. Die Neue Linke, die sich als „konsequente Hüterin der Grundwerte dieser Verfassung“[50] verstand, wehrte sich gegen diese „Verwässerung des Grundgesetzes“, sie wollte die demokratischen Strukturen gegen antidemokratische Entartungen der Bundesrepublik verteidigen[51]. Mit der Erschießung des Studenten Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 durch einen Polizisten glaubte die Protestbewegung einen Vorgeschmack auf die kommenden Zeiten der Notstandsverfassung zu erkennen, der Protest verschärfte sich.
5.3 Erste Reaktionen auf die Protestbewegung
Auch Maßnahmen der Bundesregierung in den 60er Jahren sorgten in der Bevölkerung für Unbehagen. Im Vordergrund standen Vorbehalte gegen die Initiative der Remilitarisierung und die daraus zu folgernde Kriegsgefahr, sowie gegen den „wenig partizipativen und arkan-politischen Stil der Kanzlerdemokratie“[52].
„Die studentische Opposition ist erst groß geworden als Reaktion auf die autoritäre Art und Weise, mit der die etablierten Machtgruppen der Bundesrepublik ihren Besitzstand und ihre Ordnung gegen die Ansprüche auf Demokratisierung verteidigt haben“[53].
Mit der übermäßig harten staatlichen Gewalt gegen bis dahin stattgefundene Proteste fühlten sich die Demonstranten in ihrer Kritik am System bestätigt. Wenn beispielsweise auf dem „Tunix-Kongress“ in Berlin Demonstranten eine schwarz-rot-goldene Fahne anzündeten, wurden sie von Polizeikräfte auseinandergeknüppelt. „Das passte [den Protestlern] wunderbar in das System Deutschland“[54].
6. Einflüsse von „Außen“
6.1 Die Studentenbewegung - eine globale Revolution?
Der weltpolitische Rahmen, in den die deutsche Geschichte seit 1945 eingespannt blieb, war in besonderem Maße von einem Faktor bestimmt: Die Ende Januar 1965 massiv einsetzenden amerikanischen Luftangriffe auf Nord-Vietnam führten zu einer immer tieferen Verstrickung der USA in den Vietnamkrieg. Aktiviert durch das „free-speech-movement“ in den Vereinigten Staaten mehrten sich auch in Westdeutschland die Proteste gegen die Amerikanische Kriegspolitik.
In den 60er Jahren waren Reformdebatten, Liberalisierungsbestrebungen und Studentenproteste ein internationales Phänomen: Die Studenten protestierten in nicht nur in Berkeley, Paris, Berlin und Rom – sie revoltierten, mit dem Höhepunkt im Prager Frühling, auch im kommunistischen Block und schlossen sich den Arbeitern in Lateinamerika an. Im Jahr 1968 verbreitete sich der Protest im März nach Prag und im April nach Amerika, wo nach der Ermordung Martin Luther Kings die Schwarzen revoltierten. Auch anhand der Dekolonisations-Bewegung Anfang der 60er Jahre, die dafür sorgte, dass nun zahlreiche, auch in der UN mitwirkende Länder das Interesse der Groß- und Weltmächte auf sich zogen[55], lässt die Vermutung aufkommen, dass es sich um „die erste globale Revolution des 20. Jahrhunderts“[56] gehandelt hat. Dabei waren die verschiedenen Oppositionsbewegungen in den einzelnen Ländern überaus heterogen, wendeten sich aber alle gegen den Obrigkeitsstatt und autoritäre, illiberale Strukturen. In dem durchgängigen Bezug auf die populäre Jugend- und Protestkultur besaßen die verschiedenen Protestbewegungen auch ein gemeinsames Markenzeichen, das ein generationelles Zusammengehörigkeitsgefühl zumindest suggerierte. Sozialgeschichtlich kann man jenseits der national spezifischen Faktoren die 60er „als Dezennium des Umbruchs“ begreifen[57].
6.2 Das Ende des Kalten Krieges
Schon Jahre zuvor, durch das Ende des Kalten Krieges verlor die Bundesrepublik einen weitreichenden Stabilitätsfaktor, denn zuvor hatte man die Hinwendung zum Westen als alleinige Alternative propagiert - und trat damit den Tendenzen einer gesellschaftlichen Liberalisierung entgegen. Mit dem Bau der Berliner Mauer und der Kubakrise einsetzenden Wandel in den Beziehungen zwischen den Großmächten fiel diese „sekundäre Stabilisierung durch den Kalten Krieg“[58] weg. Der Antikommunismus verlor an Bedeutung, das Abflauen des Kalten Krieges bot so eine Voraussetzung für die gesellschaftliche Umorientierung.
7. Gesinnungs- und Wertewandel in der Bundesrepublik
7.1 Entfaltete Industriegesellschaft contra traditionelle Normen
Das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem der Bundesrepublik mit seiner Besitz- und Konsummentalität wurde von neomarxistischen Verfechtern zunehmend in Frage gestellt. Intellektuelle Kreise berauschten sich an Aufbruchparolen der Kennedy-Ära und verstärkten eine verbreitete Erwartungshaltung im Sinne eines Wandels (also der Demokratisierung) aller Gesellschafts- und Lebensbereiche. Der Zeitgeist artikulierte sich in den Postulaten „Modernisierung“ und „Reformen“, der Massenwohlstand als Kennzeichen des sozialstrukturellen Wandels führte zur Ausbildung eines stärker welt- und erlebnisoffenen Lebensgefühls.[59]
Der sich nun auftuende westdeutsche Identitätswandel war mit schweren Widersprüchen verbunden: Eine Kluft zwischen einer „entfaltete Industriegesellschaft und den damit immer stärker als unvereinbar angesehen Normen und Lebensweisen“[60] trat immer energischer in den Vordergrund der Wahrnehmung. Diskussionen über die Notwendigkeit von Veränderungen konzentrierten sich zunächst auf den Rückstand Westdeutschland im Bildungs- und Ausbildungsbereich.
7.2 Die Hochschulreform
Besonders die Reform der Hochschulen spielt bei der Protestbewegung eine eklatante Rolle: Die „Demokratisierung aller Universitäten“[61] stellte das anfängliche Skandalon der studentischen Protestbewegung dar. Diese weitverbreitete These, dass also die Protestler die Hochschulreform wenn nicht begonnen, dann zumindest positiv gefördert haben, stößt allerdings auf Kritik. Die Protestbewegung habe die Hochschulreformpolitik lediglich „sekundär überlagert und dabei zugleich zum Schaden der deutschen Hochschulen verbogen“[62], so Hermann Lübbe.
Die zunehmende Akzeptanz fremder Kulturen, die „Vergesellschaftung der Frauenfrage“[63], der Sachverhalt um die Stellung der Geschlechter zueinander prägten das historische Gesicht nach Ende des Kalten Krieges. Diese Entwicklungen fanden teilweise schon Jahre vor der Studentenbewegung statt. Nichtsdestotrotz haben sie die Protestler aber in ihrem Tun beeinflusst bzw. verstärkt, so dass Carl Leggewie behauptet dass 1968 als „symbolischer Kulminationspunkt eines kultur-evolutionären Prozesses“[64] anzusehen ist.
8. Die Sonderrolle der Massenmedien
8.1 Der „Springer-Konzern“ und die Presse des Ruhrgebietes
Eine Analyse der studentischen Protestbewegung hat auch deren Qualität mit medialen Einflüssen zu untersuchen. Dies legen nicht nur Fernsehberichte über den Vietnam-Krieg, der Kampf gegen den Springer-Konzern und die kulturell-medialen Verarbeitung der Revolten in Kunst, Pop und Musik nahe.
Eine zentrale Rolle in der Debatte um die lang geplante (und am 24.6. 1968 schließlich auch verabschiedete) Notstandsverfassung spielte nämlich der Medienkonzern „Axel Springer“. Insbesondere den Zeitungen aus dem Springer-Verlagshaus wurde vorgeworfen, mit einseitiger Berichterstattung bewusst und zielgerichtet ihre Leser zu manipulieren. Nach Ansicht der APO leistete so vor allem die auflagenstarke „Bild“ einen wesentlichen Beitrag zur politischen Unmündigkeit breiter Teile der Bevölkerung. „Der Impetus der Aufklärung über die Notstandsgesetzte musste nach Meinung der Bewegung daher ins Leere laufen [...].“[65]
In Westdeutschland war besonders in Gebieten, die von Berlin, dem Herd der Studentenbewegung, geographisch isoliert lagen, der Einfluss der Medien von besonderer Bedeutung. So waren beispielsweise die Bürger des Ruhrgebietes auf die mediale Berichterstattung angewiesen. Die regionale Presse des Ruhrgebietes bog sich dabei, je nach politischer Ausrichtung, die Aktionen der Protestler in ihren Berichten zurecht. Die an Leserzahlen dominierende Westdeutsche Allgemeine Zeitung, die dem Stil der „Bild“-Zeitung folgte, zeichnete sich beispielsweise bei der Berichterstattung über regionale Studentenprotesten eine (oft enttäuschte) Sensationsgier aus. Überregionale Ereignisse aus Berlin wurden dagegen oft verfälscht wiedergegeben, es fehlte nicht nur an räumlichen Bezug, sondern auch an Interesse an und Verständnis für die rebellischen Studenten in der Hauptstadt. Auch die „Westfälische Rundstau“ befolgte mit ihrer Berichterstattungs-Taktik eigene Ziele: Auf Grundlage ihrer Verbundenheit zur SPD wurde durch den verständnisvoll angehauchten Rapport über die Protestbewegung Stimmung gegen die CDU gemacht - die Studentenbewegung also instrumentalisiert.
8.2 Studenten und Medien – ein interdependentes Verhältnis
Doch die Mitglieder der Protestbewegung der 60er Jahre waren nicht ausschließlich Opfer der „vierten Gewalt“, denn „Inszenierung mediengerechter Aktionen“[66] entwickelten sich immer mehr zu einem festen Bestandteil im Handlungsrepertoire der APO. Zwischen Studenten und Medien herrschte also eine Interdependenz, indem „einerseits die Studenten die Medien für ihre Zwecke funktionalisierten und umgekehrt die Medien die Aktionen der Studenten auf ihre Weise verarbeiteten“[67].
Die mediale Präsenz hat die „68er“-Bewegung zwar beeinflusst, war aber kein Punkt, an dem sich die Studenten konkret stießen. (Revolten gegen Springer bezogen sich schließlich nicht auf die Medien allgemein). Die Medien fungierten also als Intensivierer, Proteste und Unruhen wurden durch die „Sekundärzündungen der Medien gebündelt und verstärkt“[68].
Die Wirkung der Medien, des Gesinnungswandels der Nachkriegszeit und der politischen Ereignisse der 60er Jahre bringt Claus Leggewie auf einen Nenner: „1968 fokussiert also raum- und zeitspezifische Empörungsmotive am Ende der Nachkriegszeit, die durch die massenmedial verallgemeinerte Wahrnehmung eines katalysierenden Ereignisses (wie zum Beispiel der Vietnam-Krieg) international synchronisiert wurden und sich gegenseitig verstärkten“.[69]
III. Schlussteil
Welcher Rückschluss lässt sich nun aus diesem Sammelsurium von Faktoren ziehen? Dass die Studentenbewegung von „’68“ nicht nur einem Quell entstammt, sondern dass eine ganze Kette von Ereignissen auf die Studentenbewegung gewirkt hat - die zentrale These dieser Arbeit hat sich also bestätigt. Dabei waren es einerseits Faktoren, die „nur“ Wegbereiter des Protestes darstellten, wie beispielsweise die politische Sozialisation mit der langen Phase des Friedens und den politisch zurückgezogen und konsumorientierten Eltern. Aber auch die unzureichende Vergangenheitsbewältigung, die Angleichung der Parteien aneinander und außenpolitische Geschehnisse wie das Ende des Kalten Krieges haben Wandlungen in der Geschichte verursacht, die für „’68“ ein fruchtbares Fundament bildeten. Inzwischen zum Aufruhr motiviert, gab es dann wiederum Faktoren, gegen die Studenten und Intellektuelle konkret revoltierten. Die Notstandsgesetze, der Vietnam-Krieg und der Springer-Konzern beispielsweise wurden zur direkten Zielscheibe studentischen Protestes. Die Massenmedien nahmen dabei eine ambivalente Funktion ein. Einerseits zogen sie den Unmut der Studenten auf sich, weil sie hautsächlich gegen die studentischen Interessen berichteten. Andererseits nahmen sich die Demonstranten die Medien aber auch zur Hilfe, um ihre Meinungen kundzutun, ihre Aktionen publik zu machen.
Die Rolle der unzureichenden Aufklärung der nationalsozialistischen Vergangenheit als Antriebselement für „’68“ machte dabei eine Entwicklung durch. Da durch die DDR laufend mit dem Sozialismus konfrontiert, ließen die Protestler der 60er Jahre das Phänomen der Vergangenheitsbewältigung schließlich in einer erregt betriebenen Faschismusdebatte münden. So ist es wenig verwunderlich, das sich die historische und politische Forschung von dieser Art, annährend alles als faschistisch zu bezeichnen, distanzierte. Dieser Vorgehensweise bin auch ich persönlich sehr abgeneigt, und so kann ich (ausnahmsweise) auch den zur Studentenbewegung generell sehr kritisch eingestellten Philosophen Hermann Lübbe verstehen, wenn seiner Ansicht nach die Bezeichnung „kritische Generation“ für die studentische Protestbewegung der 60er Jahre vollkommen fehl am Platze ist.
IV. Literaturverzeichnis
- Bartz Olaf, Konservative Studenten und die Studentenbewegung: Die „Kölner Studenten-Union“ (KSU), in: Teppe Karl (Hg.), Westfälische Forschung, Münster 1998
- Becker Thomas P. / Schröder Ute (Hg.), Die Studentenproteste der 60er Jahre. Archivführer – Chronik – Bibliographie, Böhlau 2000
- Conze Werner / Lepsius M. Rainer (Hg.), Sozialgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Beiträge zum Kontinuitätsproblem2, Stuttgart 1985
- Dahrendorf Ralf, Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, München 1968
- Gilcher-Holtey Ingrid (Hg.), 1968. Vom Ereignis zum Gegenstand der Geschichtswissenschaft, Göttingen 1998
- Güse Wiebke, Die verschüttete Tradition: Studentische Hochschulpolitik vor 1968. Das Beispiel Bochum, in: Teppe Karl (Hg.), Westfälische Forschung, 48/1998, Münster 1998
- Herbert Ulrich, Liberalisierung und Radikalisierung. Zwei Gründungsmythen der Bundesrepublik, Freiburg 2001
- Hillgruber Andreas, Deutsche Geschichte 1945-1982. Die „deutsche Frage“ in der Weltpolitik4, Stuttgart 1983
- Horner Franz, Die Große Koalition, in: Schneider Franz (Hg.), Der Weg in die Bundesrepublik. Von 1945 bis zur Gegenwart, München 1985, S. 88 f.
- Kersting Franz-Werner, Entzauberung des Mythos? Ausgangsbedingungen und Tendenzen einer gesellschaftsgeschichtlichen Standortbestimmung der westdeutschen ’68er’-Bewegung, in: Teppe Karl (Hg.), Westfälische Forschung, 48/1998, Münster 1998
- Kukuck Margareth, Student und Klassenkampf. Studentenbewegung in der BRD seit 1967, Hamburg 1974
- Langguth Gerd, Die Entwicklung der Prostbewegung und ihre gesellschaftspolitische Bedeutung in der Bundesrepublik, in: Die Studentische Protestbewegung. Analysen und Konzepte, Bonn 1971
- Leggewie Claus, 1968: Ein Laboratorium der nachindustriellen Gesellschaft? Zur Tradition der antiautoritären Revolte seit den sechziger Jahren, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 20/88, Bonn 1988
- Lindner Werner, Die Studentenbewegung im Spiegel der Ruhrgebietspresse, in: Teppe Karl (Hg.), Westfälische Forschung, 48/1998, Münster 1998
- Lübbe Hermann, Der Mythos der “kritischen Generation“. Ein Rückblick, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 20/88, Bonn 1988
- Morsey Rudolf, Die Bundesrepublik Deutschland. Entstehung und Entwicklung bis 1969 3, München 1995
- Oberndörfer Dieter / Rattinger Hans / Schmitt Karl, Wirtschaftlicher Wandel, religiöser Wandel und Wertewandel. Folgen für das politische Verhalten in der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1985
- Proske Rüdiger, Auf der Suche nach der Welt von morgen. Ein erster Überblick, Köln 1968
- Seidel Heinrich Ulrich, „Wir waren so himmelblaue Idealisten“. Die Eltern der 68er am Beispiel der Mitglieder des Freideutschen Kreises, in: Teppe Karl (Hg.), Westfälische Forschung, 48/1998, Münster 1998
- Sontheimer Kurt, Deutschland zwischen Demokratie und Antidemokratie. Studien zum politischen Bewusstsein der Deutschen, München 1971
- Sontheimer Michael, Rebellion ist gerechtfertigt. Bericht eines „Post68ers“, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 20/88, Bonn 1988
- Thamer Hans-Ulrich, Die NS-Vergangenheit im politischen Diskurs der 68er-Bewegung, in: Teppe Karl (Hg.), Westfälische Forschung, 48/1998, Münster 1998
[...]
[1] Thamer Hans-Ulrich, Die NS-Vergangenheit im politischen Diskurs der 68er-Bewegung, in: Teppe Karl (Hg.), Westfälische Forschung, 48/1998, Münster, S.39
[2] Della Porta Donatella, „1968“ - Zwischennationale Diffusion und Transnationale Strukturen. Eine Forschungsagenda, in: Gilcher-Holtey Ingrid (Hg.), 1968. Vom Ereignis zum Gegenstand der Geschichtswissenschaft, Göttingen 1998, S.137
[3] Leggewie Claus, 1968: Ein Laboratorium der nachindustriellen Gesellschaft? Zur Tradition der antiautoritären Revolte seit den sechziger Jahren, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 20/88, Bonn 1988, S.7
[4] Morsey Rudolf, Die Bundesrepublik Deutschland. Entstehung und Entwicklung bis 19693, München 1995, S.19
[5] Seidel Heinrich Ulrich, „Wir waren so himmelblaue Idealisten“. Die Eltern der 68er am Beispiel der Mitglieder des Freideutschen Kreises, in: Teppe Karl (Hg.), Westfälische Forschung, 48/1998, Münster 1998, S.59
[6] Seidel, “Himmelblaue Idealisten“, S.59
[7] Seidel, „Himmelblaue Idealisten2, S.62
[8] Sontheimer Michael, Rebellion ist gerechtfertigt. Bericht eines „Post68ers“, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 20/88, Bonn 1988, S.36
[9] Herbert Ulrich, Liberalisierung und Radikalisierung. Zwei Gründungsmythen der Bundesrepublik, Freiburg 2001, S.1
[10] Leggewie, 1968, S.7
[11] Leggewie, 1968, S.8
[12] Seidel, himmelblaue Idealisten, S.64
[13] Langguth, Prostbewegung, S.53
[14] Langguth, Prostbewegung, S.53
[15] Güse Wiebke, Die verschüttete Tradition: Studentische Hochschulpolitik vor 1968. Das Beispiel Bochum, in: Teppe Karl (Hg.), Westfälische Forschung, 48/1998, Münster 1998, S.192
[16] Güse, Tradition, S.193
[17] Güse, Tradition, S.196
[18] Güse, Tradition, S.191
[19] Leggewie, 1968, S.8
[20] Leggewie, 1968, S.9
[21] Langguth, Prostbewegung, S.56
[22] Langguth, Prostbewegung, S.55
[23] Herbert, Liberalisierung, S.4
[24] Thamer, NS-Vergangenheit, S.39
[25] Thamer, NS-Vergangenheit, S.43
[26] Thamer, NS-Vergangenheit, S.44
[27] Thamer, NS-Vergangenheit, S.44
[28] Sontheimer Kurt, Deutschland zwischen Demokratie und Antidemokratie. Studien zum politischen Bewusstsein der Deutschen, München 1971, S.155
[29] Morsey, Bundesrepublik Deutschland, S.19
[30] Leggewie, 1968, S.10
[31] Hermann Lübbe, Der Mythos der “kritischen Generation“. Ein Rückblick, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 20/88, Bonn 1988, S.18
[32] Herbert, Liberalisierung, S.6
[33] Lübbe, Mythos, S.20
[34] Thamer, NS-Vergangenheit, S.39
[35] Herbert, Liberalisierung, S.7
[36] Herbert, Liberalisierung, S.6
[37] Thamer, NS-Vergangenheit, S.51
[38] Bartz Olaf, Konservative Studenten und die Studentenbewegung: Die „Kölner Studenten-Union“ (KSU), in: Teppe Karl (Hg.), Westfälische Forschung, Münster 1998, S.244
[39] Sontheimer, Rebellion, S.37 f.
[40] Leggewie, 1968, S.11
[41] Morsey, Bundesrepublik Deutschland, S.69
[42] Herbert, Liberalisierung, S.1
[43] Morsey, Bundesrepublik Deutschland, S.94
[44] Hillgruber, Deutsche Geschichte, S.94
[45] Morsey, Bundesrepublik Deutschland, S.93
[46] Hillgruber, Deutsche Geschichte, S.73
[47] Richter, Außerparlamentarische Opposition, S.41
[48] Langguth, Prostbewegung, S.56
[49] Morsey, Bundesrepublik Deutschland, S.98
[50] Richter, Außerparlamentarische Opposition, S.42
[51] Richter, Außerparlamentarische Opposition, S.45
[52] Leggewie, 1968, S.10
[53] Sontheimer, Deutschland, S.143
[54] Sontheimer, Rebellion, S.39
[55] Hillgruber, Deutsche Geschichte, S.80
[56] Della Porta, Diffusion, S.131
[57] Herbert, Liberalisierung, S.5
[58] Herbert, Liberalisierung, S.2
[59] Morsey, Bundesrepublik Deutschland, S.93
[60] Herbert, Liberalisierung, S.2
[61] Güse, Tradition, S.209
[62] Lübbe, Mythos, S.17
[63] Kersting Franz-Werner, Entzauberung des Mythos? Ausgangsbedingungen und Tendenzen einer gesellschaftsgeschichtlichen Standortbestimmung der westdeutschen ’68er’-Bewegung, in: Teppe Karl (Hg.), Westfälische Forschung, 48/1998, Münster 1998
[64] Leggewie, Laboratorium, S.4
[65] Richter, Außerparlamentarische Opposition, S.52
[66] Lindner Werner, Die Studentenbewegung im Spiegel der Ruhrgebietspresse, in: Teppe Karl (Hg.), Westfälische Forschung, 48/1998, Münster, S.217
[67] Lindner, Ruhrgebietspresse, S.217
[68] Morsey, Bundesrepublik Deutschland, S. 107
Häufig gestellte Fragen
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit über die Studentenbewegung von 1968?
Der zentrale Gegenstand dieser Arbeit ist die Untersuchung der Faktoren, die die studentische Protestbewegung der 60er Jahre in Westdeutschland maßgeblich beeinflusst haben, mit einem besonderen Fokus auf die Bewältigung der nationalsozialistischen Vergangenheit.
Welche These wird in Bezug auf die Rolle der Vergangenheitsbewältigung vertreten?
Die zentrale These lautet, dass die Vergangenheitsbewältigung in der Studentenbewegung eine große Rolle gespielt hat, aber "1968" in dieser Form nicht nur durch dieses Phänomen zustande gekommen wäre. Es wird argumentiert, dass ein komplexes Zusammenspiel zahlreicher Faktoren die Proteste der damaligen Zeit geschürt hat.
Welche Hauptkategorien werden verwendet, um die Faktoren zu ordnen, die zu "1968" beigetragen haben?
Die Faktoren werden in acht Hauptkategorien eingeteilt: Politische Sozialisation, Bewältigung der NS-Vergangenheit, Faschismusdebatte, wirtschaftliche Entwicklung, Politik und Parteienlandschaft, Einflüsse von Außen, Gesinnungs- und Wertewandel, sowie die Rolle der Medien.
Welche Sozialisationsagenturen werden im Hauptteil der Arbeit betrachtet?
Im Hauptteil werden das Elternhaus und die Universität als Sozialisationsagenturen der "68er"-Generation betrachtet.
Wie wird die Rolle der Eltern der "68er"-Generation beschrieben?
Die Eltern werden als Teil der Aufbaugeneration beschrieben, die ihre Kindheit im Kaiserreich als idyllisch empfanden, während die Weimarer Republik als Zeit des Umbruchs wahrgenommen wurde. Nach dem Nationalsozialismus zogen sie sich ins Private zurück und vermieden politische Auseinandersetzung.
Welche Rolle spielte die Universität als Sozialisationsagentur?
Die Universität wird als Aktionszentrum für die Protestbewegung gesehen. Die Krise des Hochschulsystems und die Hochschulreform Ende der 50er Jahre werden als spezifischer Entstehungshintergrund der studentischen Bewegung betrachtet. Die Universität ermöglichte Kritik und Reflexion.
Wie wird die Bewältigung der nationalsozialistischen Vergangenheit im Text beschrieben?
Unmittelbar nach 1945 herrschte zwar Ablehnung gegenüber der NS-Zeit, aber gleichzeitig wurde versucht, die zwölf Jahre des Hitlerregimes zu bagatellisieren. Später entdeckte eine nachgewachsene Generation die historische Erblast neu und forderte die Säuberung der Gesellschaft von vermeintlichen Relikten der braunen Vergangenheit.
Wie wird die Faschismusdebatte in Verbindung zur Studentenbewegung gesetzt?
Die Faschismusdebatte wurde im Sprachgebrauch der Protestbewegung immer beliebter. Es ging weniger um die Erklärung der nationalsozialistischen Vergangenheit, als vielmehr um die Anklage der Gesellschaft der Gegenwart. Es wurde ein Zusammenhang zwischen Faschismus und Kapitalismus konstruiert.
Welche wirtschaftlichen Faktoren werden als relevant für die Studentenbewegung genannt?
Die Rezession der 60er Jahre und der psychologische Schock, den sie in weiten Teilen der Bevölkerung Westdeutschlands auslöste, werden als relevante wirtschaftliche Faktoren genannt.
Wie wird die Politik und Parteienlandschaft in den 60er Jahren beschrieben?
Die Tendenz zur Mitte der Parteien und das Experiment der Großen Koalition werden als wichtige politische Entwicklungen beschrieben. Die Große Koalition führte zur Bildung der Außerparlamentarischen Opposition (APO).
Welche Einflüsse von Außen werden für die Studentenbewegung genannt?
Der Vietnamkrieg und die damit verbundene Kritik an der amerikanischen Politik, Reformdebatten, Liberalisierungsbestrebungen, Studentenproteste als internationales Phänomen und das Ende des Kalten Krieges werden als Einflüsse von Außen genannt.
Wie wird der Gesinnungs- und Wertewandel in der Bundesrepublik beschrieben?
Der Gesinnungs- und Wertewandel wird als Kluft zwischen einer entfalteten Industriegesellschaft und den damit als unvereinbar angesehenen traditionellen Normen und Lebensweisen beschrieben. Die Hochschulreform und die Vergesellschaftung der Frauenfrage prägten das historische Gesicht nach Ende des Kalten Krieges.
Welche Rolle spielten die Massenmedien bei der Studentenbewegung?
Die Massenmedien spielten eine ambivalente Rolle. Einerseits wurde dem Springer-Konzern vorgeworfen, mit einseitiger Berichterstattung zu manipulieren. Andererseits entwickelten sich "Inszenierung mediengerechter Aktionen" zu einem festen Bestandteil im Handlungsrepertoire der APO. Zwischen Studenten und Medien herrschte also eine Interdependenz.
- Quote paper
- Julia Tzschätzsch (Author), 2002, Die Bewältung der NS-Vergangenheit: Skandalon der "'68er"-Bewegung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110053