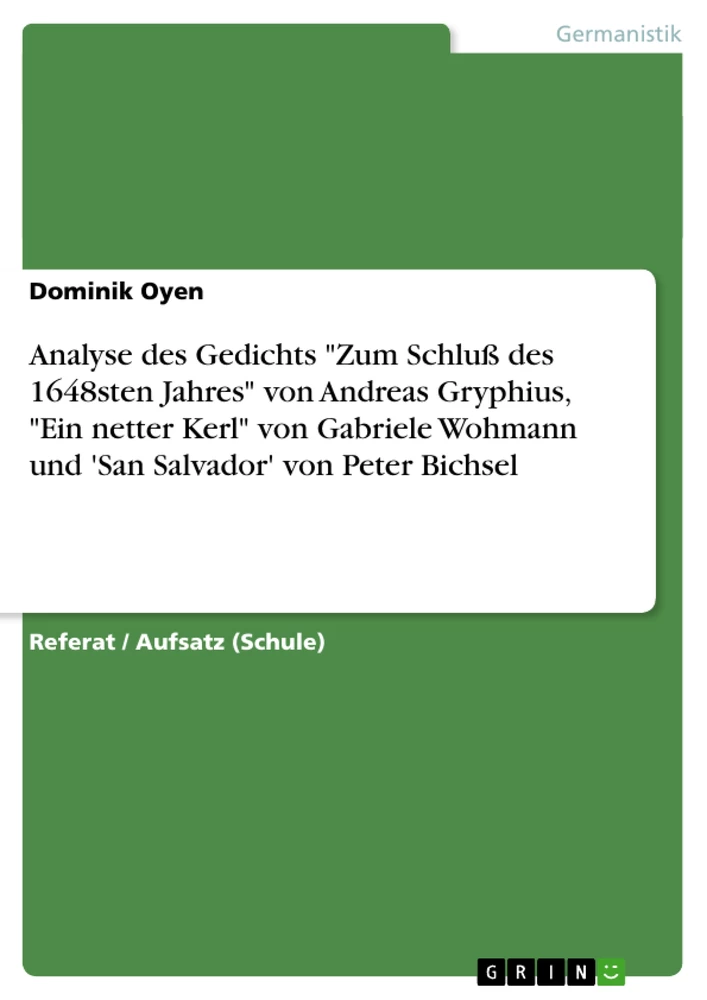Was bleibt, wenn der Donner der Kanonen endlich verstummt? Andreas Gryphius' ergreifendes Sonett "Schluss des 1648sten Jahres" katapultiert uns direkt in die seelische Trümmerlandschaft nach dem Dreißigjährigen Krieg. Ein lyrisches Ich ringt inmitten von "Leichen, Pest und schwerer Not" nach einem Hoffnungsschimmer, nach einem Sinn jenseits von Zerstörung und Elend. Mit eindringlichen Imperativen und einer kraftvollen Anapher beschwört der Sprecher das Ende des Leids und fleht um Erlösung von der "Last" des Krieges. Doch ist die ersehnte Friedenszeit wirklich mehr als ein flüchtiger "verschmelzter Schnee"? Kann ein von Krieg gezeichnetes Leben noch einmal aufblühen, oder verglimmt es wie eine "ausgebrannte Kerze"? Gryphius' meisterhafte Sonettform, geprägt von umschließendem Reim und Schweifreim, verstärkt die innere Zerrissenheit und das verzweifelte Ringen um Sinnfindung. Die barocken Stilmittel Memento mori und Vanitas durchziehen das Gedicht und erinnern an die Vergänglichkeit des Lebens und die ständige Konfrontation mit dem Tod. Das lyrische Ich fleht um eine "Frist", um sich dem Leben noch einmal zuwenden zu können, bevor die "Bahre" ruft. In einem abschließenden Litotes kulminiert die eindringliche Bitte an Gott, dem Sprecher das "liebliches Geschenk" eines friedvollen Lebens nicht zu "mißgönnen". Dieses Werk ist ein ergreifendes Zeugnis der Barockzeit, das die tiefen Wunden des Krieges, die Sehnsucht nach Frieden und die Frage nach dem Sinn des Lebens in einer von Leid und Tod gezeichneten Welt aufwühlt. Eine zeitlose Auseinandersetzung mit der menschlichen Existenz und der Hoffnung auf ein besseres Morgen.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Andreas Gryphius' Gedicht "Schluss des 1648sten Jahres"?
Das Gedicht handelt vom Ende des Dreißigjährigen Krieges und der Hoffnung auf ein neues, friedliches Leben durch Gottes Hilfe. Es beschreibt die Situation kurz nach Kriegsende, in der sich das lyrische Ich ein friedliches Leben wünscht und an Gott appelliert.
Welche Form hat das Gedicht?
Das Gedicht ist ein Sonett, bestehend aus zwei Quartetten (Oktett) und zwei Terzetten (Sextett). Das Reimschema der Quartette ist abba, abba (umschließender Reim), und das der Terzetten ist ccd, eed (Schweifreim).
Welche Stilmittel werden im Gedicht verwendet?
Das Gedicht verwendet Anaphern (z.B. zu Beginn), Akkumulationen, rhetorische Fragen, Vergleiche und Litotes. Es finden sich auch typische Barockmuster wie "memento mori" (in der Kriegsbeschreibung) und "vanitas" (in der Angst vor dem Tod ohne Glück).
Was bittet das lyrische Ich von Gott?
Das lyrische Ich bittet Gott, von den seelischen Folgen des Krieges befreit zu werden, ihm noch Zeit zu geben, sich um etwas anderes im Leben zu kümmern, und ihm vor dem Tod noch Freude zu schenken.
Welche Rolle spielt der Krieg im Gedicht?
Der Krieg wird als eine Zeit des Leids und der Sinnlosigkeit dargestellt, von der sich das lyrische Ich befreien möchte. Es wird betont, dass das Leben mehr sein muss, als nur für den Krieg gelebt zu haben.
Was bedeutet die Aussage "Mißgönne mir doch nicht dein liebliches Geschenk"?
Diese Aussage am Ende des Gedichts ist eine Litotes (Doppelverneinung), die die Bitte des lyrischen Ichs an Gott verstärkt. Es betont, wie wichtig es dem lyrischen Ich ist, sein Leben nun glücklich fortzuführen und seine schlimme Vergangenheit zu verarbeiten.
- Arbeit zitieren
- Dominik Oyen (Autor:in), 2006, Analyse des Gedichts "Zum Schluß des 1648sten Jahres" von Andreas Gryphius, "Ein netter Kerl" von Gabriele Wohmann und 'San Salvador' von Peter Bichsel, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110059